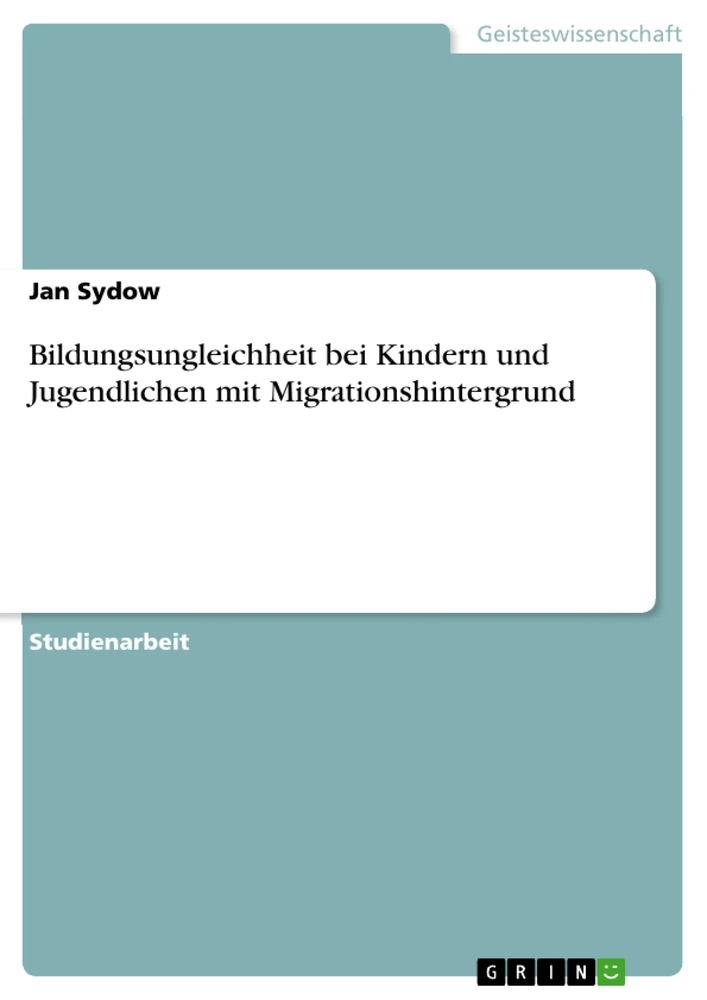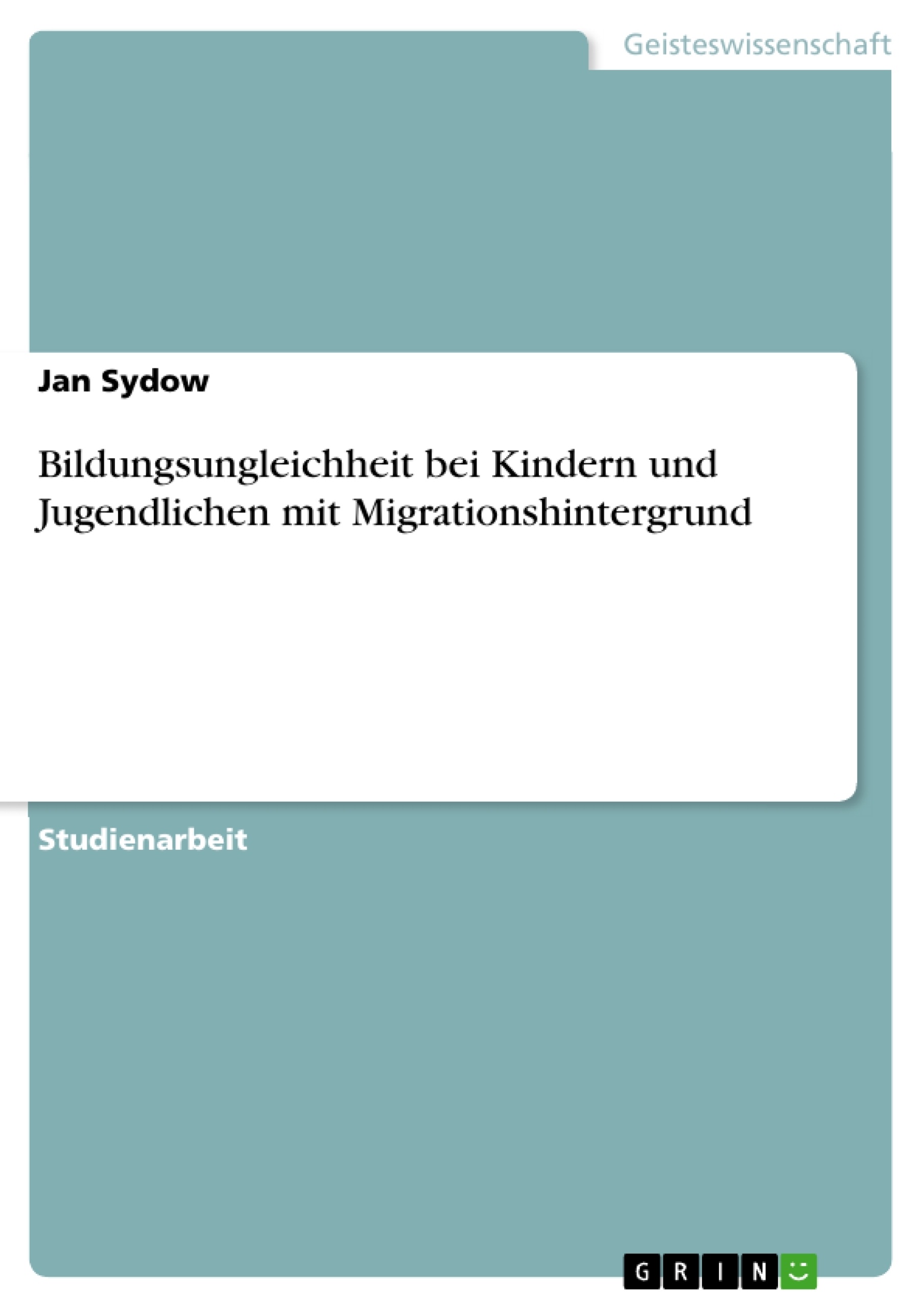Dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, hat inzwischen ein relativ großer Teil der Bundesbürger begriffen und auch in den konservativen Volksparteien hat man sich inzwischen mit dieser Tatsache abgefunden. Einwanderung nach Deutschland findet allerdings nicht erst seit kurzem statt, sondern ist vielmehr ein integraler Bestandteil der deutschen Geschichte.
Dennoch hat die Zuwanderung nach Ende des Zweiten Weltkrieges an Intensität zugenommen. So wandern zwischen 1961 und 2000 rund 25 Millionen Menschen in die BRD von denen 18,7 Millionen sie auch wieder verlassen. Menschen mit Migrationshintergrund stellen heute knapp 9% der bundesdeutschen Bevölkerung (ohne dabei die Spätaussiedler zu berücksichtigen) unter ihnen befinden sich zu großen Teilen die Arbeitsmigranten der 60er Jahre aus Anwerberländern wie Griechenland, Italien oder der Türkei, Übersiedler, Sinti und Roma, Asylsuchende, Bürgerkriegsflüchtlinge und Vertragsarbeiter aus der ehemaligen DDR wie Kubaner, Angolaner, Polen, Vietnamesen und Ungarn.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thesen
- Der Kapital- und Habitusbegriff von Bourdieu
- Bildungssituation und Bildungserfolg von Migranten in der BRD
- Unterschiede in der Ressourcenausstattung
- Familie und familiäres Umfeld
- Ethnische Segregation
- Der Faktor Sprache und der Schulerfolg von Kindern mit Migrationshintergrund
- Die Rolle der deutschen Schule hinsichtlich der Bildungsbenachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Verifizierung und Falsifizierung der Thesen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Determinanten der Bildungsungleichheit bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Sie analysiert die Rolle verschiedener Faktoren wie Familie, Sprache, ethnische Segregation und die deutsche Bildungsinstitutionen, die Einfluss auf den Bildungserfolg oder -Misserfolg haben können.
- Die Bedeutung des Kapital- und Habitusbegriffs nach Pierre Bourdieu für das Verständnis der Bildungssituation von Migrantenkindern
- Die Herausforderungen, denen Migrantenkindern im deutschen Bildungssystem gegenüberstehen
- Die Rolle von Familie und familiärem Umfeld bei der Unterstützung von Kindern mit Migrationshintergrund
- Die Auswirkungen von ethnischer Segregation auf den Schulerfolg von Migrantenkindern
- Die Bedeutung von Sprache und Sprachkompetenz für die Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung des Themas Bildungsungleichheit bei Migrantenkindern in Deutschland hervorhebt und die zentralen Fragestellungen der Arbeit umreißt.
Im Anschluss werden die wichtigsten Thesen vorgestellt, die die Grundlage der Untersuchung bilden.
Es folgt eine Erläuterung des Kapital- und Habitusbegriffs nach Pierre Bourdieu, die als theoretisches Fundament für die Analyse der Bildungsungleichheit dient.
In den folgenden Kapiteln werden die Bildungssituation und der Bildungserfolg von Migrantenkindern in der BRD beleuchtet, wobei die Verteilung von Schulabschlüssen und Schultypen im Laufe der Zeit betrachtet wird.
Das Kapitel "Unterschiede in der Ressourcenausstattung" behandelt die Unterschiede in der Ausstattung von deutschen und Migrantenkindern mit verschiedenen Ressourcen.
Die Kapitel 6 bis 9 untersuchen dann die vier zentralen Faktoren, die Einfluss auf den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund haben: Familie, ethnische Segregation, Sprache und die deutsche Bildungsinstitution.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, Migrationshintergrund, Familie, Sprache, ethnische Segregation, deutsche Bildungsinstitutionen, Kapital, Habitus, Pierre Bourdieu, Schulerfolg, Bildungschancen, Diskriminierung, Integration, Sozialisation
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptursachen für Bildungsungleichheit bei Migranten?
Die Arbeit analysiert Faktoren wie Unterschiede in der familiären Ressourcenausstattung, Sprache, ethnische Segregation und institutionelle Benachteiligung durch deutsche Schulen.
Welche Rolle spielt Bourdieus Kapitalbegriff?
Pierre Bourdieus Konzepte von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital sowie der "Habitus" dienen als theoretische Basis, um den unterschiedlichen Bildungserfolg zu erklären.
Wie beeinflusst die Sprache den Schulerfolg?
Sprachkompetenz gilt als zentraler Schlüssel; die Arbeit untersucht, wie mangelnde Förderung in der Bildungssprache die Chancen von Kindern mit Migrationshintergrund mindert.
Was bedeutet "ethnische Segregation" im Bildungswesen?
Es beschreibt die räumliche und soziale Trennung von Bevölkerungsgruppen, die dazu führen kann, dass Migrantenkinder häufiger Schulen mit schlechteren Rahmenbedingungen besuchen.
Wird Deutschland als Einwanderungsland im Bildungssystem gerecht?
Die Untersuchung hinterfragt kritisch die Rolle deutscher Bildungsinstitutionen und prüft, ob diese bestehende soziale Ungleichheiten eher zementieren als abbauen.
- Citar trabajo
- Jan Sydow (Autor), 2006, Bildungsungleichheit bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268619