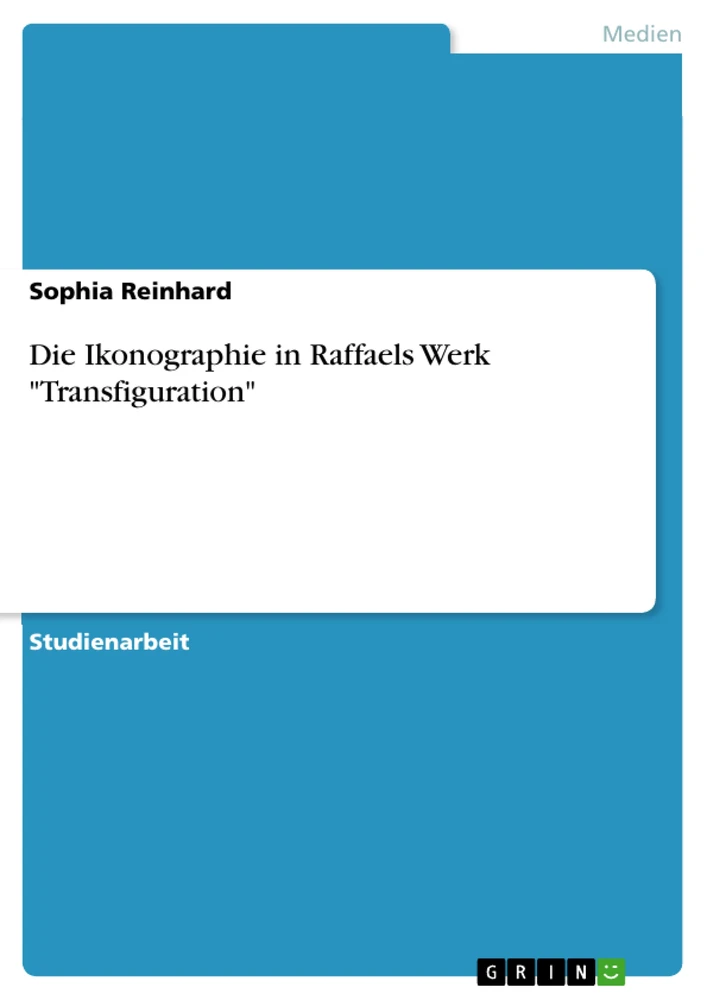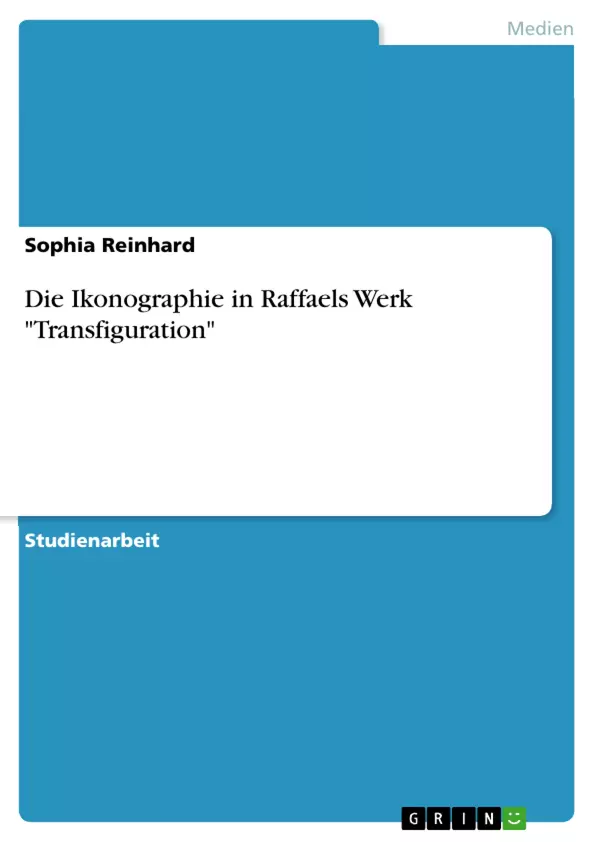Die Transfiguration wird als Raffaels letztes Werk angesehen und wurde vor allem nach dem Tod des Künstlers als etwas ganz Besonderes und Außergewöhnliches bezeichnet. Man erzählte sich damals, Raffael sei mit dem Pinsel an der Leinwand dieses Gemäldes gestorben. „An einem Karfreitag des Jahres 1483 soll Raffael geboren worden sein, am Karfreitag, dem 6. April 1520, starb er in Rom über der Vollendung des Werkes, das unter seiner Hand zu einer der lebendigsten Verkörperungen christlicher Heilsgewissheit geworden war.“ Raffael umgab ein Mythos, der sich besonders an dieses Bild heftet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1. Auftraggeber
- I.2. Bestimmungsort
- II. Beschreibung
- II.1. Bibelstelle
- II.2. Kompositorische Umsetzung
- III. Werkgenese
- III.1. Modello aus der Albertina in Wien
- III.2. Modello aus dem Louvre
- III.3. Endfassung
- IV. Ikonographie
- IV.1. Traditionelle Ikonographie
- IV.2. Raffaels Neuerungen
- IV.3. Mögliche Gründe für den Bruch mit ursprünglichen Bildtraditionen
- IV.3.1. Wettbewerb mit Sebastiano del Piombo
- IV.3.2. Mediceische Deutung
- IV.3.3. Künstlerische Entwicklung
- V. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Raffaels „Transfiguration“ und analysiert, ob das Werk einen Bruch mit der traditionellen Ikonographie darstellt. Der Fokus liegt auf der Analyse des Gemäldes, seiner Entstehungsgeschichte und der Einordnung in den künstlerischen Kontext der Renaissance. Besonderes Augenmerk wird auf die kompositorischen Neuerungen und die mögliche mediceische Deutung gelegt.
- Analyse der kompositorischen Neuerungen von Raffaels „Transfiguration“
- Die Einordnung des Werks in die künstlerische Entwicklung Raffaels
- Der Einfluss des Wettbewerbs mit Sebastiano del Piombo
- Mögliche Gründe für die Kombination der Verklärung Christi mit der Besessenenszene
- Mediceische Deutung der „Transfiguration“
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung führt den Leser in das Thema der Arbeit ein. Es werden der Auftraggeber, der Bestimmungsort und der Entstehungszeitraum der „Transfiguration“ beleuchtet. Außerdem werden die Hauptthemen der Arbeit vorgestellt.
- II. Beschreibung: Dieses Kapitel beschreibt das Werk im Detail, analysiert die Bibelstelle und die kompositorische Umsetzung. Der Fokus liegt auf der Struktur des Bildes, der Zusammenstellung des Bildpersonals und den einzelnen Elementen, die im Gesamtkontext des Werks eine Rolle spielen.
- III. Werkgenese: Dieses Kapitel widmet sich der Entstehungsgeschichte des Gemäldes. Es werden zwei Modello, die der Entstehung der „Transfiguration“ vorausgingen, vorgestellt und analysiert. Das Kapitel zeigt die Entwicklung des Bildkonzepts von der ersten Skizze zur endgültigen Ausführung.
- IV. Ikonographie: Dieses Kapitel untersucht die Ikonographie der „Transfiguration“ im Vergleich zu anderen Werken, die sich mit dem gleichen Thema befassen. Es werden die Neuerungen, die Raffael in seinem Werk eingebracht hat, und die möglichen Gründe für den Bruch mit der traditionellen Darstellung der Verklärung Christi beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Ikonographie, der Werkgenese und der Mediceischen Deutung von Raffaels „Transfiguration“. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Verklärung Christi, Ikonographie, Komposition, Werkgenese, Auftraggeber, Medici, Sebastiano del Piombo, Michelangelo, Wettbewerb.
Häufig gestellte Fragen
Was stellt Raffaels Werk "Transfiguration" dar?
Das Gemälde kombiniert zwei biblische Szenen: die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor und die Heilung eines besessenen Knaben.
Warum gilt das Bild als etwas Besonderes in Raffaels Schaffen?
Es ist Raffaels letztes Werk; er starb am Karfreitag 1520 während der Vollendung des Gemäldes, was zur Mythenbildung um das Bild beitrug.
Welche ikonographischen Neuerungen führte Raffael ein?
Raffael brach mit der Tradition, indem er die Verklärung und die Besessenenszene in einer dramatischen Komposition vereinte, was zuvor unüblich war.
Welche Rolle spielte der Wettbewerb mit anderen Künstlern?
Die Arbeit beleuchtet den künstlerischen Wettstreit mit Sebastiano del Piombo (und indirekt Michelangelo) als Motiv für die innovative Gestaltung.
Wer war der Auftraggeber der Transfiguration?
Das Werk wurde von Kardinal Giulio de' Medici (dem späteren Papst Clemens VII.) in Auftrag gegeben.
Was ist ein "Modello" im Kontext der Werkgenese?
Ein Modello ist ein Entwurf oder eine Vorzeichnung; die Arbeit analysiert Modelle aus der Albertina (Wien) und dem Louvre, um die Entwicklung des Bildkonzepts zu zeigen.
- Quote paper
- Sophia Reinhard (Author), 2011, Die Ikonographie in Raffaels Werk "Transfiguration", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270437