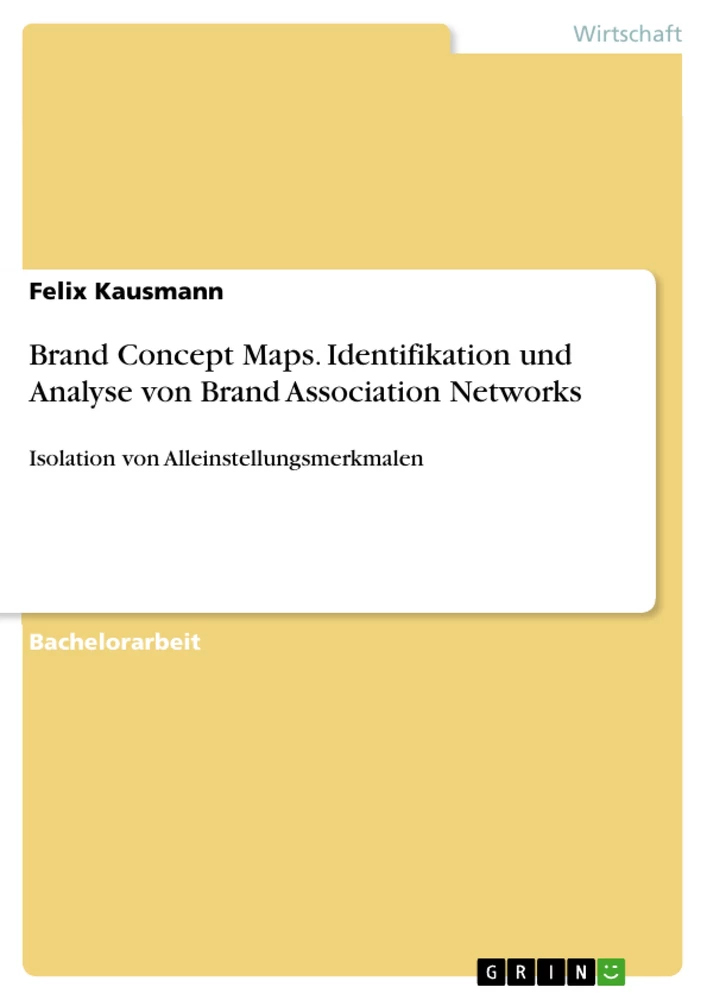Gemäß den Rankings von Interbrand (2014) und Forbes (2014) beträgt der Wert der derzeit weltweit erfolgreichsten Marke Apple rund 100 Milliarden US-Dollar. Die Werte, die einzelnen Marken zugesprochen werden, sind von beeindruckenden Ausmaßen. Der Aufbau und die Pflege einer starken Marke scheinen vor diesem Hintergrund eine hoher Priorität zu besitzen. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung den Inhalt und die Struktur der Markenassoziationen, definiert als Reaktionen, die hervorgerufen werden wenn Konsumenten an eine Marke denken, zu verstehen.
Die Abgrenzung wird dabei als Hauptaufgabe von Marken, Markenbildung und Markenmanagement gesehen und durch die Bildung von Alleinstellungsmerkmalen, sogenannten Unique Selling Propositions (USPs), erreicht. Diese für den Kunden relevanten Unterscheidungsmerkmale eines Produktes verschaffen dem Unternehmen im Vergleich mit konkurrierenden Produkten einen Wettbewerbsvorteil.
Die Darstellung der USPs einer Marke und ihrer beeinflussenden Faktoren ist die Zielsetzung einer in dieser Arbeit vorgestellten Abwandlung der Brand Concept Map (BCM), einer Methode zur Abbildung der in einem Netzwerk strukturierten Markenassoziationen. Im folgenden zweiten Kapitel werden Assoziationen zunächst als Elemente eines kognitiven Netzwerks beschrieben und als Brand Association Network in den Bereich der Marken eingeordnet. Das dritte Kapitel stellt die BCM-Methodik vor, erläutert ihre Eigenschaften sowie die Eignung zur Erfassung der zuvor beschriebenen assoziativen Netzwerke. Die Änderungen und Erweiterungen zur Methode der Advanced Brand Concept Map (aBCM)werden im nachfolgenden Block unter Berücksichtigung des gesteigerten Nutzens für die Praxis zusammengefasst. Darauf aufbauend wird eine neue Darstellungsform – die Unique Brand Concept Map (uBCM) – entwickelt, welche die strategische Relevanz von Alleinstellungsmerkmalen in den Vordergrund rückt. Abschließend wird die Arbeit mit Verweis auf mögliche Ansatzpunkte zukünftiger Forschungen zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Brand Association Networks
- 2.1 Assoziationen als Bestandteil des Markenwertes
- 2.2 Eigenschaften von Markenassoziationen
- 3 Brand Concept Maps
- 3.1 Methodik
- 3.2 Diskussion und Limitationen
- 3.2.1 Identifikation und Analyse
- 3.2.2 Praxisrelevanz
- 4 Advanced Brand Concept Maps
- 4.1 Erweiterung der BCM-Methodik um eine Bewertung
- 4.2 Brand Association Network Value
- 4.3 Erhöhung des praktischen Nutzens
- 5 Unique Brand Concept Maps
- 5.1 Relevanz der Alleinstellungsmerkmale
- 5.2 Erweiterung der aBCM-Methodik
- 5.2.1 Erhebung von mehreren konkurrierenden Marken
- 5.2.2 Reduzierung um produktkategoriespezifische Assoziationen
- 5.3 Stärkere Gewichtung der Alleinstellungsmerkmale im BANV
- 5.4 Verbleibende Limitationen
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Brand Concept Maps (BCM) als Methode zur Identifizierung und Analyse von Brand Association Networks. Das Hauptziel ist die Entwicklung einer modifizierten BCM, der Unique Brand Concept Map (uBCM), welche die Alleinstellungsmerkmale (USPs) einer Marke herausstellt und somit für die Praxis besser nutzbar macht.
- Brand Association Networks und deren Bedeutung für den Markenwert
- Die Methodik der Brand Concept Maps und deren Limitationen
- Entwicklung und Erweiterung der Advanced Brand Concept Maps (aBCM)
- Entwicklung der Unique Brand Concept Maps (uBCM) zur Fokussierung auf USPs
- Praktische Anwendung und Nutzen der uBCM für das Markenmanagement
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung betont die immense Bedeutung von starken Marken und deren Wert, insbesondere am Beispiel von Apple. Sie führt in die Thematik der Markenassoziationen ein, definiert Marken und deren Rolle in der Kaufentscheidung der Konsumenten und hebt die Wichtigkeit des Verständnisses der Struktur von Markenassoziationen hervor. Die Abgrenzung durch Alleinstellungsmerkmale (USPs) wird als zentrale Aufgabe des Markenmanagements dargestellt. Die Arbeit stellt eine modifizierte Brand Concept Map (BCM) vor, die die Darstellung von USPs zum Ziel hat.
2 Brand Association Networks: Dieses Kapitel beschreibt Assoziationen als Bestandteile eines kognitiven Netzwerks und ordnet sie im Kontext von Marken als Brand Association Networks ein. Es analysiert die Eigenschaften von Markenassoziationen und deren Bedeutung für den Markenwert. Der Fokus liegt auf dem Verständnis, wie Konsumenten Marken wahrnehmen und welche assoziativen Verbindungen sie mit diesen Marken knüpfen. Dies legt die Grundlage für die spätere Anwendung der BCM-Methodik.
3 Brand Concept Maps: Dieses Kapitel präsentiert die Methodik der Brand Concept Maps (BCM) und diskutiert deren Eignung zur Erfassung assoziativer Netzwerke. Es analysiert die Stärken und Schwächen der Methode, wobei die Limitationen im Hinblick auf die Identifikation und die praktische Anwendung der BCM im Detail beleuchtet werden. Diese kritische Betrachtung der bestehenden Methode bildet die Basis für die anschließenden Erweiterungen und Verbesserungen.
4 Advanced Brand Concept Maps: Das vierte Kapitel beschreibt die Erweiterung der BCM-Methodik zur Advanced Brand Concept Map (aBCM). Es erläutert die Integration individueller Bewertungen der Assoziationen und die daraus resultierende Messgröße Brand Association Network Value (BANV). Die Verbesserung des praktischen Nutzens der aBCM im Vergleich zur ursprünglichen BCM wird herausgestellt. Das Kapitel konzentriert sich auf die Stärken der verbesserten Methodik und deren Vorteile für das praktische Markenmanagement.
5 Unique Brand Concept Maps: In diesem Kapitel wird die Unique Brand Concept Map (uBCM) als neue Darstellungsform eingeführt. Sie adaptiert die aBCM, blendet aber kategoriebezogene Assoziationen aus, um die USPs stärker hervorzuheben. Die Relevanz der Alleinstellungsmerkmale wird detailliert diskutiert, ebenso wie die Erweiterung der aBCM-Methodik zur Erhebung mehrerer konkurrierender Marken und die Anpassung der Gewichtung der USPs im BANV. Die verbleibenden Limitationen der uBCM werden ebenfalls angesprochen.
Schlüsselwörter
Brand Concept Maps (BCM), Advanced Brand Concept Maps (aBCM), Unique Brand Concept Maps (uBCM), Brand Association Networks, Markenassoziationen, Markenwert, Alleinstellungsmerkmale (USPs), Unique Selling Proposition (USP), Brand Association Network Value (BANV), Wettbewerbsvorteil, Markenmanagement, Konsumentenverhalten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Entwicklung einer Methode zur Darstellung von Alleinstellungsmerkmalen in Markenassoziationsnetzwerken"
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Verbesserung von Methoden zur Darstellung von Markenassoziationen, insbesondere der Fokussierung auf Alleinstellungsmerkmale (USPs). Es wird eine neue Methode, die Unique Brand Concept Map (uBCM), vorgestellt, die auf den bestehenden Brand Concept Maps (BCM) aufbaut und diese erweitert.
Welche Methoden werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Brand Concept Maps (BCM) und deren Limitationen. Auf dieser Basis werden die Advanced Brand Concept Maps (aBCM) entwickelt, die um eine Bewertung der Assoziationen erweitert sind. Die Hauptmethode ist die neu entwickelte Unique Brand Concept Maps (uBCM), die speziell auf die Darstellung von USPs ausgerichtet ist.
Was sind Brand Association Networks (BAN)?
Brand Association Networks beschreiben die kognitiven Netzwerke von Assoziationen, die Konsumenten mit einer Marke verbinden. Diese Netzwerke sind entscheidend für den Markenwert.
Was ist der Brand Association Network Value (BANV)?
Der BANV ist eine Messgröße, die im Rahmen der aBCM und uBCM entwickelt wurde. Er quantifiziert den Wert des Markenassoziationsnetzwerks, indem er die einzelnen Assoziationen bewertet.
Was sind die Alleinstellungsmerkmale (USPs) und warum sind sie wichtig?
Alleinstellungsmerkmale (USPs) sind einzigartige Eigenschaften einer Marke, die sie von Wettbewerbern abheben. Sie sind essentiell für den Aufbau eines starken Markenprofils und einen Wettbewerbsvorteil.
Wie unterscheidet sich die uBCM von der BCM und aBCM?
Die uBCM baut auf der BCM und aBCM auf, erweitert diese aber um die gezielte Darstellung von USPs. Im Gegensatz zu den Vorgängermethoden filtert die uBCM kategoriebezogene Assoziationen heraus, um die Alleinstellungsmerkmale stärker hervorzuheben.
Welche Vorteile bietet die uBCM für das Markenmanagement?
Die uBCM bietet einen verbesserten Einblick in die USPs einer Marke und ermöglicht es, diese gezielt im Markenmanagement einzusetzen. Sie erleichtert die Identifizierung von Stärken und Schwächen und unterstützt die Entwicklung von Strategien zur Stärkung der Markenpositionierung.
Welche Limitationen der uBCM werden angesprochen?
Die Arbeit diskutiert auch die verbleibenden Limitationen der uBCM, um die Methode kritisch zu reflektieren und weitere Forschungsansätze aufzuzeigen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Brand Association Networks, Brand Concept Maps, Advanced Brand Concept Maps, Unique Brand Concept Maps und eine Zusammenfassung mit Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Methodik und deren Anwendung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Brand Concept Maps (BCM), Advanced Brand Concept Maps (aBCM), Unique Brand Concept Maps (uBCM), Brand Association Networks, Markenassoziationen, Markenwert, Alleinstellungsmerkmale (USPs), Unique Selling Proposition (USP), Brand Association Network Value (BANV), Wettbewerbsvorteil, Markenmanagement, Konsumentenverhalten.
- Quote paper
- Felix Kausmann (Author), 2014, Brand Concept Maps. Identifikation und Analyse von Brand Association Networks, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270440