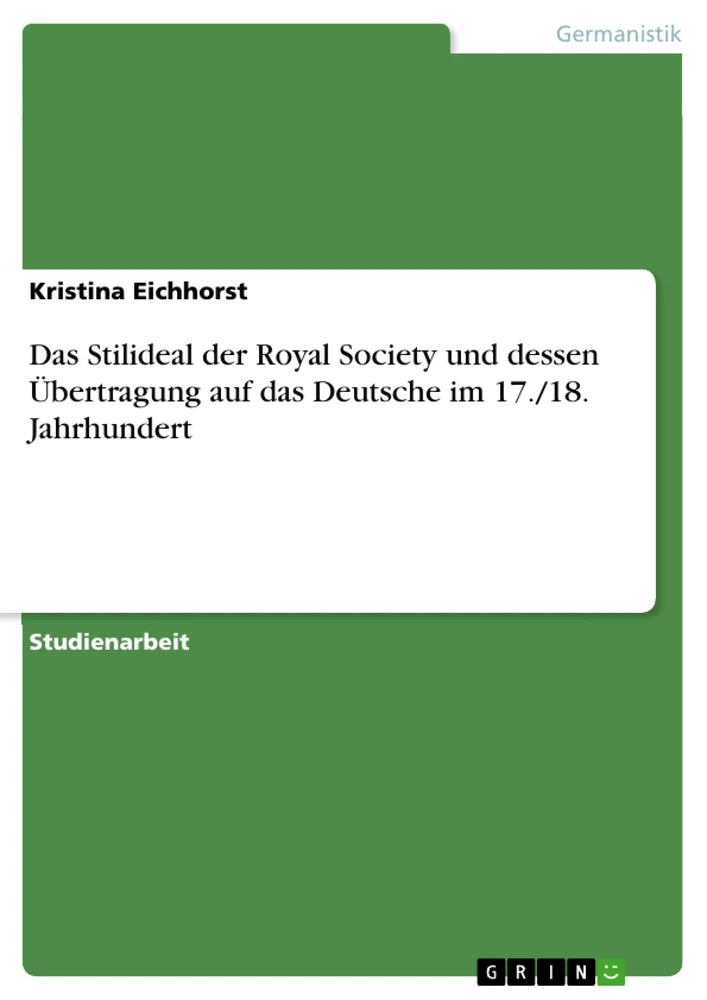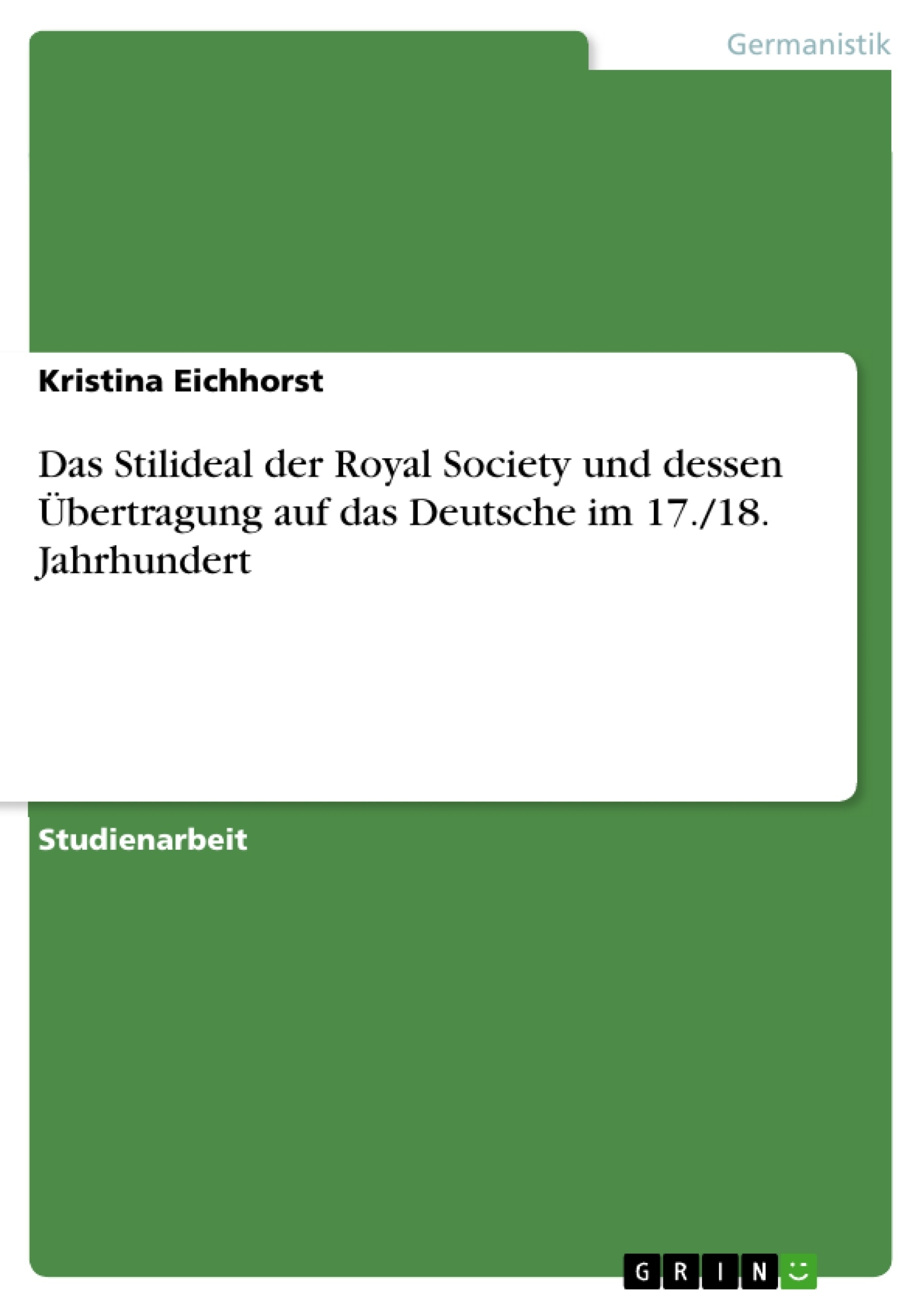Schon immer waren die verschiedenen Bereiche der Wissenschaft eine Gelegenheit für Zusammenschlüsse von Interessierten, Laien und Experten. Ein solcher Zusammenschluss von Wissenschaftlern ereignete sich auch im London der 1640er Jahre. Hier versammelten sich Philosophen und andere Wissenschaftler im Rahmen eines "invisible college", um neue Wege der Wissensvermittlung zu diskutieren. Als sich die Gemeinschaft 1660 offiziell gründete, basierten ihre Ideen noch immer auf den Prinzipien von Beobachtung und Experimenten. 1661 erhielt der Kreis dann den Namen "The Royal Society of London For Improving Natural Knowledge". Seit jeher interessieren sich ihre Mitglieder für sämtliche Bereiche der Naturwissenschaften und der Mathematik, der Wissenschaftsgeschichte und Technik, vergeben Preise in diesen Bereichen und veröffentlichen wissenschaftliche Abhandlungen und Forschungsergebnisse. In ihren frühen Jahren befasste sich die Society auch mit der Art und Weise, wie Forschungsergebnisse und Wissen an die Menschen weitergegeben werden sollten. Die Mitglieder konzipierten sprachliche Stilideale, die zu einem Maßstab für alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden sollten.
Diese Arbeit befasst sich mit den Stilidealen der Royal Society, wie sie im 17. Jahrhundert gefordert wurden und deren Übertragung auf das Deutsche. Dies soll anhand der deutschen moralischen Wochenschriften, besonders des Vernünfftlers, gezeigt werden. Dazu werden der geschichtliche Hintergrund Englands zur Gründungszeit der Society sowie die Vordenker dieser Ideen (Bacon, Hobbes) eine Rolle spielen. Anschließend werden die Ideen der Royal Society genauer untersucht. Es geht hierbei um Universalsprachen und den neuen Wissenschaftsstil. Im Anschluss daran wird die Übertragung des englischen Stilvorbildes ins Deutsche behandelt. Dies beginnt mit einem kurzen Abriss über die linguistische Situation in Deutschland um 1700. Da die moralischen Sittenschriften hier eine entscheidende Rolle spielten, wird dieses Phänomen genauer betrachtet. Den letzten Punkt bildet der konkrete Vergleich zwischen Wochenschriften in England und deren Stilübertragung auf die deutschen. Die Schlussbemerkungen beinhalten ein kurzes Fazit sowie einen Ausblick auf weitere, hier nicht behandelte Schwerpunkte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der geschichtliche Hintergrund: England und die Wissenschaft um 1700
- Einleitung
- Der neue Wissenschaftsstil der Royal Society
- Bacon und Hobbes über Sprache
- Universalsprachen
- Plain style und Antirhetorik
- Auswirkungen des englischen Stilideals auf deutsche Wochenschriften
- Die deutsche Sprache um 1700
- Die moralischen Wochenschriften in Deutschland ab 1700
- Sprache in den Wochenschriften am Beispiel von Der Vernünfftler
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Stilideale der Royal Society im 17. Jahrhundert und deren Übertragung auf das Deutsche anhand der deutschen moralischen Wochenschriften, insbesondere Der Vernünfftler. Die Arbeit beleuchtet den geschichtlichen Hintergrund Englands zur Gründungszeit der Society sowie die Vordenker dieser Ideen (Bacon, Hobbes), analysiert die Ideen der Royal Society hinsichtlich Universalsprachen und des neuen Wissenschaftsstils und betrachtet schließlich die Übertragung des englischen Stilvorbildes ins Deutsche.
- Die Gründung der Royal Society im Kontext des englischen Wissenschafts- und Sprachwandels
- Die Stilideale der Royal Society und deren Einfluss auf wissenschaftliche Publikationen
- Die Rolle der deutschen moralischen Wochenschriften in der Verbreitung des englischen Wissenschaftsstils
- Die Übertragung des englischen Stilvorbildes ins Deutsche und die sprachliche Situation in Deutschland um 1700
- Der Vergleich zwischen Wochenschriften in England und deren Stilübertragung auf die deutschen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet den geschichtlichen Hintergrund Englands um 1700, wobei die politischen und kulturellen Bedingungen, die zur Gründung der Royal Society führten, untersucht werden. Kapitel 3 widmet sich den Stilidealen der Royal Society, analysiert die Ideen von Francis Bacon und Thomas Hobbes und erforscht die Konzepte von Universalsprachen und dem neuen Wissenschaftsstil. Kapitel 4 untersucht die Auswirkungen des englischen Stilideals auf deutsche Wochenschriften, beleuchtet die sprachliche Situation in Deutschland um 1700 und untersucht die Rolle der moralischen Wochenschriften in diesem Kontext.
Schlüsselwörter
Royal Society, Wissenschaftsstil, Sprache, Universalsprachen, Antirhetorik, Plain style, deutsche Wochenschriften, moralische Sittenschriften, Der Vernünfftler, England, Geschichte, Wissenschaft, Sprachwandel, Stilgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Stilideal der Royal Society im 17. Jahrhundert?
Die Royal Society forderte einen „Plain Style“ – eine klare, sachliche und schnörkellose Sprache, die sich gegen rhetorische Ausschmückungen wandte, um Wissen effizient zu vermitteln.
Welchen Einfluss hatten Bacon und Hobbes auf dieses Stilideal?
Francis Bacon und Thomas Hobbes gelten als Vordenker, die die Bedeutung einer präzisen Sprache für die Wissenschaft betonten und damit die Grundlagen für die Konzepte der Royal Society legten.
Wie gelangte das englische Stilideal in den deutschen Sprachraum?
Die Übertragung erfolgte maßgeblich durch moralische Wochenschriften wie „Der Vernünfftler“, die sich am englischen Vorbild orientierten und so den deutschen Wissenschaftsstil beeinflussten.
Was versteht man unter „Antirhetorik“ im Kontext der Royal Society?
Unter Antirhetorik versteht man die bewusste Abkehr von poetischen und metaphorischen Sprachmitteln zugunsten einer rein deskriptiven und empirisch fundierten Ausdrucksweise.
Wie war die sprachliche Situation in Deutschland um 1700?
Die deutsche Sprache befand sich in einem Wandlungsprozess; die Arbeit beleuchtet, wie die moralischen Sittenschriften zur Modernisierung und Standardisierung der Sprache beitrugen.
- Quote paper
- Kristina Eichhorst (Author), 2013, Das Stilideal der Royal Society und dessen Übertragung auf das Deutsche im 17./18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271281