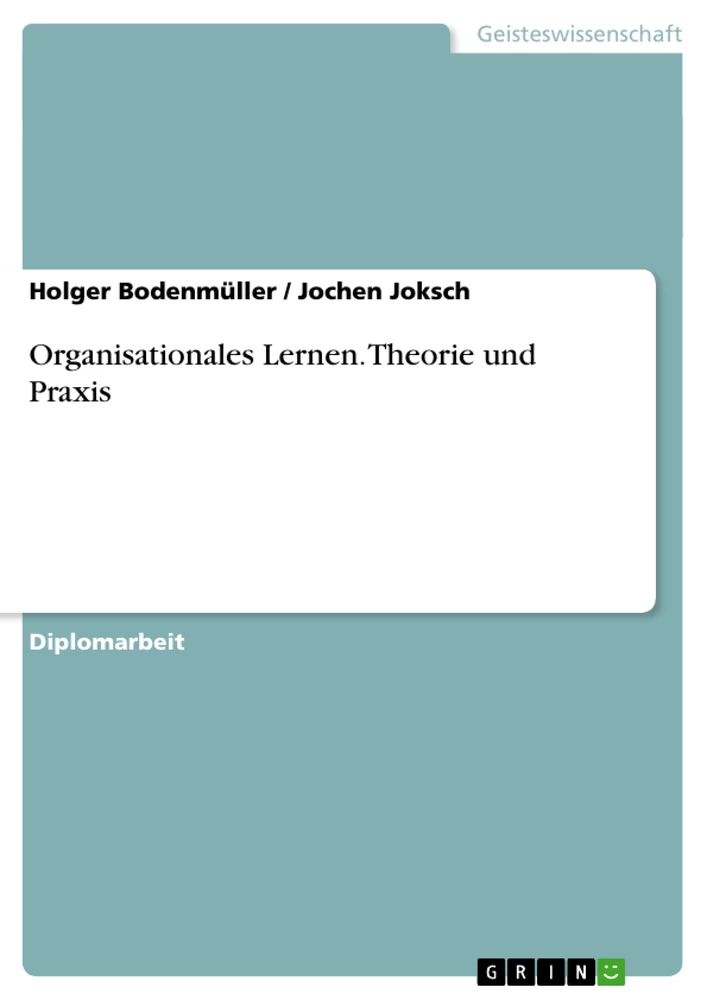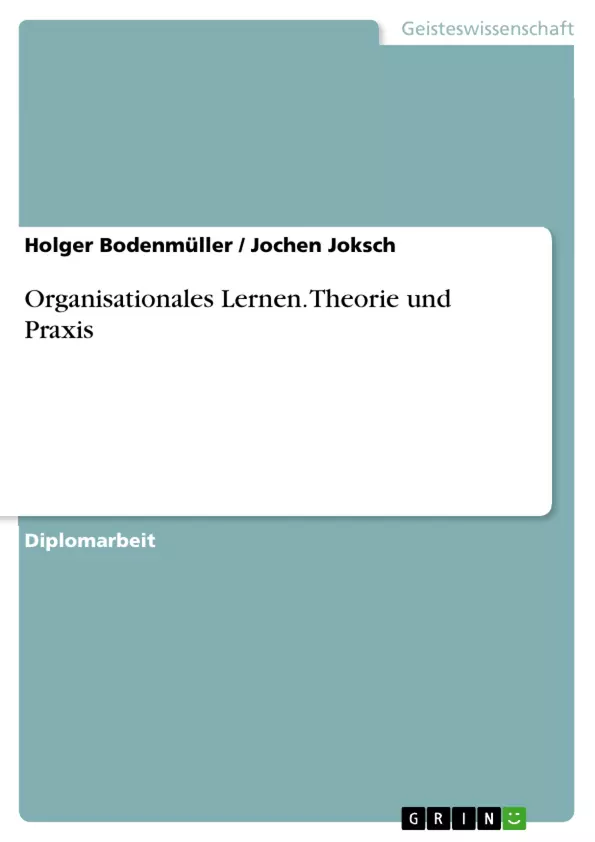Diese Arbeit hat zum Ziel, die Idee des organisationalen Lernens in die Praxis zu tragen. Verschiedene Perspektiven des organisationalen Lernens wurden nach Implikationen für die Praxis untersucht und in einem integrativen Modell zusammengeführt. Aus den verschiedenen Perspektiven wurden Facetten einer lernförderlichen Kultur herausgearbeitet. Auf der Basis des auf diese Weise entstanden integrativen Modells des organisationalen Lernens entstanden Instrumente der Datenerhebung, welche eine Evaluation der Lernförderlichkeit einer Unternehmenskultur gewährleisten sollten. Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde intensiv mit einem großen süddeutschen Unternehmen zusammengearbeitet. Kriterien der Lernförderlichkeit wurden mit Effizienzparametern der organisationalen Praxis verglichen.
Die Untersuchung zeigte, daß die durch das Modell postulierten Kriterien der Lernförderlichkeit der Unternehmenskultur eng mit der „organisationalen Realität“ des untersuchten Unternehmens zusammenhingen. Desweiteren ließen sich Anregungen für potentielle Verbesserungen der Lernförderlichkeit ableiten. Die vorliegende Arbeit markiert einen weiteren Schritt in der Beantwortung der Fragen:
Was ist eine lernende Organisation?
Wie kann man die Lernförderlichkeit einer Unternehmenskultur bewerten?
Welche Implikationen ergeben sich aus der Idee des organisationalen Lernens für die Praxis?
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- ZUSAMMENFASSUNG
- 1. EINLEITUNG
- 1.1. Einführung: „Ein Ding das da heißt lernende Organisation gibt es nichtl"
- 1.2. Hintergrund und Ziele der Arbeit
- 1.3. Gegenstandsbestimmung: Was ist eine „Organisation", was bedeutet „lernen"?
- 1.3.1. Lernen aus der Sicht Jean Piagets
- 1.3.2. Die soziale Lerntheorie nach Bandura
- 1.4. Eine Lernende Organisation, was ist das?
- 2. PERSPEKTIVEN UND ANSÄTZE DES ORGANISATIONALEN LERNENS
- 2.1. Die informations- und wahrnehmungsorientierte Perspektive
- 2.1.1. Wie definieren die Autoren organisationales Lernen?
- 2.1.2. Wie wird gelernt?
- 2.1.2.1. Information acquisition
- 2.1.2.2. Information distribution
- 2.1.2.3. Information interpretation
- 2.1.2.4. Organizational memory
- 2.1.3. Implikationen einer informations- und wahrnehmungsorientierte Perspektive für die Praxis
- 2.2. Anpassungsorientierte Perspektive
- 2.2.1. Was bedeutet „organisationales Lernen"?
- 2.2.1.1. Rationale Uberlegungen
- 2.2.1.2. Lernen aus der Vergangenheit
- 2.2.2. Was wird gelernt?
- 2.2.3. Wie und wann wird gelernt? - Der „Cycle of Choice"
- 2.2.4. Wer lernt?
- 2.2.5. Implikationen einer anpassungsorientierten Perspektive für die Praxis
- 2.2.1. Was bedeutet „organisationales Lernen"?
- 2.3. Die politische Perspektive
- 2.3.1. Der Akteur und das System
- 2.3.2. Quellen der Macht
- 2.3.3. Die Perspektive des Akteurs: mikropolitische Taktiken
- 2.3.4. Die Perspektive der Koalitionen: Gemeinsam sind wir stark!
- 2.3.5. Die Perspektive der Systems: Die Organisation als Summe der Spiele
- 2.3.6. Uberlegungen zum Wandel
- 2.3.7. Wandel als Bruch
- 2.3.8. Wandel als Neustrukturierung von Machtbeziehungen
- 2.3.9. Die Steuerbarkeit von Wandlungsprozessen
- 2.3.10. Implikationen einer politischen Perspektive für die Praxis
- 2.4. Die wissensorientierte Perspektive des organisationalen Lernens
- 2.4.1. Wissen und Lernen im Rahmen der wissensorientierten Perspektive
- 2.4.2. Auslöser für Lernen I Faktoren, welche die Akzeptanz von Wissen beeinflussen
- 2.4.3. Der Lernprozeß: wie wird gelernt?
- 2.4.4. Wer lernt? Unterschiede zwischen individuellem und organisationalem Lernen
- 2.4.4.1. Entwicklungslogik, -dynamik, fortschrittsfähige Organisation
- 2.4.4.2. Wissen und Lernen in der Evolutionsperspektive des Lernens
- 2.4.4.3. Auslöser organisatorischer Lernprozesse
- 2.4.5. Wissensmanagement: Der Weg in die Wissengesellschaft
- 2.4.6. Die Wissensperspektive des organisationalen Lernens: Implikationen für die Praxis
- 2.5. Die kulturelle Perspektive des organisationalen Lernens
- 2.5.1. Organisationales Lernen als Veränderung organisationaler Handlungstheorien: der Ansatz von Argyris & Schön
- 2.5.1.1. Theorien des Handelns: das handlungstheoretische Grundgerüst und das Verständnis von individuellem und organisationalem Lemen
- 2.5.1.2. Verschiedene Lernniveaus in der Konzeption von Argyris & Schön
- 2.5.1.3. Aber wenn einem die Natur kommt: Model I vs. Model 11 theory-in-use
- 2.5.1.4. Das Verhältnis von individueller und organisationaler Gebrauchstheorie —individuelles vs. organisationales Lernen-
- 2.5.2. Kollektiv geteilte Abwehrmuster: Abwehrverhalten, die das Lernen erschweren
- 2.5.2.1 .Organisationales Abwehrverhalten -organizational defensive routines-
- 2.5.2.2. Ich sehe nicht... Ich höre nicht... Ich spreche nicht... Ich wars nicht!
- 2.5.2.3. Fehler, die keine Fehler sind: skilled incompetence
- 2.5.3. Rahmenbedingungen des Lernens: die Rolle der Führung
- 2.5.4. Weshalb ist Unternehmenskultur so wichtig?
- 2.5.5. Definition, Ebenen und Faktoren der Unternehmenskultur nach Schein
- 2.5.6. Steuerung der Kultur: Die Rolle der Führung: organisationales Lernen als Entwicklung der Organisationskultur
- 2.5.7. Die Entschlüsselung der Kultur: die „klinische" Vorgehensweise
- 2.5.8. Die lernende Kultur: eine Paradoxie?
- 2.5.9. Die kulturelle Perspektive des organisationalen Lernens: Implikationen für die Praxis
- 2.5.1. Organisationales Lernen als Veränderung organisationaler Handlungstheorien: der Ansatz von Argyris & Schön
- 2.6. Die systemisch-kybernetische Perspektive des organisationalen Lernens
- 2.6.1. Die fünf Disziplinen zum Aufbau einer lernenden Organisation
- 2.6.1.1. Personal Mastery
- 2.6.1.2. Mentale Modelle
- 2.6.1.3. Gemeinsame Vision
- 2.6.1.4. Team Lernen
- 2.6.1.5. Systemdenken
- 2.6.2. Reflexion
- 2.6.3. Die Steuerung komplexer Systeme: Autonomie, Selbstorganisation und Kontextsteuerung
- 2.6.4. Implikationen einer systemischen Sichtweise für eine Definition organisationalen Lernens
- 2.6.4.1. Definitionsversuch
- 2.6.4.2. Modi und Auslöser organisationalen Lernens
- 2.6.4.3. Das Verhältnis von individuellem Lernen zu organisationalem Lernen
- 2.6.5. Implikationen einer systemtheoretisch-kybernetischen Perspektive des organisationalen Lernes für die Praxis
- 2.6.6. Eine systemtheoretisch-konstruktivistische Perspektive der Realität: Implikationen für Methodologie und Methoden in der Organsationsforschung
- 2.6.1. Die fünf Disziplinen zum Aufbau einer lernenden Organisation
- 2.7. Ein integratives Modell des organisationalen Lernens
- 2.7.1. Die kognitive Struktur einer Organisation
- 2.7.1.1. Informationsaufnahme
- 2.7.1.2. Informationsverteilung
- 2.7.1.3. Informationsinterpretation
- 2.7.1.4. Informationsgedächtnis
- 2.7.1. Die kognitive Struktur einer Organisation
- 2.8. Metadimensionen einer lernenden Organisation: Reflexion, Transparenz und Partizipation
- 2.8.1. Reflexion
- 2.8.2. Transparenz
- 2.8.2.1. Informationsaufnahme und Transparenz
- 2.8.2.2. Informationsverteilung, —interpretation und Transparenz
- 2.8.2.3. Informationsgedächtnis und Transparenz
- 2.8.2.4. Ansatzpunkte für Diagnostik und Intervention
- 2.8.3. Partizipation
- 2.8.3.1. Was ist der Mensch?
- 2.8.3.2. Was ist der Zweck deiner Organisation?
- 2.8.3.3. Machtverteilung und Kompetenz als notwendige Voraussetzungen
- 2.8.3.4. Exkurs zur Forderung nach humaner Arbeit
- 2.8.3.5. Partizipation in Veränderungsprozessen
- 2.8.3.6. Zur Aufrichtigkeit von Partizipationsversuchen
- 2.8.3.7. Ansatzpunkte für Diagnostik und Intervention
- 2.8.4. Flexibilisierung und Proaktivität
- 2.8.4.1. Ansatzpunkte für Diagnostik und Intervention
- 3. FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESEN
- 3.1. Ausmaß organisationaler Lernfähigkeit
- 3.2. Effizienzmerkmale
- 3.3. Weitere Fragestellungen
- 4. STANDORTBESTIMMUNG: METHODOLOGISCHE GESICHTSPUNKTE
- 4.1. Das quantitative und das qualitative (Forschungs-)Paradigma
- 4.2. Der Forschungsgegenstand — die organisationale Realität
- 4.3. Gängige Methoden der OL-Forschung
- 4.4. Über Methodologie-Einfältigkeit und Vielfältigkeit
- 5. METHODEN
- 5.1. Das Unternehmen X
- 5.2. Das problemzentrierte Interview
- 5.2.1. Phasen des problemzentrierten Interviews
- 5.2.1.1. Problemanalyse
- 5.2.1.2. Leitfadenkonstruktion
- 5.2.1.3. Pilotphase
- 5.2.1.4. Interviewdurchführung
- 5.2.1.5. Auswertung
- 5.2.2. Stichprobe im Interview
- 5.2.3. Unregelmäßigkeiten und Besonderheiten in den Interviews
- 5.2.1. Phasen des problemzentrierten Interviews
- 5.3. Fragebogen
- 5.3.1. Warum einen Fragebogen einsetzen?
- 5.3.2. Aufbau und inhaltliche Schwerpunkte
- 5.3.2.1. Fragenformulierung und Skalierung
- 5.3.2.2. Auf dem Weg zur Endversion: Stufen der Entwicklung
- 5.3.2.3. Verfälschungen: soziale Erwünschtheit und die Regression zur Mitte
- 5.3.3. Einsatz und Auswertung des Fragebogens
- 5.3.3.1 .Verteilung und Instruktion
- 5.3.3.2. Auswertung
- 5.4. Beobachtung und Dokumentenanalyse
- 6. ERGEBNISSE
- 6.1. Problemzentriertes Interview
- 6.1.1. Informationsaufnahme
- 6.1.2. Informationsverteilung
- 6.1.3. Informationsinterpretation
- 6.1.4. Informationsgedächtnis
- 6.1.5. Weitere Ergebnisse
- 6.2. Fragebogen
- 6.2.1. Regressionseffekte
- 6.2.2. Homogenität der Metakonstrukte Reflexion, Transparenz und Partizipation
- 6.1. Problemzentriertes Interview
- 7. DISKUSSION
- 7.1. Ein zweiter Blick auf die Ergebnisse des Interviews
- 7.2. Ein zweiter Blick auf die Ergebnisse des Fragebogens
- 7.2.1. Ausprägungen der Variablen des Fragebogens
- 7.2.2. Homogenität der Metakonstrukte Reflexion, Transparenz und Partizipation
- 7.3. Schluß auf die Lernkultur
- 7.3.1. Informationaufnahme
- 7.3.2. Informationsverteilung
- 7.3.3. Informationsinterpretation
- 7.3.4. Informationsgedächtnis
- 7.4. OL und organisationale Effizienz
- 7.4.1. Transparenz
- 7.4.2. Reflexion
- 7.4.3. Partizipation
- 7.4.4. Zusammenhänge mit der organisationalen Effizienz
- 7.5. Rückschluß auf das Modell
- 7.5.1. Die Integration
- 7.5.2. Das Modell
- 7.6. Ein Ding das da heißt lernende Organisation gibt es doch?
- 8. ANHANG
- 8.1. Interviewleitfaden
- 8.2. Anhang Fragebogen
- 8.3. Zuteilung der Befragten in die einzelnen Kategorien
- 9. LITERATUR
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Thema des organisationalen Lernens (OL) und verfolgt das Ziel, die Idee des OL in die Praxis zu tragen. Sie analysiert verschiedene Perspektiven des OL hinsichtlich ihrer Implikationen für die Praxis und integriert diese in ein umfassendes Modell. Die Arbeit untersucht Facetten einer lernförderlichen Kultur und entwickelt auf Basis des Modells Instrumente zur Datenerhebung, die eine Evaluation der Lernförderlichkeit einer Unternehmenskultur ermöglichen. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen Lernförderlichkeit und der „organisationalen Realität" eines süddeutschen Großunternehmens und leitet daraus Anregungen für potentielle Verbesserungen der Lernförderlichkeit ab.
- Integrative Darstellung verschiedener Perspektiven des organisationalen Lernens
- Entwicklung eines Modells zur Beschreibung einer lernförderlichen Kultur
- Erstellung eines Instrumentariums zur Evaluation der Lernkultur
- Empirische Untersuchung der Lernförderlichkeit in einem Unternehmen
- Ableitung von Optimierungs- und Gestaltungsvorschlägen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Begriff des organisationalen Lernens einführt und die Ziele der Arbeit erläutert. Anschließend werden verschiedene Perspektiven des organisationalen Lernens vorgestellt, darunter die Informations- und Wahrnehmungsperspektive, die anpassungsorientierte Perspektive, die politische Perspektive, die wissensorientierte Perspektive, die kulturelle Perspektive und die systemisch-kybernetische Perspektive. Jede Perspektive wird anhand von zentralen Autoren und ihren wichtigsten Konzepten erläutert, wobei die Implikationen für die Praxis besonders hervorgehoben werden. Die Arbeit gipfelt in der Entwicklung eines integrativen Modells des organisationalen Lernens, das die wichtigsten Erkenntnisse aus den verschiedenen Perspektiven zusammenführt. Dieses Modell dient als Grundlage für die Entwicklung eines Instrumentariums zur Evaluation der Lernkultur, das in einem süddeutschen Großunternehmen eingesetzt wird.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, daß die Lernkultur des Unternehmens zwar einige positive Aspekte aufweist, aber auch zahlreiche Defizite. Die Mitarbeiter schätzen zwar die Wichtigkeit von Transparenz, Partizipation und Reflexion, doch die Praxis zeigt, daß diese Aspekte nicht immer konsequent umgesetzt werden. So mangelt es beispielsweise an einem systematischen Informationsaustausch zwischen den Abteilungen, es besteht ein ausgeprägtes Bereichsdenken, und die Mitarbeiter werden nicht immer in wichtige Entscheidungsprozesse einbezogen. Die Arbeit liefert konkrete Optimierungsvorschläge, die dazu beitragen können, die Lernkultur des Unternehmens zu verbessern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen organisationales Lernen, Lernkultur, Unternehmenskultur, Integration, Modellbildung, Datenerhebung, Evaluation, Lernförderlichkeit, Effizienz, Transparenz, Partizipation, Reflexion, Politik, Macht, Wandel, Wissen, Wissensmanagement, Systemtheorie, Kybernetik, Aktionsforschung, Methodenpluralismus, Unternehmenspraxis, Praxisrelevanz, Fallstudie, Interview, Fragebogen, Beobachtung.
- 2.1. Die informations- und wahrnehmungsorientierte Perspektive
- Citar trabajo
- Holger Bodenmüller (Autor), Jochen Joksch (Autor), 1999, Organisationales Lernen. Theorie und Praxis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271654