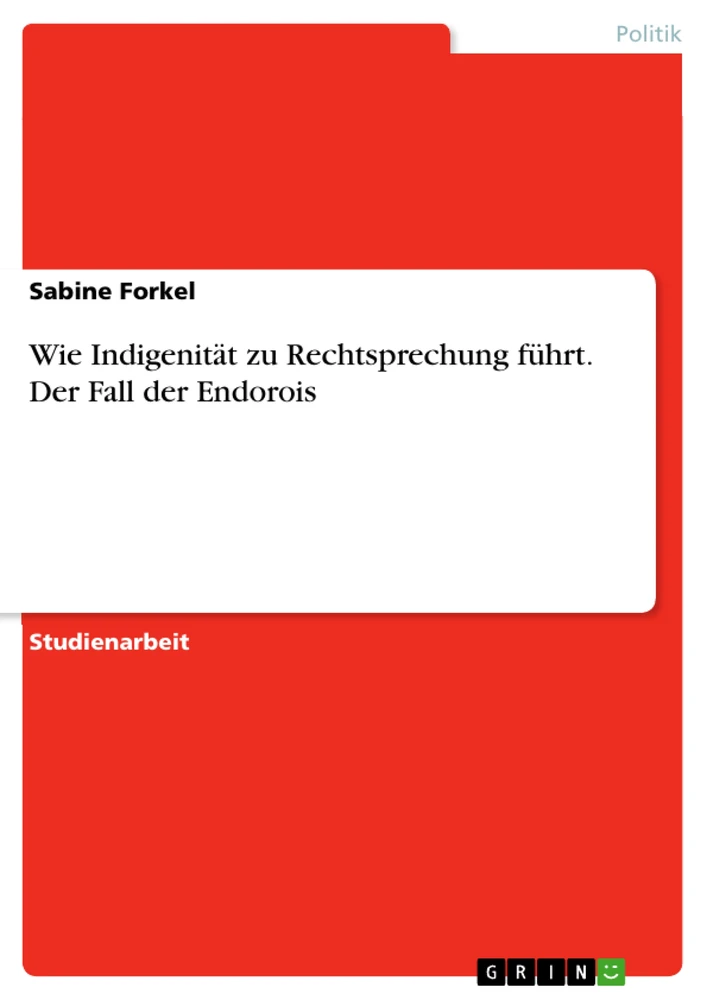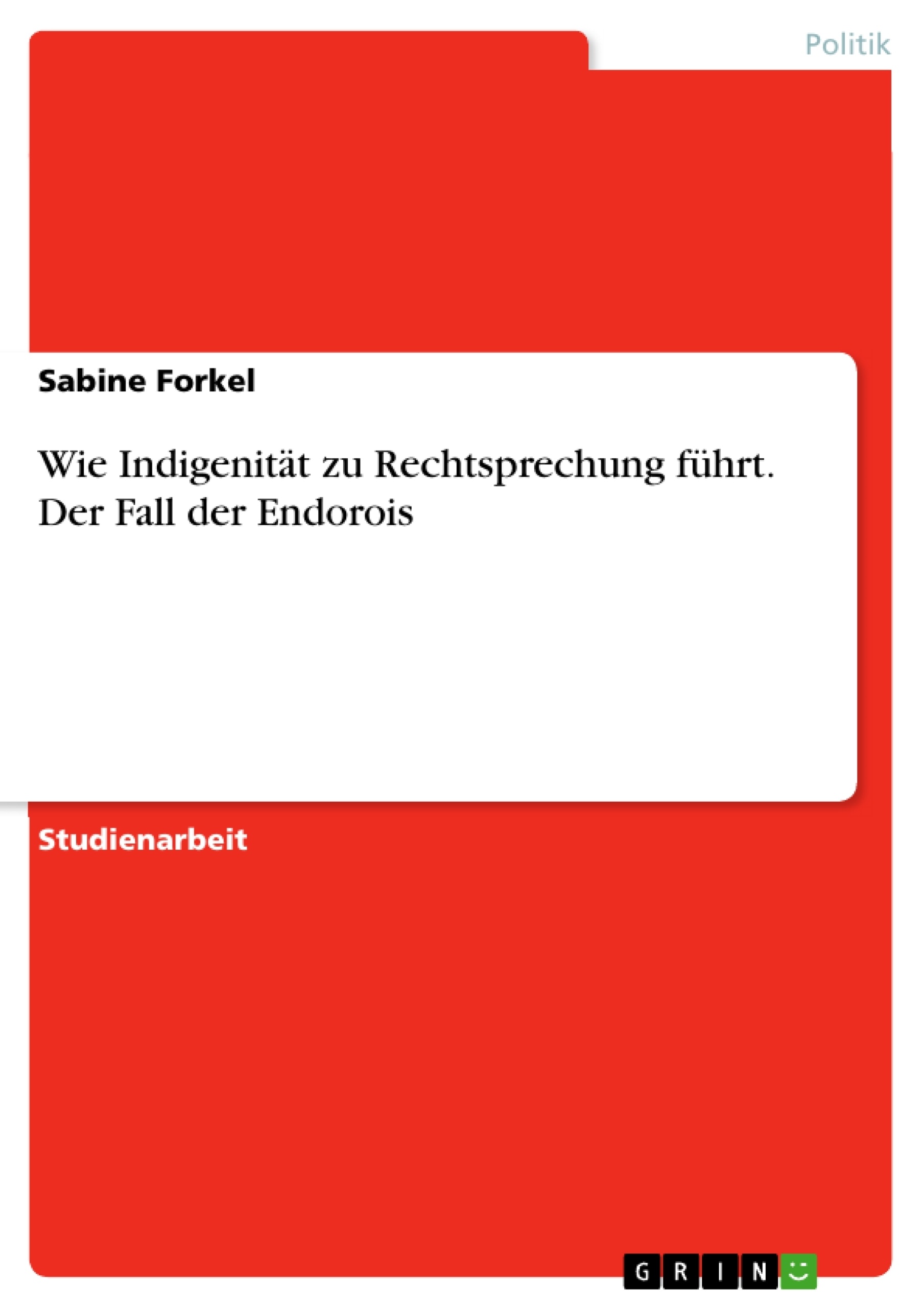Jahrhundertelang unterlagen weltweit unzählige indigene Völker den Folgen von Fremdherrschaft, Unterdrückung, Missbilligung und Diskriminierung. Ihre Bedürfnisse und Anliegen wurden oft einfach ignoriert und den Interessen der Machthaber unter-stellt. Erst Ende des 20. Jahrhunderts fand die Frage nach dem Umgang mit indigenen Völkern internationale Bedeutung. Die UN deklarierte den Zeitraum von 1994 bis 2004 als die erste „World Decade on the Rights of Indigenous Peoples“ (Gilbert 2007: 207).
Ziel war es in dieser Zeitspanne, eine internationale Zusammenarbeit als Vorausset-zung für die Auseinandersetzung mit der Frage zu schaffen, wie indigene Völker hinsichtlich der Menschenrechtsdebatten behandelt werden sollten. 2002 wurde dem UN Wirtschafts- und Sozialrat zu diesem Zwecke das Ständige Forum über indigene Angelegenheiten als beratendes Gremium beigestellt (ebd.). Darüber hinaus wurde 2007 ein Expertenmechanismus über die Rechte indigener Völker gegründet, um dem UN-Menschenrechtsrat thematisches Fachwissen über indigene Angelegenheiten zur Verfügung zu stellen. Seit 2001 wird desweiteren ein UN-Sonderberichterstatter zur Lage der Menschenrechte und Grundlegenden Freiheiten indigener Völker eingesetzt. Der Zeitraum von 2005 bis 2015 wird als zweite Dekade der Rechte Indigener Völker bezeichnet, welche die Teilhabe der Indigenen an Entscheidungsprozessen, die Bekämpfung von Diskriminierung und die Entwicklung von Programmen, Projekten und Kontrollmechanismen als Hauptziele nennt.
Weltweit gibt es ca. 5000 Völker, die als „Indigene“ oder „Ureinwohner“ definiert werden. Das sind etwa 300 bis 400 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen leben in Indien und Amerika. Oft stellen indigene Völker in der Bevölkerung ihres Landes eine Minderheit dar, deren Lebensweise sich stark von der der Mehrheit unterscheidet. Konflikte entstehen oft, wenn indigenen Völkern das von ihnen bewohnte und genutzte Land streitig gemacht wird. (...)
Entscheidend ist dementsprechend vor allem die Definition indigener Völker. Auf diese gehe ich im zweiten Kapitel ein. Anschließend komme ich auf die Rechte indi-gener Völker in internationalen Verträgen zu sprechen, bevor das vierte Kapitel den Fall der Endorois schildert und auf die Rechtsverletzungen, die Auswirkungen des Staatseingriffes, die Anklage und die Entscheidung der Afrikanischen Kommission eingeht. Im Kapitel fünf wird die Bedeutung der Indigenität für die positive Rechtsprechung erarbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition indigener Völker
- Rechte indigener Völker
- Der Fall der Endorois
- Der Eingriff des Staates
- Auswirkungen der Landnahme
- Wirtschaftliche und gesundheitliche Auswirkungen
- Religiöse und kulturelle Auswirkungen
- Die Klage vor der ACHPR
- Die Entscheidung der ACHPR
- Artikel 8 - Das Recht auf freie Religionsausübung
- Artikel 14 - Das Recht auf Besitz
- Artikel 17 - Das Recht auf Kultur
- Artikel 21 - Das Recht auf freien Zugang zu natürlichen Ressourcen
- Artikel 22 - Das Recht auf Entwicklung
- Die Bedeutung der Indigenität im Fall der Endorois
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage der Einklagbarkeit von Menschenrechten am Beispiel des Menschenrechts auf Nahrung im Fall der Endorois. Die Arbeit analysiert die rechtliche Situation indigener Völker und zeigt auf, wie Indigenität zu Rechtsprechung führen kann. Sie beleuchtet die historische und politische Situation der Endorois und die Auswirkungen der Landnahme auf ihr Leben. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit der Entscheidung der Afrikanischen Kommission für Menschenrechte und Völkerrechte (ACHPR) im Fall der Endorois.
- Die Definition indigener Völker
- Die Rechte indigener Völker im internationalen Recht
- Der Fall der Endorois und die Auswirkungen der Landnahme
- Die Entscheidung der ACHPR im Fall der Endorois
- Die Bedeutung der Indigenität für die Rechtsprechung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die historische und aktuelle Situation indigener Völker weltweit. Es wird die Bedeutung der Indigenität für die Menschenrechtsdebatte hervorgehoben und die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Indigenenrechte dargestellt. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition indigener Völker und den unterschiedlichen Ansätzen zur Definition. Es werden die vier Hauptkriterien der UN Arbeitsdefinition erläutert und die Problematik der Definition indigener Völker in Afrika beleuchtet. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Rechten indigener Völker im internationalen Recht. Das vierte Kapitel analysiert den Fall der Endorois. Es werden die Auswirkungen der Landnahme auf die Endorois dargestellt und die Entscheidung der ACHPR im Detail erläutert. Der Fokus liegt dabei auf den relevanten Artikeln der Afrikanischen Menschenrechtscharta, die in der Entscheidung der ACHPR zitiert wurden.
Schlüsselwörter
Indigene Völker, Menschenrechte, Recht auf Nahrung, Endorois, Afrikanische Kommission für Menschenrechte und Völkerrechte (ACHPR), Indigenität, Kollektivrechte, Landnahme, Kultur, Selbstbestimmung.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die Endorois?
Die Endorois sind ein indigenes Volk in Kenia, das in den 1970er Jahren gewaltsam von seinem angestammten Land am Lake Bogoria vertrieben wurde, um Platz für ein Naturschutzgebiet zu schaffen.
Was entschied die Afrikanische Kommission (ACHPR) im Fall der Endorois?
Die Kommission entschied 2010 zugunsten der Endorois. Sie stellte fest, dass Kenia deren Rechte auf Besitz, Religionsausübung, Kultur und Entwicklung verletzt hat.
Warum ist Landbesitz für indigene Völker so wichtig?
Land ist für Indigene nicht nur eine wirtschaftliche Basis, sondern untrennbar mit ihrer kulturellen Identität, ihren religiösen Stätten und ihrer traditionellen Lebensweise verbunden.
Was bedeutet "Indigenität" im rechtlichen Sinne?
Es bezieht sich auf Völker, die eine historische Kontinuität zu vor-kolonialen Gesellschaften aufweisen und sich selbst als eigenständig gegenüber der Mehrheitsgesellschaft definieren.
Welche Auswirkungen hatte die Landnahme auf die Endorois?
Sie verloren den Zugang zu Weideland und heiligen Stätten, was zu wirtschaftlicher Verarmung, gesundheitlichen Problemen und dem Verlust ihrer religiösen Traditionen führte.
- Quote paper
- Sabine Forkel (Author), 2012, Wie Indigenität zu Rechtsprechung führt. Der Fall der Endorois, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271937