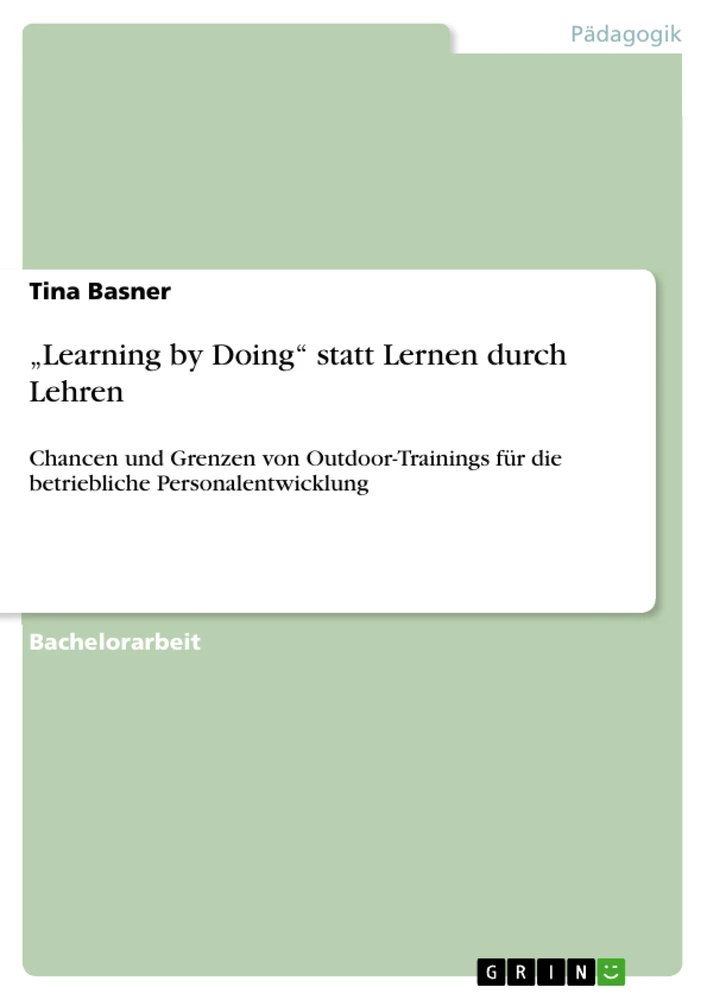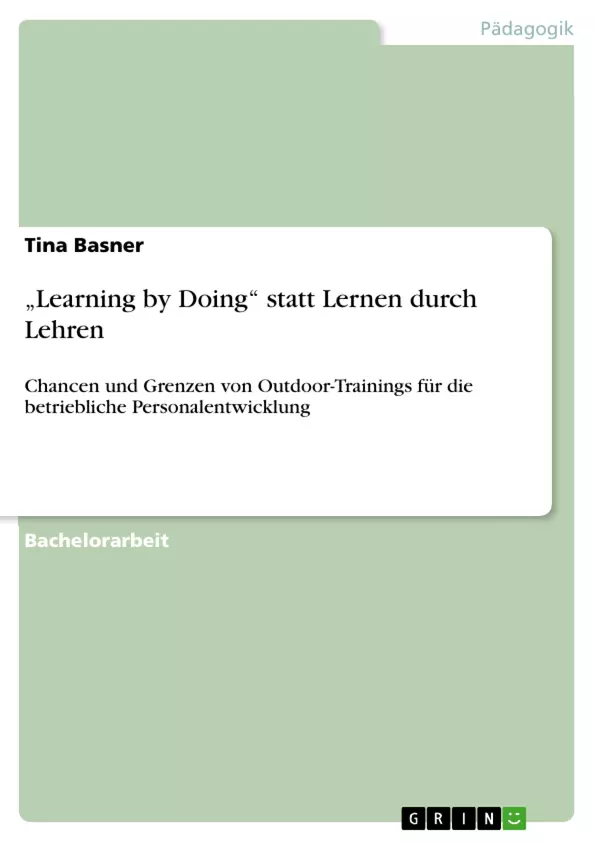Gibt man den Begriff „Outdoor-Training“ bei der Suchmaschine „Google“ ein, hat man die Qual der Wahl: 92 Millionen Treffer stehen zur Verfügung. „Angela Merkel“ erreicht dazu im Vergleich gerade mal ein Drittel dieses Ergebnisses (34 Millionen Treffer, Stand: Juli 2013). Es erweckt den Eindruck als wäre Outdoor-Training (OT) ein Thema von Relevanz und Aktualität. Doch was hat es mit diesem mysteriösen Begriff auf sich, dessen Suchergebnisquote sich allein in den vergangenen sechs Jahren verhundertfacht hat?
[...]
Ich bin der Meinung, soziale Kompetenzen können nur durch „Learning by Doing“, also eigenes Handeln und Erleben effektiv weiterentwickelt werden. Genau das ist der Punkt, an dem OT ansetzt: Auch Personalentwickler haben darin in den letzten Jahren eine geeignete Methode entdeckt, um Prozesse der Kompetenzentwicklung auf der Persönlichkeits-, wie der Teamebene effektiv zu unterstützen.
[...]
Vor dem Hintergrund meines beruflichen Interesses möchte ich das Hauptaugenmerk dieser Arbeit auf erlebnispädagogische Programme im Betriebskontext, kurz: Outdoor-Trainings, legen. Ziel soll es sein, Chancen, Grenzen und Wirkungsweisen von OTs für die betriebliche Personalentwicklung (PE) herauszuarbeiten, um somit Ihre potenzielle Berechtigung und Relevanz als Personalentwicklungsmaßnahme zu untermauern.
Im ersten Teil der Arbeit sollen die Hintergründe zum Thema OT beleuchtet werden. Was ist OT? Welche Leitprinzipien gibt es? Woher kommt es? Welche Methoden verbergen sich hinter einem solchen Programm? Welche Ziele können erreicht werden? Und vor allem: Wie gelingt der Lerntransfer in den Berufsalltag? Wie funktioniert Lernen im OT?
Im zweiten Teil soll kurz auf die Rolle der PE, im Hinblick auf die sich verändernden Anforderungen an den modernen Arbeitnehmer in der lernenden Organisation, eingegangen werden. Anschließend werde ich in Form einer Erörterung und durch Literatur- und Diskursanalyse auf die Relevanz von OT für PE eingehen. Welche Chancen bietet OT der PE auch im Vergleich zu klassischen kognitiv ausgerichteten Seminarkonzepten? Welche für die PE relevanten Kompetenzen können weiter-entwickelt werden? Im Anschluss sollen die Chancen noch einmal kritisch hinterfragt werden und auch die bestehenden Probleme und Grenzen der Methode aufgezeigt werden.
Im Fazit werde ich noch einmal zusammenfassen, was OT so besonders macht und inwiefern es für die PE ein effektives Instrument zur Weiterentwicklung der Mitarbeiter darstellen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Outdoor-Training - Erlebnispädagogik für den Betrieb
- Begriffsbestimmung und -abgrenzung
- Entwicklungsgeschichte: die Wurzeln des OT in der EP
- Einsatzbereiche und Ziele
- Kursdesign und Methoden
- Lern- und Wirkungsmodelle
- Zwischenfazit
- Outdoor-Training – Erfolgsfaktor für eine moderne Personalentwicklung?
- Definition und Ziele der betrieblichen Personalentwicklung
- Chancen
- Sozialkompetenzsteigerung
- Effizienteres soziales Lernen
- Grenzen
- Transfer- und Evaluationsproblematik
- Pädagogische und psychologische Sicherheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendung von Outdoor-Trainings (OT) in der betrieblichen Personalentwicklung (PE). Ziel ist es, die Chancen und Grenzen von OT als Personalentwicklungsmaßnahme zu beleuchten und deren Relevanz zu evaluieren. Die Arbeit analysiert die Wirkungsweise von OT, vergleicht sie mit traditionellen Seminarmethoden und bewertet ihr Potential zur Förderung von Schlüsselkompetenzen.
- Definition und Abgrenzung von Outdoor-Training und Erlebnispädagogik
- Chancen von Outdoor-Training für die Steigerung von Sozialkompetenz und effizienterem sozialen Lernen
- Herausforderungen und Grenzen von Outdoor-Training in Bezug auf Lerntransfer und Evaluation
- Wirkungsweise von Outdoor-Training im Kontext ganzheitlichen Lernens
- Relevanz von Outdoor-Training für die Personalentwicklung in lernenden Organisationen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Personalentwicklung im Kontext der sich verändernden Anforderungen an moderne Arbeitnehmer ein. Sie hebt die wachsende Bedeutung von Sozialkompetenzen hervor und stellt Outdoor-Trainings (OT) als innovative Methode der Kompetenzentwicklung vor. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Chancen, Grenzen und Wirkungsweisen von OT in der betrieblichen Personalentwicklung, um deren Relevanz als Personalentwicklungsmaßnahme zu belegen. Die Autorin beschreibt ihre Motivation, basierend auf praktischen Erfahrungen im betrieblichen Bildungsbereich und einer Ausbildung zur Erlebnispädagogin, die Möglichkeiten der Erlebnispädagogik im Bereich der Personalentwicklung zu untersuchen.
Outdoor-Training – Erlebnispädagogik für den Betrieb: Dieses Kapitel klärt zunächst gängige Missverständnisse über Outdoor-Trainings auf und grenzt sie von Überlebenstrainings ab. Es definiert OT als eine handlungs- und erlebnisorientierte Methode, die im Freien stattfindet, aber auch Indoor-Elemente integrieren kann. Der Schwerpunkt liegt auf dem „Learning by Doing“-Prinzip, bei dem Lerninhalte ganzheitlich, praktisch und erfahrungsbasiert vermittelt werden. Der historische Zusammenhang zwischen OT und Erlebnispädagogik wird erläutert, und die Unterschiede in Bezug auf Zielgruppen und -setzungen werden herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Outdoor-Training, Erlebnispädagogik, Personalentwicklung, Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Lernmethoden, „Learning by Doing“, ganzheitliches Lernen, Chancen, Grenzen, Lerntransfer, Kompetenzentwicklung, moderne Arbeitswelt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Outdoor-Training in der betrieblichen Personalentwicklung"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Anwendung von Outdoor-Training (OT) in der betrieblichen Personalentwicklung. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Chancen und Grenzen von OT als Personalentwicklungsmaßnahme und der Evaluation seiner Relevanz.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Kernthemen: Definition und Abgrenzung von Outdoor-Training und Erlebnispädagogik; Chancen von OT zur Steigerung der Sozialkompetenz und des sozialen Lernens; Herausforderungen und Grenzen von OT bezüglich Lerntransfer und Evaluation; Wirkungsweise von OT im Kontext ganzheitlichen Lernens; Relevanz von OT für die Personalentwicklung in lernenden Organisationen; Entwicklungsgeschichte und Einsatzbereiche von OT; Kursdesign und Methoden; Lern- und Wirkungsmodelle im OT.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung der Anwendung von Outdoor-Trainings in der betrieblichen Personalentwicklung. Es soll die Chancen und Grenzen von OT als Personalentwicklungsmaßnahme beleuchtet und deren Relevanz evaluiert werden. Die Arbeit analysiert die Wirkungsweise von OT, vergleicht sie mit traditionellen Seminarmethoden und bewertet ihr Potential zur Förderung von Schlüsselkompetenzen.
Welche Kapitel beinhaltet das Dokument?
Das Dokument umfasst Kapitel zu einer Einleitung, Outdoor-Training als Erlebnispädagogik für den Betrieb (inkl. Begriffsbestimmung, Entwicklungsgeschichte, Einsatzbereiche, Kursdesign, Lern- und Wirkungsmodelle), Outdoor-Training als Erfolgsfaktor für moderne Personalentwicklung (inkl. Chancen wie Sozialkompetenzsteigerung und Grenzen wie Transfer- und Evaluationsproblematik), und einem abschließenden Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Outdoor-Training, Erlebnispädagogik, Personalentwicklung, Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Lernmethoden, „Learning by Doing“, ganzheitliches Lernen, Chancen, Grenzen, Lerntransfer, Kompetenzentwicklung, moderne Arbeitswelt.
Wie wird Outdoor-Training im Dokument definiert?
Outdoor-Training wird als eine handlungs- und erlebnisorientierte Methode definiert, die im Freien stattfindet, aber auch Indoor-Elemente integrieren kann. Der Schwerpunkt liegt auf dem „Learning by Doing“-Prinzip, bei dem Lerninhalte ganzheitlich, praktisch und erfahrungsbasiert vermittelt werden. Es wird von Überlebenstrainings abgegrenzt.
Welche Chancen und Grenzen von Outdoor-Training werden betrachtet?
Chancen liegen in der Steigerung der Sozialkompetenz und effizienterem sozialen Lernen. Grenzen liegen in der Transfer- und Evaluationsproblematik sowie in der Gewährleistung pädagogischer und psychologischer Sicherheit.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für alle, die sich mit Personalentwicklung, insbesondere mit innovativen Methoden der Kompetenzentwicklung, befassen. Dies umfasst Personalentwickler, Trainer, Dozenten und Studierende im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
- Citar trabajo
- Tina Basner (Autor), 2013, „Learning by Doing“ statt Lernen durch Lehren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272287