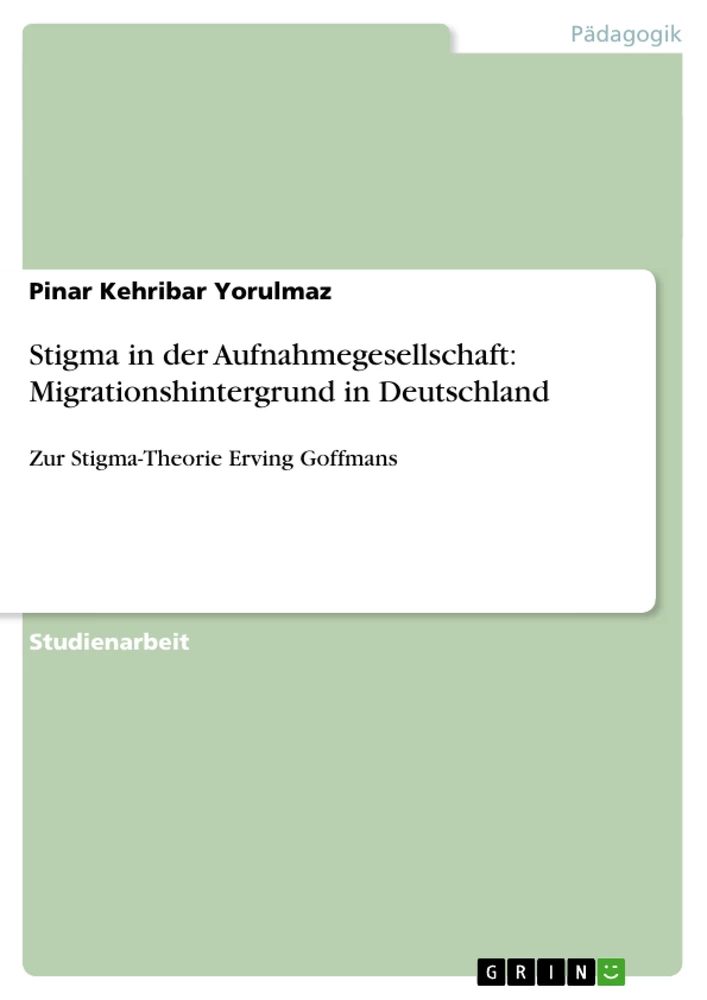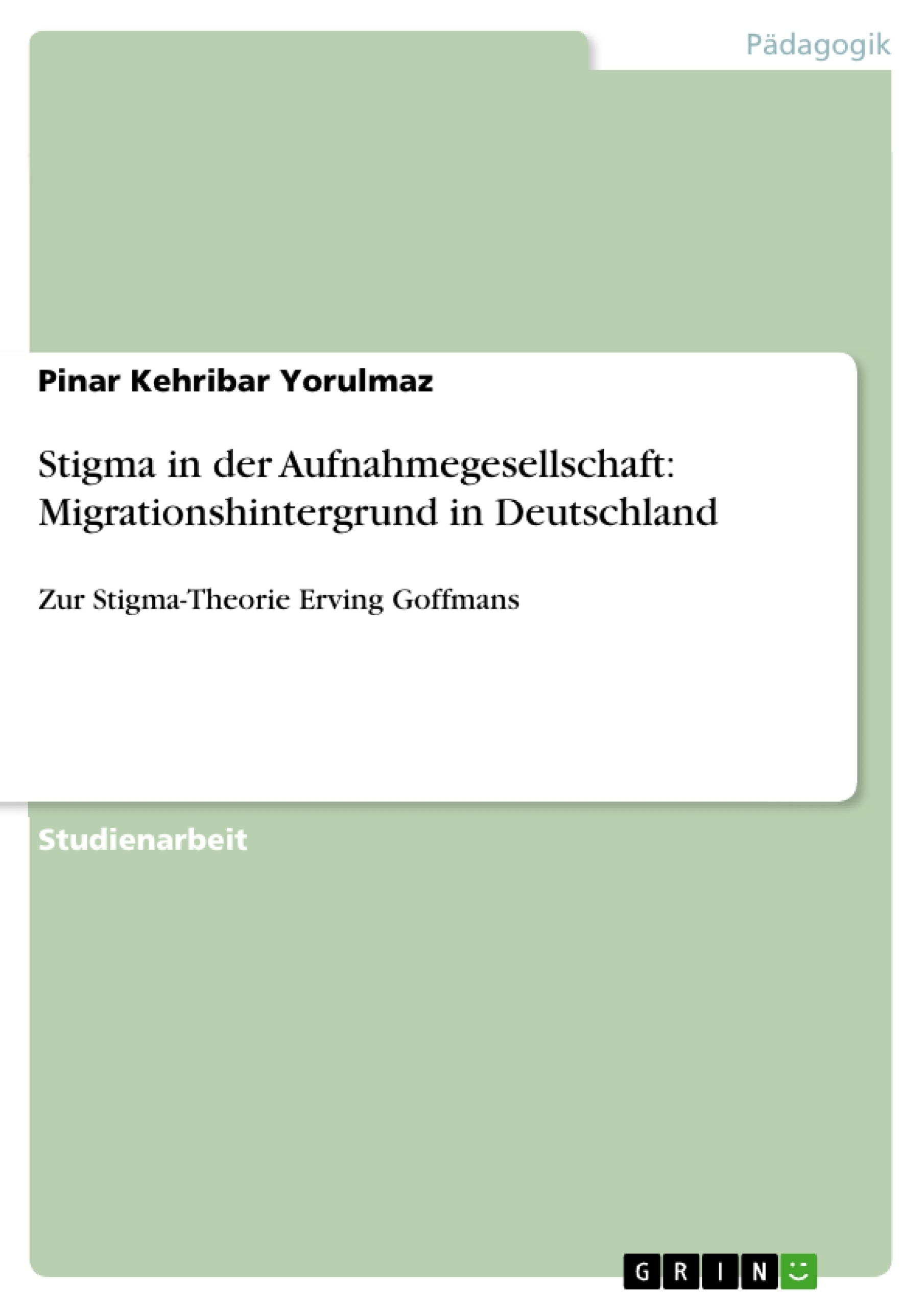Die erste Generation, der in den 1960er Jahren angeworbenen Arbeitsmigranten,
die sogenannten „Gastarbeiter“, befinden sich inzwischen im Ruhestand. Die große Mehrheit der „Gastarbeiterkinder“, also die zweite und dritte Generation, ist bereits in Deutschland geboren. Diese Bevölkerungsgruppe hat eine sehr junge Alterstruktur. Insbesondere die dritte und vierte Generation kennt „die Heimat der Eltern“ in erster Linie, nur noch durch Erzählungen älterer Familienmitglieder, aus den Medien oder von Urlaubsreisen. Mittlerweile lässt sich klar feststellen, dass deren Lebensmittelpunkt in Deutschland liegt.
Sie sind hier geboren, aufgewachsen, gehen hier zur Schule oder arbeiten hier. Sie haben ihre gesamte Sozialisation in Deutschland durchlebt. Sie sind Teil der deutschen Gesellschaft. Menschen mit Migrationshintergrund bilden keine homogene Gruppe, doch eines haben sie alle gemeinsam: Sie tragen ein Stigma. Das Stigma Migrationshintergrund.
Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Stigma-Theorie Erving Goffmans, der die erste sozialwissenschaftliche Arbeit über dieses Thema veröffentlichte. Ferner wird versucht darzustellen, wie das Stigma Migrationshintergrund zu Benachteiligung in den Bereichen Bildung und Medienberichterstattung führen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Erving Goffman: Biographie und Werke
- 2. Stigma nach Erving Goffman
- 2.1. Stigma des Deskreditierten und des Deskreditierbaren
- 2.2. Stigmatisierungsprozess
- 3. Stigmabewältigung nach Major und Eccleston
- 4. Ursachen und Funktionen von Stigmata
- 5. Das Stigma Migrationshintergrund
- 6. Benachteiligung in Bildung und Medien und beispielhafte Initiativen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Erving Goffmans Stigma-Theorie und deren Anwendung auf das Stigma "Migrationshintergrund" in Deutschland. Es wird analysiert, wie dieses Stigma zu Benachteiligungen in Bildung und Medien führt. Die Arbeit beleuchtet auch persönliche Erfahrungen der Autorin mit diesem Stigma.
- Goffmans Stigma-Theorie
- Das Stigma "Migrationshintergrund" in Deutschland
- Benachteiligung im Bildungssystem
- Medienrepräsentation von Migranten
- Möglichkeiten der Stigmabewältigung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Erving Goffman: Biographie und Werke: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Biographie von Erving Goffman, beginnend mit seiner frühen akademischen Laufbahn an der Universität Toronto und Chicago, über seine Feldforschung auf den Shetland-Inseln bis hin zu seinen bedeutenden Professuren in Berkeley und Philadelphia. Es werden seine wichtigsten Werke, darunter "The Presentation of Self in Everyday Life" und "Asylums", erwähnt, wobei der Fokus auf seinem einflussreichen Werk "Stigma" liegt, das den theoretischen Rahmen dieser Arbeit bildet. Die detaillierte Darstellung von Goffmans Lebenslauf und akademischen Leistungen unterstreicht die Bedeutung seines Beitrags zur Soziologie und dem Verständnis von Stigmatisierungsprozessen.
2. Stigma nach Erving Goffman: Dieses Kapitel stellt Goffmans Stigma-Theorie vor. Goffman definiert Stigma als ein Merkmal, das ein Individuum von der Norm abweichen lässt und zu sozialer Ausgrenzung führt. Es werden die Unterscheidung zwischen deskreditierten und deskreditierbaren Individuen erläutert, sowie der Prozess der Stigmatisierung selbst. Die Ausführungen zeigen, wie gesellschaftliche Normen und Erwartungen das Stigma formen und aufrechterhalten. Der Text betont, dass die Definition von "normal" und "abweichend" gesellschaftlich konstruiert ist und sich je nach Kontext verändern kann.
5. Das Stigma Migrationshintergrund: In diesem Kapitel wird das Stigma "Migrationshintergrund" im Kontext der deutschen Gesellschaft beleuchtet. Es wird argumentiert, dass Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland, trotz ihrer Integration, ein Stigma tragen, das zu vielfältigen Benachteiligungen führt. Das Kapitel verknüpft die theoretischen Grundlagen von Goffmans Stigma-Theorie mit der konkreten Erfahrung von Migranten in Deutschland, indem es die gesellschaftlichen Mechanismen der Ausgrenzung und Marginalisierung verdeutlicht. Die persönlichen Erfahrungen der Autorin werden hier als Beispiel für die Auswirkungen dieses Stigmas eingebracht.
6. Benachteiligung in Bildung und Medien und beispielhafte Initiativen: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen des Stigmas "Migrationshintergrund" auf die Bereiche Bildung und Medien. Es werden konkrete Beispiele für Benachteiligung in der Bildung und die oft negative Darstellung von Migranten in den Medien analysiert. Der Fokus liegt auf der Veranschaulichung der konkreten Folgen des Stigmas für betroffene Individuen. Es werden möglicherweise auch Initiativen und Projekte genannt, die sich für eine Verbesserung der Situation einsetzen und gegen die Benachteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund vorgehen. Diese Initiativen dienen als Beispiele für konstruktive Ansätze im Umgang mit dem Problem der Stigmatisierung.
Schlüsselwörter
Stigma, Erving Goffman, Migrationshintergrund, Deutschland, Benachteiligung, Bildung, Medien, Stigmatisierungsprozess, soziale Akzeptanz, Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Goffmans Stigma-Theorie und das Stigma "Migrationshintergrund" in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Erving Goffmans Stigma-Theorie und deren Anwendung auf das Stigma "Migrationshintergrund" in Deutschland. Sie analysiert, wie dieses Stigma zu Benachteiligungen in Bildung und Medien führt und beleuchtet persönliche Erfahrungen der Autorin mit diesem Stigma. Die Arbeit beinhaltet eine Biografie Goffmans, eine detaillierte Erklärung seiner Stigma-Theorie, eine Auseinandersetzung mit dem Stigma "Migrationshintergrund" und dessen Auswirkungen auf Bildung und Medien sowie Beispiele für Initiativen gegen diese Benachteiligung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Goffmans Stigma-Theorie, das Stigma "Migrationshintergrund" in Deutschland, Benachteiligung im Bildungssystem, Medienrepräsentation von Migranten und Möglichkeiten der Stigmabewältigung. Es werden deskreditierte und deskreditierbare Individuen nach Goffman unterschieden und der Stigmatisierungsprozess erklärt.
Wer ist Erving Goffman und welche Rolle spielt er in dieser Arbeit?
Erving Goffman ist ein bedeutender Soziologe, dessen Stigma-Theorie den theoretischen Rahmen dieser Arbeit bildet. Die Arbeit beinhaltet eine ausführliche Biografie Goffmans, beginnend mit seiner akademischen Laufbahn bis hin zu seinen wichtigsten Werken wie "The Presentation of Self in Everyday Life" und "Asylums". Sein Werk "Stigma" steht im Mittelpunkt der Analyse.
Wie wird Goffmans Stigma-Theorie in der Arbeit angewendet?
Goffmans Stigma-Theorie, die Stigma als ein Merkmal definiert, das ein Individuum von der Norm abweichen lässt und zu sozialer Ausgrenzung führt, wird auf das Stigma "Migrationshintergrund" in Deutschland angewendet. Die Arbeit analysiert, wie gesellschaftliche Normen und Erwartungen dieses Stigma formen und aufrechterhalten und welche Folgen dies für betroffene Personen hat.
Welche konkreten Beispiele für Benachteiligung werden genannt?
Die Arbeit untersucht konkrete Beispiele für Benachteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund in Bildung und Medien. Es werden negative Darstellungen in den Medien und die Auswirkungen des Stigmas auf den Bildungserfolg analysiert. Konkrete Beispiele werden im Kapitel "Benachteiligung in Bildung und Medien und beispielhafte Initiativen" dargestellt.
Gibt es auch positive Beispiele oder Initiativen im Umgang mit dem Stigma?
Ja, die Arbeit erwähnt und beschreibt auch Initiativen und Projekte, die sich für eine Verbesserung der Situation von Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen und gegen die Benachteiligung vorgehen. Diese dienen als Beispiele für konstruktive Ansätze im Umgang mit dem Problem der Stigmatisierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: 1. Erving Goffman: Biographie und Werke; 2. Stigma nach Erving Goffman (inkl. 2.1 Stigma des Deskreditierten und des Deskreditierbaren und 2.2 Stigmatisierungsprozess); 3. Stigmabewältigung nach Major und Eccleston; 4. Ursachen und Funktionen von Stigmata; 5. Das Stigma Migrationshintergrund; 6. Benachteiligung in Bildung und Medien und beispielhafte Initiativen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Stigma, Erving Goffman, Migrationshintergrund, Deutschland, Benachteiligung, Bildung, Medien, Stigmatisierungsprozess, soziale Akzeptanz und Integration.
- Citation du texte
- M.A. Pinar Kehribar Yorulmaz (Auteur), 2009, Stigma in der Aufnahmegesellschaft: Migrationshintergrund in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272483