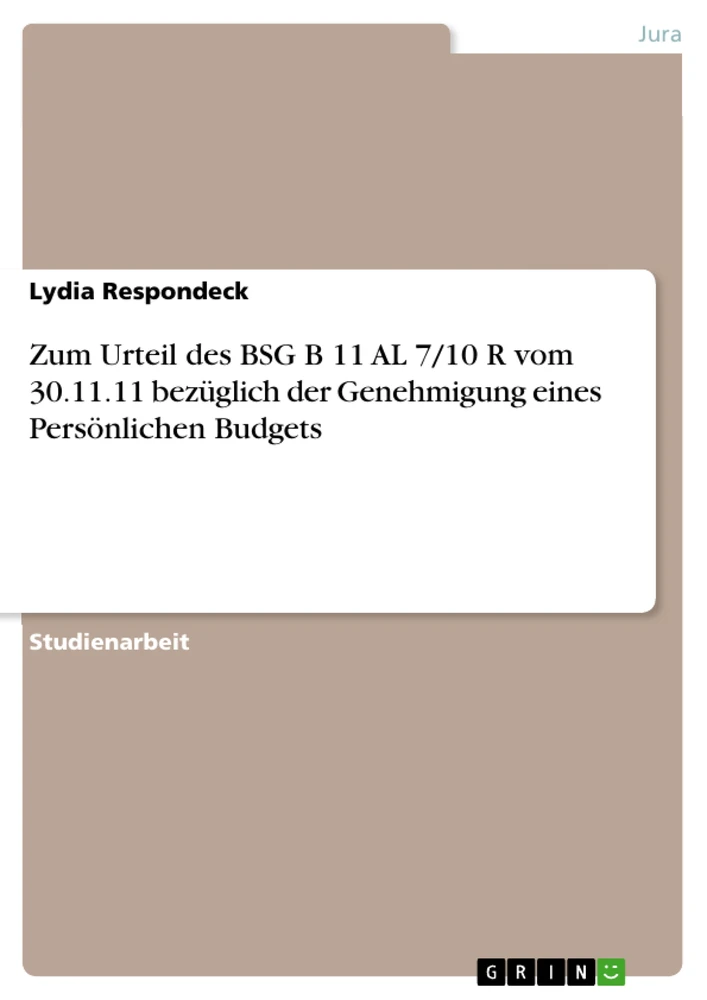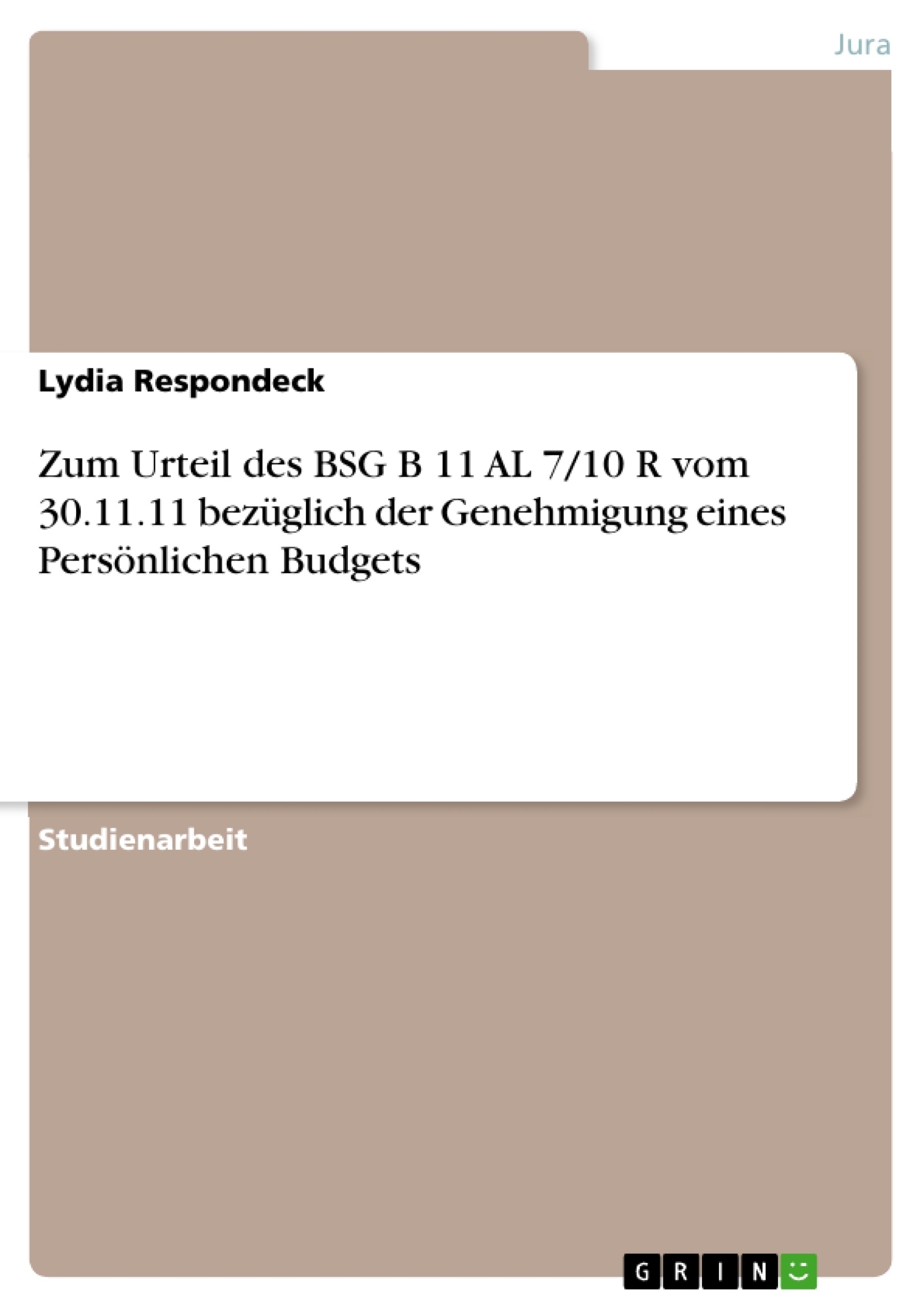Nach § 17 Abs. 2 bis 4 SGB IX i. V. m. der BudgetV in § 159 SGB IX können die besonderen Leistungen zur Teilhabe auf Antrag ebenso als Persönliches Budget ausgeführt werden . Eine Legaldefinition der budgetfähigen Leistungen befindet sich in § 17 Abs. 2 S. 4 SGB IX. Das sind alltägliche und regelmäßig wiederkehrende Bedarfe, die als Geldleistung oder durch Gutscheine erbracht werden können. Als Experten ihrer eigenen Bedarfe agieren die Leistungsberechtigten selbst als Arbeit- und Auftraggeber. Das Ziel des Persönlichen Budgets ist dabei die Gewährleistung und eines selbstbestimmten Lebens der behinderten Menschen. Seit 2008 ist das Persönliche Budget keine Ermessens-, sondern eine Pflichtleistung gem. § 159 Abs. 5 SGB IX. Ein dringend erforderlicher Perspektivwechsel in der Rehabilitation ist die Grundlage für die Realisierung von Teilhabe und Selbstbestimmung behinderter Menschen. Es geht um einen Wechsel von Leistungen, die sich nicht mehr an dem vorhandenen Angebot orientieren, sondern an dem individuellen Bedarf. Dabei ist es von großer Wichtigkeit die Leistungsempfänger bei der Installation der Hilfen teilhaben zu lassen und ihre Ressourcen zu berücksichtigen. Angestoßen wurde dieser Wandel mit dem 2001 eingeführten SGB IX. Seither geht es vermehrt um die Qualitätssteigerung und eine Stärkung des Leistungsempfängers sowie um das neue Gesamtziel der Rehabilitation, um Selbstbestimmung und Gleichberechtigung von behinderten Menschen, wie auch die Vermeidung oder Entgegenwirkung von Benachteiligung .
Teil dieses Perspektivwechsels ist auch das Persönliche Budget. Jedoch die Umsetzung in der Realität bringt Konflikte in der Praxis und rechtlicher Art mit sich. Ein sehr beispielhafter Fall zu dieser Problematik ist die in dieser Hausarbeit behandelte Entscheidung des BSG. Diese Rechtssprechung könnte sich nach der kurzen Darstellung des Sachverhalts und einer kritischen Auseinandersetzung mit Aspekten der Entscheidung im Laufe der Hausarbeit als wegweisend für die Praxis darstellen. Auf diese Bedeutung des Urteils soll dann im fünften Kapitel eingegangen werden und im Anschluss ein Fazit gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sachverhalt
- Beteiligte und Verlauf der Sachlage
- Kläger
- Beklagte
- Verfahrensgang
- Beteiligte und Verlauf der Sachlage
- Entscheidungsgründe des BSG
- Zur Zuständigkeit gem. § 14 SGB III
- Zum Persönlichen Budget
- Hinweise zu den zu prüfenden Rechtsgrundlagen
- Zu der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben
- Zur Auffassung des LSG und zum Persönlichen Budget
- Offene Fragen des BSG an das LSG
- Kritik
- Vergleichbarkeit der Leistung mit einer anerkannten WfbM
- Förderung nach § 117 Abs. 2 SGB III und die Selbstbestimmung des Leistungsberechtigten
- Wunsch- und Wahlrecht
- Zielvereinbarungen
- Zum § 56 SGB XII
- Die Bedeutung des Urteils
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 30.11.2011, das sich mit der Genehmigung eines Persönlichen Budgets im Kontext der beruflichen Rehabilitation beschäftigt. Die Arbeit analysiert die rechtlichen und praktischen Aspekte des Persönlichen Budgets, insbesondere im Hinblick auf die Vergleichbarkeit mit einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) und die Selbstbestimmung des Leistungsberechtigten.
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Persönlichen Budgets
- Vergleichbarkeit des Persönlichen Budgets mit Leistungen einer WfbM
- Selbstbestimmung des Leistungsberechtigten im Kontext der Berufsbildung
- Bedeutung des BSG-Urteils für die Praxis der Leistungserbringung
- Kritikpunkte und offene Fragen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt den Sachverhalt des BSG-Urteils vor. Kapitel 2 beschreibt die Beteiligten und den Verlauf des Verfahrens, das zur Entscheidung des BSG führte. Kapitel 3 analysiert die Entscheidungsgründe des BSG im Detail, wobei die Zuständigkeit, das Persönliche Budget und die relevanten Rechtsgrundlagen beleuchtet werden. Kapitel 4 befasst sich mit der Kritik an der Entscheidung des BSG und untersucht die Vergleichbarkeit des Persönlichen Budgets mit einer anerkannten WfbM sowie die Förderung nach § 117 Abs. 2 SGB III im Hinblick auf die Selbstbestimmung des Leistungsberechtigten. Schließlich wird in Kapitel 5 die Bedeutung des BSG-Urteils für die Praxis der Leistungserbringung und die weitere Entwicklung des Persönlichen Budgets beleuchtet.
Schlüsselwörter
Persönliches Budget, Berufsbildung, Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), Selbstbestimmung, Förderung, Rechtliche Rahmenbedingungen, § 17 SGB IX, § 117 SGB III, § 56 SGB XII, BSG-Urteil, Vergleichbarkeit.
- Arbeit zitieren
- Lydia Respondeck (Autor:in), 2013, Zum Urteil des BSG B 11 AL 7/10 R vom 30.11.11 bezüglich der Genehmigung eines Persönlichen Budgets, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272493