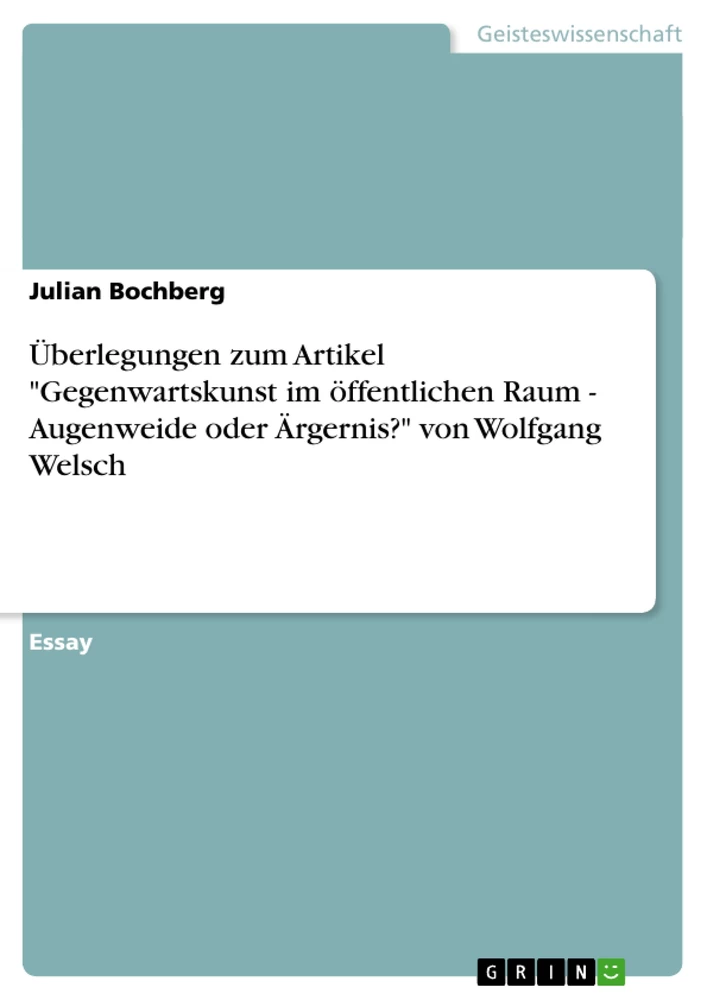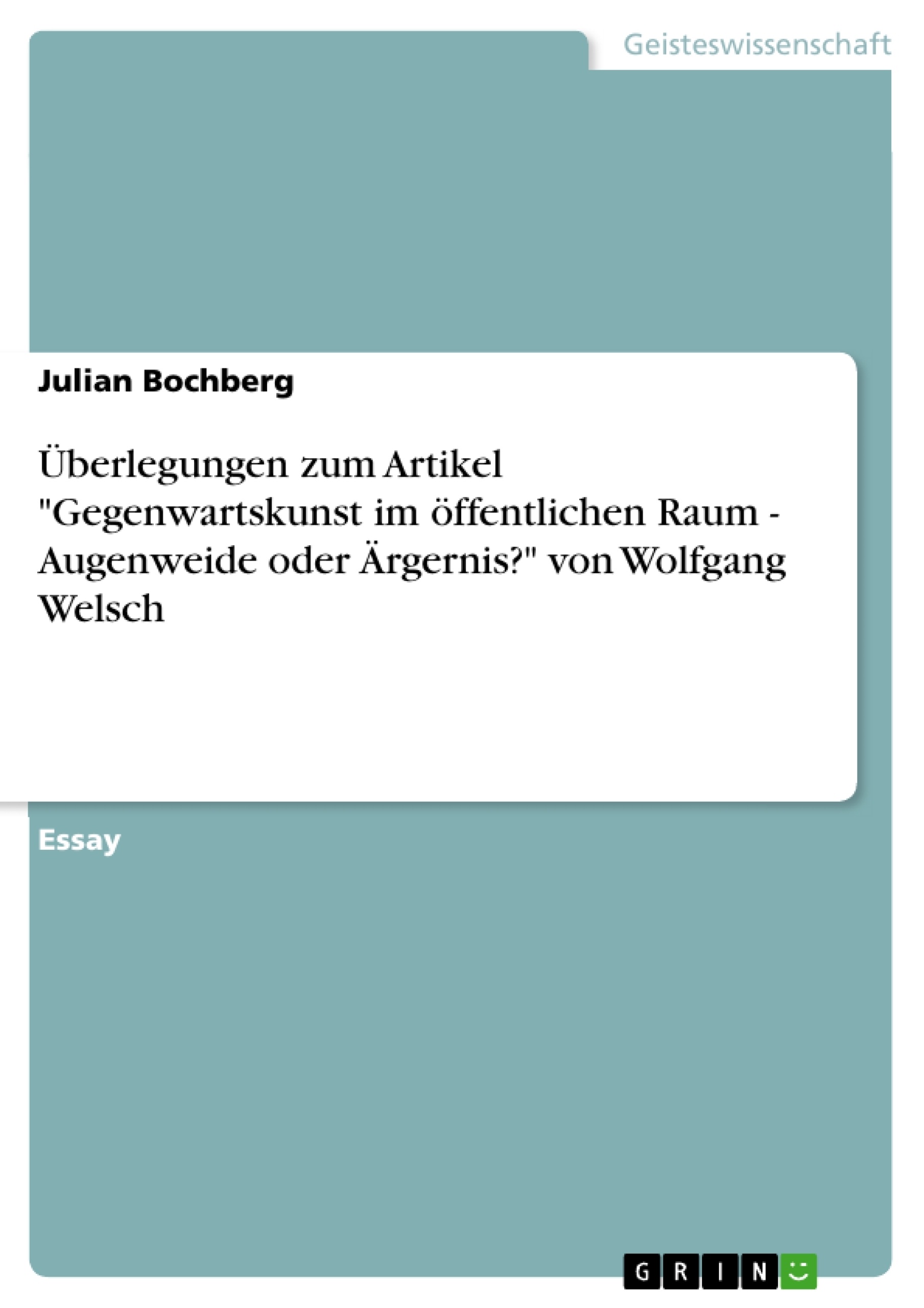Im folgenden Essay möchte ich den Aufsatz „Gegenwartskunst im öffentlichen Raum: Augenweide oder Ärgernis?“ von Wolfgang Welsch näher beleuchten. Der Aufsatz beschäftigt sich mit dem Prozess der Hyperästhetisierung des öffentlichen Raumes. Welsch vertritt die These, dass es der Kunst nicht mehr möglich ist in einer ‚verhübschten’ Welt, in der alles schön ist, Platz zu finden. Dadurch kann sie ihrer eigentlichen Aufgabe nicht mehr nachkommen und verliert in einer hyperästhetischen Umwelt an Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verschiebung des Terminus Kunst im öffentlichen Raum
- Eine graue Welt wird bunt
- Die neue Form von „Kunst am Bau'
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay „Gegenwartskunst im öffentlichen Raum: Augenweide oder Ärgernis?" von Wolfgang Welsch untersucht die Hyperästhetisierung des öffentlichen Raumes und argumentiert, dass Kunst in einer „verhübschten“ Welt, in der alles schön ist, keinen Platz mehr findet. Welsch plädiert für eine Kunst, die im öffentlichen Raum provoziert und Aufmerksamkeit erregt, um der Hyperästhetisierung entgegenzuwirken.
- Hyperästhetisierung des öffentlichen Raumes
- Die Rolle von Kunst im öffentlichen Raum
- Graffiti und Streetart als Kunstform
- „Kunst am Bau' als neue Form der Kunst im öffentlichen Raum
- Die Beziehung zwischen Kunst, Vandalismus und Kommerz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die These von Wolfgang Welsch vor und führt in die Thematik der Hyperästhetisierung des öffentlichen Raumes ein. Welsch argumentiert, dass die Kunst in einer Welt, in der alles schön ist, ihre eigentliche Aufgabe nicht mehr erfüllen kann und an Bedeutung verliert. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, plädiert er für eine Kunst, die provoziert und Aufmerksamkeit erregt, um den fehlenden Platz im öffentlichen Raum einzunehmen.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Verschiebung des Terminus „Kunst im öffentlichen Raum“ und die Auswirkungen der Hyperästhetisierung auf den öffentlichen Raum. Welsch kritisiert die „Verhübschung“ des urbanen Raumes, die zu einer Verdrängung der Kunst führt. Shopping Areale, Gebäude und öffentliche Räume werden zunehmend ästhetisch gestaltet, um Konsum und Erlebnis zu fördern. Welsch sieht in dieser Entwicklung eine Verfälschung des demokratischen Charakters des öffentlichen Raumes.
Kapitel drei untersucht die Graffiti- und Streetart-Szene als Beispiel für eine Kunstform, die sich gegen die Hyperästhetisierung des öffentlichen Raumes stellt. Die Künstler der Szene provozieren, bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Legalität und Illegalität und nutzen den öffentlichen Raum für ihre Kunst. Graffiti und Streetart werden oft als „Argernis“ wahrgenommen, aber sie bieten gleichzeitig eine Möglichkeit, den hyperästhetischen Raum aufzubrechen und Platz für Kunst zu schaffen.
Das vierte Kapitel beleuchtet die „Kunst am Bau“ als eine neue Form der Kunst im öffentlichen Raum, die auch von staatlichen Institutionen und privaten Unternehmen genutzt wird. Der Begriff „Kunst am Bau“ bezeichnet die Verbindung zwischen Kunst, einem Bauwerk und dem Baugrundstück. Graffiti und Streetart können auch Formen von „Kunst am Bau“ sein, die durch ihre Auffälligkeit und Buntheit Aufmerksamkeit erregen und den öffentlichen Raum bereichern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Gegenwartskunst, öffentlicher Raum, Hyperästhetisierung, Graffiti, Streetart, „Kunst am Bau“, Vandalismus, Kommerz, Ästhetik, Provokation, Aufmerksamkeit, Stadtbild, Demokratie und Verhübschung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Wolfgang Welsch unter "Hyperästhetisierung"?
Dass der öffentliche Raum zunehmend "verhübscht" und durchgestaltet wird (z. B. Shopping-Center), wodurch echte Kunst ihren Platz verliert.
Warum verliert Kunst in einer "schönen" Welt an Bedeutung?
Wenn alles ästhetisch optimiert ist, kann Kunst nicht mehr provozieren oder Aufmerksamkeit erregen, was jedoch ihre eigentliche Aufgabe ist.
Sind Graffiti und Streetart für Welsch Kunst oder Vandalismus?
Er sieht darin eine Form von Kunst, die den hyperästhetischen Raum aufbricht und durch Provokation wieder echte Aufmerksamkeit im Stadtbild erzeugt.
Was ist "Kunst am Bau"?
Eine Verpflichtung bei staatlichen oder großen privaten Bauprojekten, einen Teil der Kosten für künstlerische Gestaltung am Gebäude aufzuwenden.
Wie beeinflusst Kommerz den öffentlichen Raum?
Öffentliche Räume werden oft so gestaltet, dass sie den Konsum fördern (Erlebniswelten), was den demokratischen Charakter des Raumes verfälschen kann.
- Citar trabajo
- Bachelor of Science // Bachelor of Arts Julian Bochberg (Autor), 2013, Überlegungen zum Artikel "Gegenwartskunst im öffentlichen Raum - Augenweide oder Ärgernis?" von Wolfgang Welsch, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273213