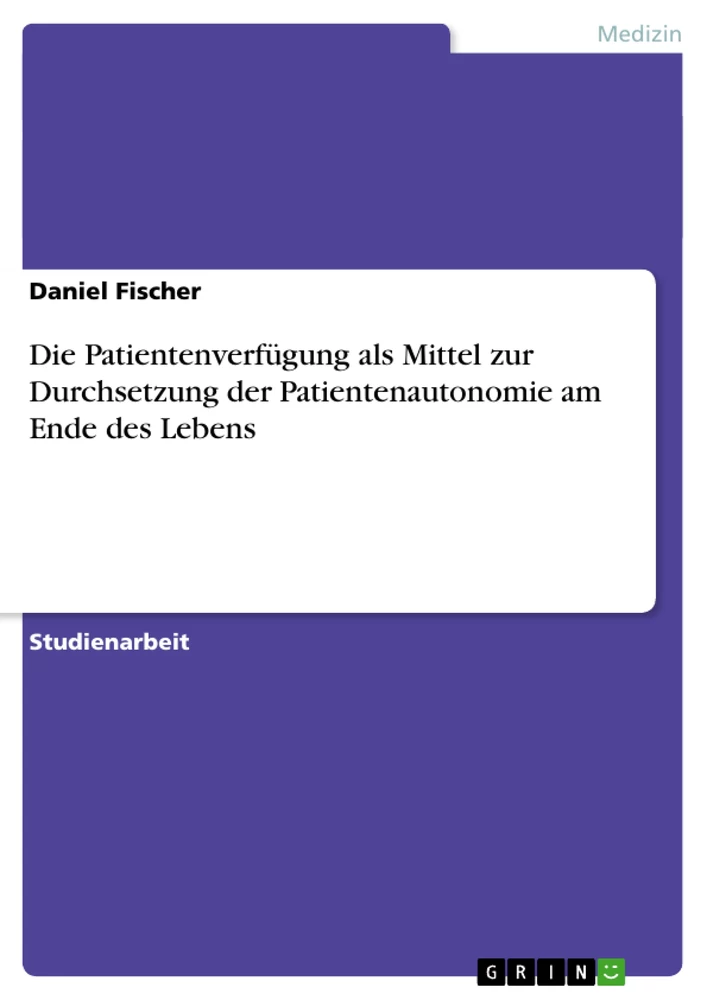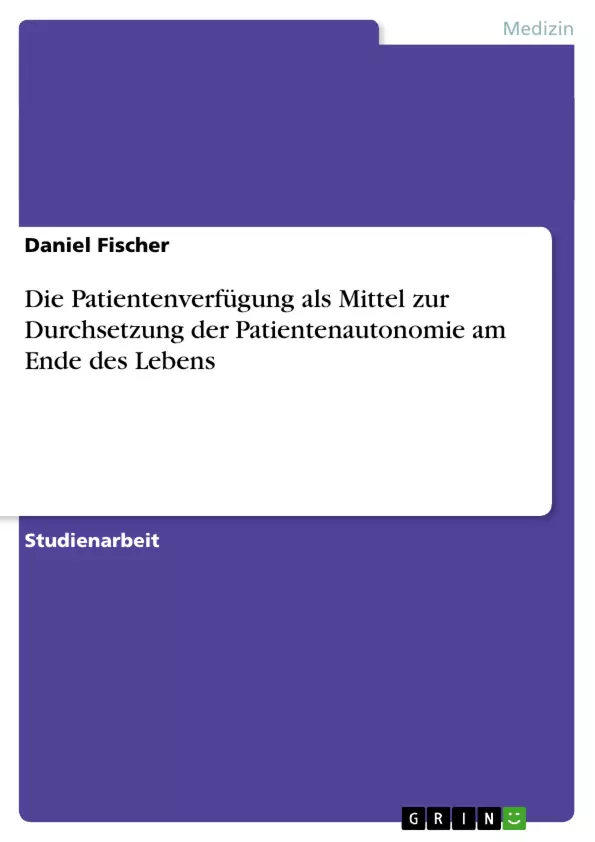Die Zahl der Patientenverfügungen in Deutschland ist momentan stetig steigend. Dies zeigt sich schon bei der Internetrecherche mit dem Stichwort „Patientenverfügung“: zu Beginn der Nachforschungen für diese Arbeit vor circa drei Monaten waren es noch 14.600 Treffer – heute bekommt man eine Angabe von ungefähr 16.500 Treffern. Inzwischen gibt es eine kaum zu überblickende Vielzahl an Vordrucken und Mustern von verschiedenen Institutionen.
Mit vielen Mustern haben sich auch viele Begriffe entwickelt, die gebräuchlichsten sind Patientenverfügung, Patiententestament oder Patientenbrief. In Deutschland scheint sich in der Umgangssprache der Begriff Patiententestament durchzusetzen. Da die Patientenverfügung nicht wie das Testament ein Geschäft mortis causa ist, also grundsätzlich mit dem Tod zusammenhängt, setzt sich in der Fachliteratur der Begriff Patientenverfügung durch (statt vieler vgl. Baumgarten 2000, S. 303). Dieser Begriff wird auch in dieser Arbeit verwendet.
Die Patientenverfügung wird verfasst um die Patientenautonomie auch am Ende des Lebens zu sichern. Aus diesem Grund wird zu Beginn der Arbeit der Begriff der Patientenautonomie näher beleuchtet. Hierbei wird unterschieden zwischen einwilligungsfähigen Patienten und einwilligungsunfähigen Patienten. Im folgenden Kapitel wird die Sonderform der Patientenautonomie beim einwilligungsunfähigen Patienten dargestellt, welche auch der Schwerpunkt dieser Arbeit sein wird – die Patientenverfügung. Hierbei wird im Rahmen einer thematischen Einführung eine genauere Definition vorgenommen und die Herkunft der Patientenverfügung erklärt. Das dritte Kapitel behandelt die rechtlichen Aspekte, die gesetzlichen Grundlagen durch die eine Patientenverfügung möglich ist und vor allem die viel umstrittene Bindungswirkung. Anhand dieser Grundlagen wird im anschließenden Kapitel erklärt, wie man eine rechtskräftige, dem eigenen Willen entsprechende Patientenverfügung verfasst. Der Abschluss der Arbeit beschäftigt sich mit den ethischen Aspekten der Patientenverfügung und den Problemen die durch diese auftreten können.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Die Autonomie des Patienten
- Autonomie bei einwilligungsfähigen Patienten
- Voraussetzung für Autonomie
- Die Wichtigkeit der Selbstentscheidung
- Das Recht auf Achtung der Autonomie
- Der Informed Consent
- Patientenautonomie und Pflege
- Autonomie bei einwilligungsunfähigen Patienten
- Einführung in die Patientenverfügung
- Definition der Patientenverfügung
- Historische Entwicklung der Patientenverfügung
- Inhalte der Patientenverfügung
- Rechtliche Aspekte der Patientenverfügung
- Gesetzliche Grundlagen der Patientenverfügung
- Bindungswirkung der Patientenverfügung
- Widerrufsmöglichkeiten der Patientenverfügung
- Exkurs: Weiter Möglichkeiten zur Sicherung der Patientenautonomie
- Die Vorsorgevollmacht
- Die Betreuungsverfügung
- Vor- und Nachteile von Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
- Leitlinien in der Praxis
- Erstellen einer Patientenverfügung
- Inhaltliche Auseinandersetzung mit der Patientenverfügung
- Darstellung verschiedener Patientenverfügungen
- Die christliche Patientenverfügung
- Die persönliche Patientenverfügung
- Die Patientenverfügung der Aktion Leben e. V.
- Der Weg zur Vorsorge
- Ethische Aspekte der Patientenverfügung
- Grenzfälle der Patientenverfügung
- Patientenverfügungen und Sterbehilfe
- Ethische Probleme durch die Patientenverfügung
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der Patientenverfügung und deren Bedeutung für die Patientenautonomie, insbesondere im Kontext der Entscheidungsfindung am Lebensende.
- Definition und historische Entwicklung der Patientenverfügung
- Rechtliche Grundlagen und Bindungswirkung der Patientenverfügung
- Erstellung einer rechtskräftigen Patientenverfügung
- Ethische Aspekte und Problemfelder im Zusammenhang mit der Patientenverfügung
- Alternative Vorsorgemöglichkeiten wie Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über die steigende Bedeutung von Patientenverfügungen in Deutschland und klärt den Begriff der Patientenverfügung im Gegensatz zum Patiententestament.
Kapitel 1 behandelt die Autonomie des Patienten, wobei zwischen einwilligungsfähigen und einwilligungsunfähigen Patienten unterschieden wird. Es werden wichtige Aspekte der Autonomie wie Selbstentscheidung, das Recht auf Achtung der Autonomie und der Informed Consent beleuchtet.
Kapitel 2 konzentriert sich auf die Patientenverfügung als Sonderform der Autonomie bei einwilligungsunfähigen Patienten. Es wird die Definition der Patientenverfügung sowie deren historische Entwicklung dargestellt.
Kapitel 3 beleuchtet die rechtlichen Aspekte der Patientenverfügung, insbesondere die gesetzlichen Grundlagen, die Bindungswirkung und die Widerrufsmöglichkeiten. Außerdem werden alternative Vorsorgemöglichkeiten wie Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung vorgestellt.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Erstellen einer Patientenverfügung und gibt Hinweise auf die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema sowie die verschiedenen Arten von Patientenverfügungen.
Kapitel 5 widmet sich den ethischen Aspekten der Patientenverfügung und beleuchtet Grenzfälle, die Verbindung zu Sterbehilfe sowie ethische Probleme, die im Zusammenhang mit der Patientenverfügung auftreten können.
Schlüsselwörter
Patientenautonomie, Patientenverfügung, Patiententestament, Informed Consent, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Rechtliche Grundlagen, Bindungswirkung, Ethische Aspekte, Sterbehilfe, Entscheidungsfindung am Lebensende, Selbstbestimmung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck einer Patientenverfügung?
Die Patientenverfügung dient dazu, die Patientenautonomie am Ende des Lebens sicherzustellen, falls man seinen Willen nicht mehr selbst äußern kann.
Was ist der Unterschied zwischen Patientenverfügung und Patiententestament?
In der Fachliteratur wird der Begriff Patientenverfügung bevorzugt, da es sich nicht um ein Geschäft "mortis causa" (wie bei einem Testament) handelt.
Was versteht man unter "Informed Consent"?
Informed Consent bezeichnet die informierte Einwilligung eines einwilligungsfähigen Patienten nach einer umfassenden Aufklärung durch den Arzt.
Welche Alternativen gibt es zur Patientenverfügung?
Weitere Möglichkeiten zur Sicherung der Autonomie sind die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung.
Ist eine Patientenverfügung rechtlich bindend?
Ja, die Bindungswirkung ist ein zentraler rechtlicher Aspekt, wobei die Verfügung jederzeit widerrufen werden kann.
- Citar trabajo
- Dipl. Pflegewirt Daniel Fischer (Autor), 2003, Die Patientenverfügung als Mittel zur Durchsetzung der Patientenautonomie am Ende des Lebens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27325