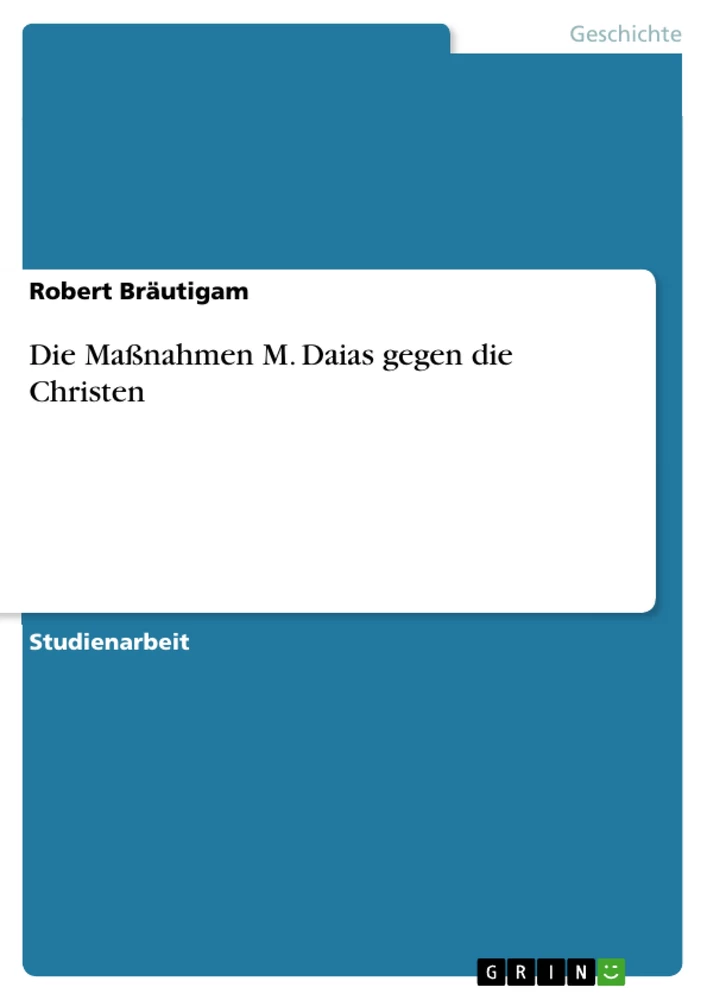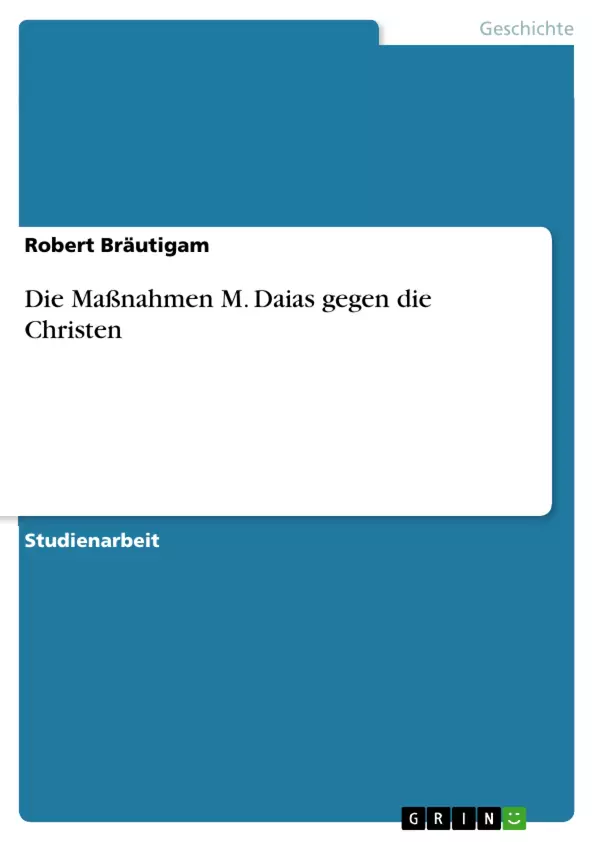Als der letzte Vertreter des tetrarchischen Systems ging Maximinus Daia (305-313) in die Geschichte ein. Diokletian (284-305) installierte während seiner Herrschaft das pseudodynastische System der Tetrarchie: Zwei Augusti adoptierten jeweils ihren Caesar, die dann Schwiegersöhne ihres Oberkaisers waren. Im Jahr 313 war es Licinius, der als „endgültiger Liquidator des diokletianischen Herrschaftssystems“ den Reichsteil des Maximinus Daia besetzte und mit dem Tod Daias nur Konstantin und Licinius als Augusti im Reich blieben.
Daia wurde als Sohn des Galerius adoptiert und im Jahr 305 von Diokletian zum Caesar ausgerufen. Während seiner Amtszeit ist eine enge Anbindung Daias an die Kaiser Diokletian, Maximian und Galerius erkennbar, in den Quellen redet er die beiden ersteren als Väter an.
Ziel der folgenden Arbeit soll es sein, die Person des Daia als Christenverfolger im östlichen Teil des Reiches zwischen 310 und 313 näher zu umschreiben und die Maßnahmen, die er im Umgang mit den Christen einleitete, aufzuführen. Hierbei empfiehlt sich eine chronologische Aufführung, um den Verlauf der Ereignisse besser darstellen zu können. Daneben erfolgt ein Bezug zur religiösen Situation im östlichen Reichsteil, die wohl ein Spezifikum innerhalb der Tetrarchie bildete. Eine Fokussierung auf die Ereignisse außerhalb des Reichsteils soll die Gesamtschau der Motive für die Christenverfolgung abrunden, denn de facto begannen die Christenverfolgungen um 303 während der Ersten Tetrarchie Diokletians.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Maßnahmen Daias gegen die Christen
- Die religiöse Situation im östlichen Reichsteil
- Der Verlauf der Christenverfolgungen im östlichen Reichsteil
- Sabinuszirkular
- Petitionswelle der Städte
- Wiederaufnahme der Verfolgungen
- Brief des Maximinus Daia an Sabinus
- Toleranzedikt des Maximinus Daia
- Schlussteil
- Quellen - und Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Person des Maximinus Daia, einem römischen Kaiser der Tetrarchie, und seinen Maßnahmen gegen die Christen im östlichen Reichsteil zwischen 310 und 313. Ziel ist es, die Christenverfolgungen in dieser Zeit chronologisch zu erfassen und die religiöse Situation im östlichen Reichsteil, die sich von anderen Reichsteilen unterschied, zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Motive für die Christenverfolgung und setzt die Ereignisse in den Kontext der Gesamtentwicklung der Christenverfolgung, die bereits während der Herrschaft Diokletians begann.
- Die religiöse Situation im östlichen Reichsteil und die Spannungen zwischen Christen und heidnischen Bürgern.
- Die Maßnahmen des Maximinus Daia gegen die Christen, insbesondere das Sabinuszirkular, die Petitionswelle der Städte und das Toleranzedikt.
- Die Rolle der städtischen Behörden und der Petitionen der Honoratioren in der Christenverfolgung.
- Die Auswirkungen der Christenverfolgung auf die Christen im östlichen Reichsteil.
- Der Einfluss der Außenpolitik und der Beziehungen zu anderen Kaisern (Konstantin, Licinius) auf die Christenpolitik des Maximinus Daia.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Person des Maximinus Daia als letzten Vertreter der Tetrarchie ein und beleuchtet seine enge Anbindung an die Kaiser Diokletian, Maximian und Galerius. Die Arbeit fokussiert sich auf die Maßnahmen des Daia gegen die Christen im östlichen Reichsteil zwischen 310 und 313, die chronologisch dargestellt werden. Die religiöse Situation im östlichen Reichsteil, die sich durch Spannungen zwischen Christen und heidnischen Bürgern auszeichnete, wird im ersten Kapitel beleuchtet.
Im zweiten Kapitel werden die Maßnahmen Daias gegen die Christen im Detail analysiert. Das Sabinuszirkular (Mai 311), das als Reaktion auf das Galeriusedikt (April 311) verfasst wurde, sollte die Inhalte des Edikt verbreiten und umsetzen. Die Petitionswelle der Städte ab Oktober 311, die sich gegen die Christen richtete, zeigt die starke heidnische Prägung der städtischen Oberschicht im Osten. Die Honoratioren forderten die Verhinderung der Errichtung christlicher Kultstätten, das Verbot christlicher Riten und die Vertreibung der Christen aus den Städten. Daia, der sich als überzeugter Heide positionierte, reagierte auf diese Petitionen und nahm die Christenverfolgungen wieder auf.
Der Brief des Maximinus Daia an den Statthalter Sabinus (312), in dem er sich für freie Religionsausübung und Gewaltverzicht gegenüber den Christen ausspricht, wird im vierten Kapitel analysiert. Diese plötzliche Toleranz lässt sich durch die außenpolitische Situation erklären. Castritius argumentiert, dass Daia durch einen Brief Konstantins, der auf seinen Sieg über Maxentius an der Milvischen Brücke Bezug nahm, erschreckt wurde. Der Brief Konstantins, der die Ergebnisse des Kaisertreffens in Mailand widerspiegelte, forderte Daia auf, die Bestimmungen des Galeriusediktes zu unterstützen und den Christen ihr beschlagnahmtes Vermögen zurückzugeben. Daia, der sich in einem Konflikt mit Licinius befand, konnte diese „Mailänder Vereinbarungen" jedoch nicht umsetzen.
Das Toleranzedikt des Maximinus Daia (Frühjahr 313), das den Christen weitgehende Toleranz zugestand, wird im fünften Kapitel behandelt. Das Edikt lässt sich als Reaktion auf die Bedrohung durch Licinius und als Versuch, Konstantin entgegenzukommen, interpretieren. Daia, der sich im Rückzug befand, sah in diesem Edikt einen Ausweg aus seiner schwierigen Situation.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Maximinus Daia, Christenverfolgung, Tetrarchie, östliches Reichsteil, religiöse Situation, Sabinuszirkular, Petitionswelle der Städte, Toleranzedikt, heidnischer Glaube, städtische Oberschicht, Honoratioren, Konstantin, Licinius, Mailänder Vereinbarungen.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Maximinus Daia?
Maximinus Daia war ein römischer Kaiser (305–313) und der letzte Vertreter des tetrarchischen Systems. Er herrschte über den östlichen Teil des Reiches und gilt als einer der letzten großen Christenverfolger.
Warum wurden die Christen im östlichen Reichsteil verfolgt?
Die religiöse Situation im Osten war durch starke Spannungen zwischen der heidnischen Oberschicht und den Christen geprägt. Daia sah sich als Bewahrer der traditionellen römischen Religion und reagierte auf Petitionen städtischer Honoratioren, die Maßnahmen gegen Christen forderten.
Was war das Sabinuszirkular?
Das im Mai 311 verfasste Zirkular war eine Reaktion auf das Galeriusedikt. Es sollte die Bestimmungen zur Religionsausübung im Sinne des Kaisers regeln, führte jedoch unter Daia bald zu einer Wiederaufnahme der Restriktionen gegen Christen.
Warum erließ Maximinus Daia 313 ein Toleranzedikt?
Das Edikt war eine taktische Reaktion auf die politische Bedrohung durch seine Mitkaiser Konstantin und Licinius. Daia versuchte, den Christen entgegenzukommen, um seine eigene Machtposition im Bürgerkrieg zu sichern.
Welchen Einfluss hatten städtische Petitionen auf die Verfolgungen?
Die städtischen Eliten forderten aktiv das Verbot christlicher Riten und die Vertreibung von Christen aus ihren Städten. Daia nutzte diese lokalen Stimmungen, um seine anti-christliche Politik zu legitimieren.
- Citar trabajo
- Robert Bräutigam (Autor), 2011, Die Maßnahmen M. Daias gegen die Christen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273378