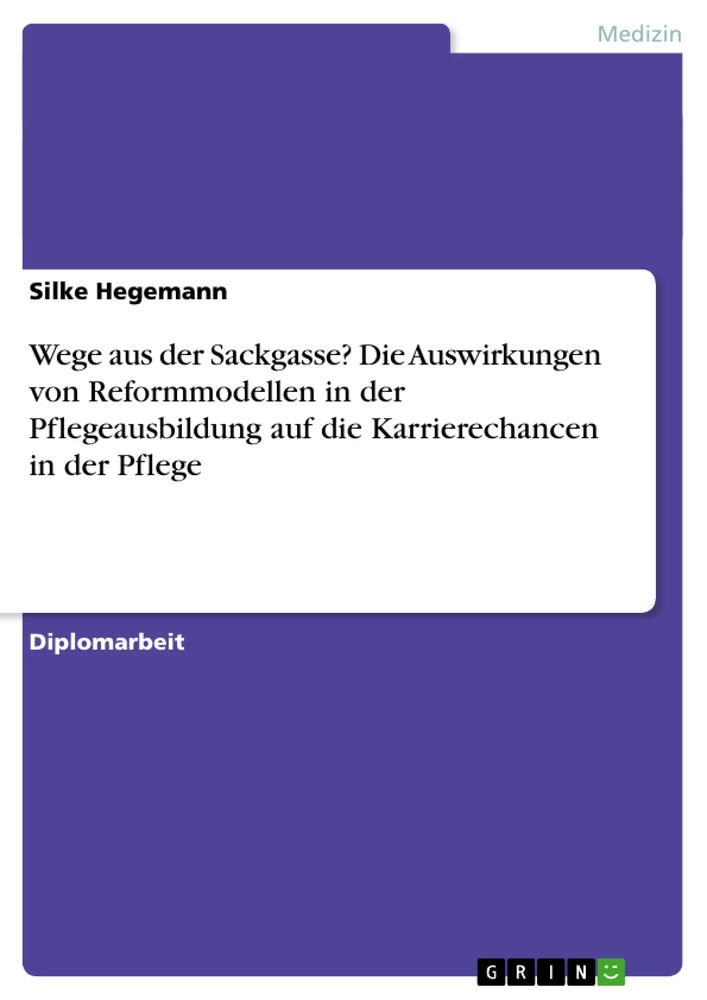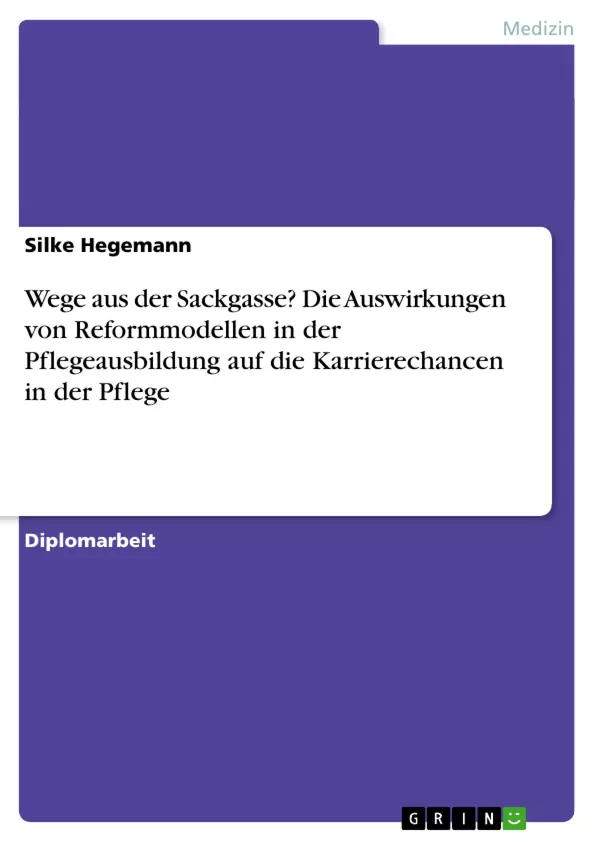Neben den Problemen, wie Überalterung der Bevölkerung und damit an-steigende Pflegebedürftigkeit, die Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie der modernen Medizin und die damit verbundenen ethischen, finanziellen und politischen Diskussionen, die unsere Gesellschaft allgemein und das Gesund-heitswesen im besonderen betreffen, sieht sich die Pflege noch mit weiteren, berufsspezifischen Problemen konfrontiert:
Schlecht bezahlt, gesellschaftlich kaum anerkannt, eine berufliche Sackgasse ohne Karrieremöglichkeiten – Pflegeberufe haben in dieser Hinsicht keinen guten Ruf.
Die Ansicht, Pflege sei eine typisch weibliche Tätigkeit, da die Fähigkeit für andere zu sorgen, sie zu pflegen den Frauen angeboren sei, entstand im 19. Jahrhundert und hat sich bis heute gehalten (Bischoff 1992, S.45ff). Laut Berufsbildungsbericht 2002 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) waren im Schuljahr 2001/2002 von 53.504 Auszubildenden in der Krankenpflege 43.562 Frauen, d.h. der Frauenanteil lag bei über 80% (BMBF 2002, S.330). Und auch heute spielt der Wunsch, anderen Menschen helfen zu wollen, eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für einen Pflegeberuf (Huber 2002, S.105), Gedanken an Karrieremöglichkeiten stehen erst an zweiter Stelle – Pflege gilt noch immer eher als Berufung, nicht als Beruf.
Professionalisierungsbemühungen, die Bedeutung der Pflegewissenschaft und die Akademisierung der Pflege werden häufig, auch von Pflegenden selbst, in Frage gestellt: Wozu Professionalisierung, wenn jede Frau nach kurzer Einarbeitung in der Lage ist, zu pflegen, wie der große Anteil von ungelernten Kräften in der Pflege zeigt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtlicher Überblick
- Die Pflege als Frauenberuf
- Die Entwicklung der Krankenpflege zum Beruf
- Die Entwicklung der Pflegeberuflichen Bildung
- Historische Entwicklung der Krankenpflegeausbildung von Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 60er Jahre
- Kampf um eine staatliche Regelung: 1906-1938
- Krankenpflegegesetz von 1938
- Krankenpflegegesetz von 1957
- Krankenpflegegesetz von 1965
- Bisheriger Stand der Ausbildung
- Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz von 1985
- Wichtige Regelungen
- Ausbildungsberührende Regeln
- Verbesserungen durch das KRPFLG von 1985
- Sonderstellung der Pflegeausbildung und deren Folgen: Karrierechancen in der Pflege
- Das neue Krankenpflegegesetz
- Änderungen
- Reformmodelle und ihre Auswirkungen
- Begründung für die Reformierung der Pflegeausbildung
- Ziele der Ausbildungsreform
- Rechtliche Grundlage
- Zur Auswahl der Modelle
- Robert Bosch Stiftung: Pflege neu denken
- Entwicklung des Modells
- Zukunftsvision
- Empfehlungen
- Das neue Ausbildungsmodell
- Kritik
- Modellversuch „Integrative Pflegeausbildung: Das Stuttgarter Modello“
- Ziele
- Ausbildungsprinzipien
- Der ModellaAusbildungsgang
- Auswirkungen
- UTA Oelke und Marion Menke: Gemeinsame Pflegeausbildung
- Entwicklung des Modells
- Aufbau des Modells
- Beteiligte Einrichtungen
- Übergeordnete Bildungsziele
- Stufenaufbau und Wechselmöglichkeit
- Theoretische Ausbildung
- Praktische Ausbildung
- Examen
- Evaluation des Modells
- Zusammenfassung der Auswirkungen
- Auswirkungen auf die Qualifikation der Auszubildenden
- Auswirkungen auf die Karrierechancen in der Pflege
- Konsequenzen
- Selbstreflexion
- Normalisierung
- Duales System oder Berufsfachschule?
- Duales System und Berufsbildungsgesetz
- Landesschulrecht und Berufsfachschulen
- Professionalisierung
- Gründe für Professionalisierung
- Kennzeichen einer Profession
- Kritik an Professionalisierungsbemühungen
- Zusammenfassung
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt der Pflegeberuf oft als „berufliche Sackgasse“?
Pflegeberufe leiden unter einem schlechten Ruf aufgrund schlechter Bezahlung, geringer gesellschaftlicher Anerkennung und bisher begrenzter Karrieremöglichkeiten im Vergleich zu akademischen Berufen.
Was sind die Ziele der Reformmodelle in der Pflegeausbildung?
Ziele sind die Professionalisierung, die Verbesserung der Qualität durch Pflegewissenschaft und die Schaffung besserer Karrierechancen durch neue Ausbildungsstrukturen (z. B. integrative Ausbildung).
Was ist das „Stuttgarter Modell“ der Pflegeausbildung?
Es handelt sich um einen Modellversuch zur integrativen Pflegeausbildung, der die verschiedenen Pflegebereiche (Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege) enger verzahnt.
Welche Rolle spielt die Akademisierung der Pflege?
Die Akademisierung soll die Pflege als eigenständige Profession stärken und neue Tätigkeitsfelder in Forschung, Lehre und Management eröffnen.
Wie hoch ist der Frauenanteil in der Pflegeausbildung?
Historisch bedingt ist der Frauenanteil sehr hoch; laut Berufsbildungsbericht 2002 lag er bei über 80% der Auszubildenden.
- Citar trabajo
- Silke Hegemann (Autor), 2004, Wege aus der Sackgasse? Die Auswirkungen von Reformmodellen in der Pflegeausbildung auf die Karrierechancen in der Pflege, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27338