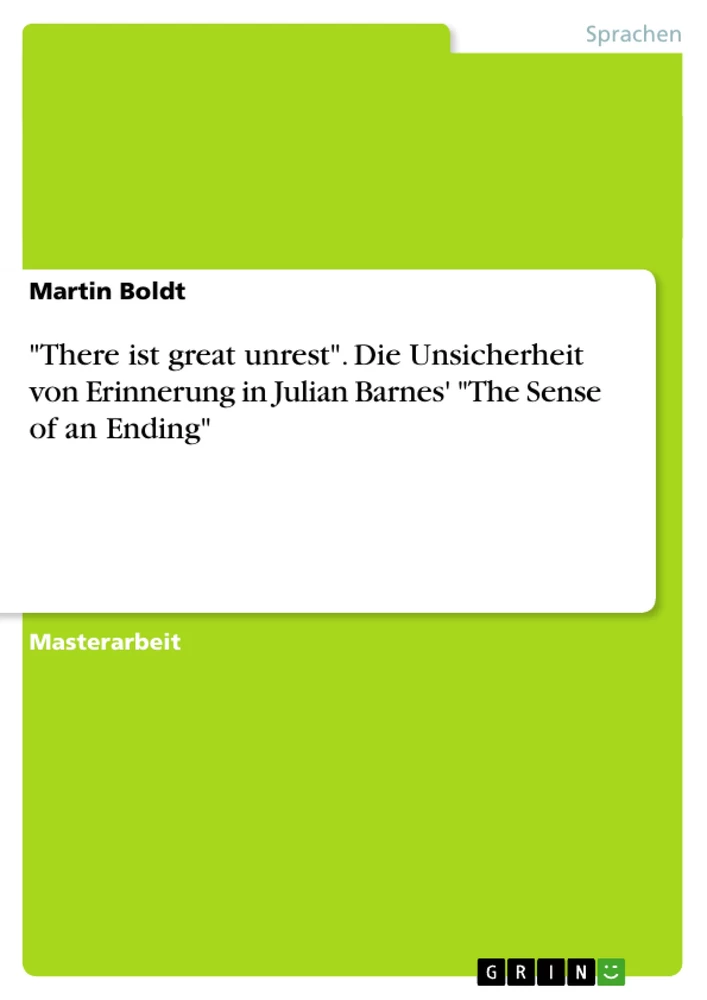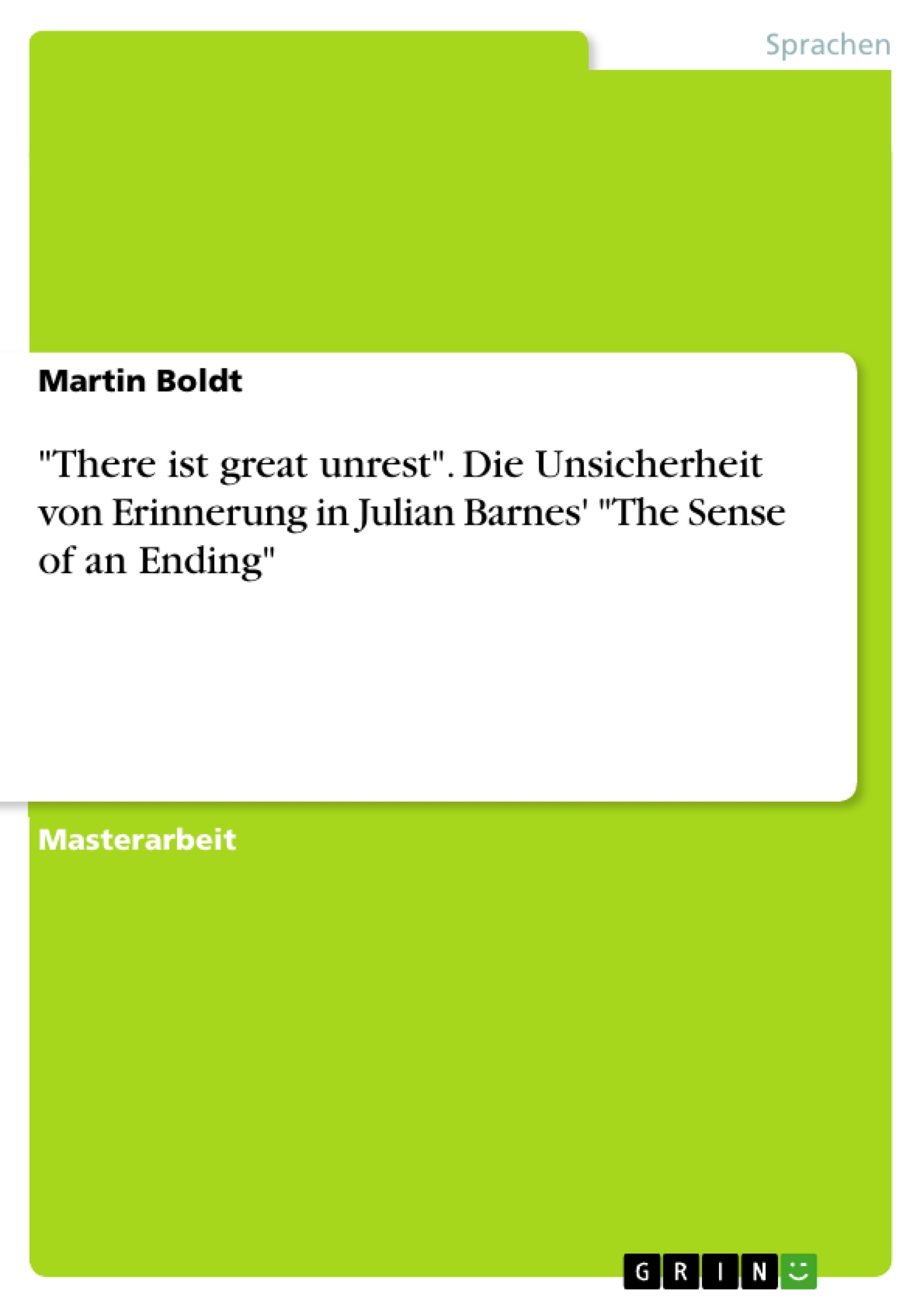Die Gegenwart ist nicht fassbar, jeder Moment, den wir durchleben, ist sogleich Teil der Vergangenheit. Der Mensch lebt in der ständigen Unstetigkeit zwischen Gegenwart und
Vergangenheit. Er lebt in Erinnerungen. Nur sie machen es uns möglich, die Bedeutung des Jetzt zu erkennen und Pläne für das Morgen zu machen. Sie definieren uns als das, was
wir sind; oder besser: wir definieren uns als das, was wir sind, indem wir aus der Masse der Erfahrungen jene selektieren, die unsere Erinnerungen konstituieren. Doch wie
funktioniert dieser Selektionsprozess? Oder sind wir ihm gar vollkommen ausgeliefert? Sind wir Herr über unsere Lebensgeschichte?
Eine Annäherung an diese Fragen soll in Kapitel 1 der vorliegenden Arbeit erfolgen. Dabei wird von zentraler Bedeutung sein, ein Verständnis dafür aufzubauen, wie die Erschaffung
von Erinnerungen in der menschlichen Psyche vonstatten geht. Von immenser Bedeutung ist dabei, wie Erinnerungen verknüpft und somit Lebensnarrative erst möglich werden. Erfahrungen sind dabei nicht einfach nur ein Fluss in unserer mentalen Repräsentation, vielmehr organisieren wir sie in Bezug auf andere Erfahrungen und die Außenwelt. Wir sind demnach „constructive agents“, die sich zu ihren Erfahrungen in eine Beziehung setzen.
Die Verknüpfung der vorgängigen Gedanken mit Fragen literaturwissenschaftlicher Untersuchungen führt zwangsläufig zum Genre der Autobiographie, zur Frage, wie
Autobiographien hinsichtlich ihrer Leistung im Rahmen der Selbstnarrationen von Menschen einzuordnen sind.
Die Wirklichkeit ist ebenso durch Gedanken und Gefühle von Individuen gestaltet als auch durch die materielle Umgebung. Erfahrungen sind demnach keine der Realität unterworfene
Entität, sondern müssen im Zuge einer Wissenschaft mit der physischen Realität gleichauf sein. Der Unterschied besteht lediglich in der Erfahrbarkeit: Während die materielle Welt
jedem zugänglich ist, ist die der Erfahrung in erster Linie nur dem Erfahrenden zugänglich.
Um diese Erfahrung zugänglich zu machen, erfordert es eine narrative Konfiguration, um dem Außenstehenden Zugang zu diesen Erlebnissen zu gewähren. Der Komplex von Erfahrungen
muss also in eine kulturell konventionalisierte Form gebracht werden, also in Zeichen oder Sprache. Dass der Beitrag von Autobiographien im Kulturkontext nicht auf einer faktualen
Widerspiegelung der Vergangenheit beruht, wird in Kapitel 2 behandelt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- O. EINLEITUNG
- 1. AUTOBIOGRAPHISCHES ERINNERN
- 1.1 DER (RE-)KONSTRUKTIVE CHARAKTER VON ERINNERUNGEN
- 1.2. EPISODISCHE KONSTRUKTION DES PERSÖNLICHEN MYTHOS
- 2. AUTOBIOGRAPHIE, FAKTIZITÄT UND WAHRHEIT
- 2.1. OBJEKTIVE AUTOBIOGRAPHISCHE WAHRHEIT
- 2.2. DIE INNERE WAHRHEIT DES AUTOBIOGRAPHEN
- 3. DIE AUFLÖSUNG FAKTUALER HISTORIOGRAPHIE: HAYDEN WHITE
- 4. DIE FIKTIVE AUTOBIOGRAPHIE
- 4.1. BEGRIFFSBESTIMMUNG
- 4.2. AUFLÖSUNG VON REFERENZIALITÄT: DER ICH-ERZÄHLER
- 4.3. PRODUKTIVE AUFNAHME TRADITIONELLER MUSTER: PARODIE
- 5. JULIAN BARNES' THE SENSE OF AN ENDING
- 5.1. DIE REKONSTRUKTION EINER LEBENSEPISODE
- 5.1.1. ROBSONS UND ADRIANS SUIZID
- 5.1.2. ERZWUNGENE MODIFIKATION DES LEBENSNARRATIVS
- 5.2. TEXT ALS SELBSTKOMMENTAR
- 5.2.1. METADISKURS I: KONSTRUKTION VON LEBENSGESCHICHTE
- 5.2.2. METADISKURS II: HISTORIOGRAPHIE
- 5.1. DIE REKONSTRUKTION EINER LEBENSEPISODE
- 6. ZUSAMMENFASSUNG
- 7. LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Unsicherheit von Erinnerung in Julian Barnes' The Sense of an Ending, indem sie die Frage nach der Rekonstruktion und Umdeutung von Lebensereignissen im Kontext der fiktiven Autobiographie untersucht. Sie analysiert, wie der Protagonist Tony Webster eine Episode aus seiner Vergangenheit konstruiert und diese im Verlauf des Romans aufgrund neuer Informationen revidiert. Die Arbeit beleuchtet dabei die Grenzen von Erinnerung und die Problematik der objektiven Geschichtsschreibung.
- Die Konstruktion und Dekonstruktion von Lebensnarrativen
- Die Unsicherheit von Erinnerung und die Grenzen von Faktizität
- Die Rolle des unzuverlässigen Erzählers in der fiktiven Autobiographie
- Die Problematik der objektiven Geschichtsschreibung und die Bedeutung von Perspektivität
- Die Funktion von Metafiktion und Parodie in der postmodernen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor, nämlich die Funktionsweise von Erinnerungen und die Bedeutung von Lebensnarrativen für die menschliche Identität. Sie führt in die Problematik der Konstruktion von Erinnerungen und den Einfluss dieser auf die Selbstwahrnehmung ein.
Kapitel 1 beleuchtet den (Re-)konstruktiven Charakter von Erinnerungen und die episodische Struktur von Lebensnarrativen. Es werden die Erkenntnisse der narrativen Psychologie herangezogen, um zu verdeutlichen, wie Erinnerungen selektiv abgerufen und zu kohärenten Geschichten zusammengefügt werden.
Kapitel 2 analysiert die Autobiographie als Genre und hinterfragt den Anspruch auf objektive Wahrheit. Es werden verschiedene Ansätze zur Autobiographie diskutiert, die von der Annahme einer faktualen Darstellung bis hin zur Betonung der subjektiven Wahrheit reichen.
Kapitel 3 untersucht die Thesen Hayden Whites zur Dekonstruktion faktualer Geschichtsschreibung. Es wird gezeigt, wie die Narrativität von historischen Texten die Objektivität in Frage stellt und die Bedeutung von literarischen Schreibweisen für die Darstellung der Vergangenheit hervorhebt.
Kapitel 4 definiert die fiktive Autobiographie als eine literarische Form, die die Grenzen zwischen Fiktion und Faktizität auflöst. Es wird die Bedeutung des Ich-Erzählers und die Funktion von Metafiktion und Parodie in diesem Genre beleuchtet.
Kapitel 5 analysiert Julian Barnes' The Sense of an Ending. Es wird gezeigt, wie der Protagonist Tony Webster eine Episode aus seiner Vergangenheit konstruiert und diese im Verlauf des Romans aufgrund neuer Informationen revidiert. Die Analyse beleuchtet die Unsicherheit von Erinnerung und die Unzuverlässigkeit des Erzählers.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Unsicherheit von Erinnerung, die Konstruktion von Lebensnarrativen, die fiktive Autobiographie, den unzuverlässigen Erzähler, die Problematik der objektiven Geschichtsschreibung und die Bedeutung von Perspektivität. Die Arbeit analysiert, wie die Vergangenheit in der Literatur konstruiert und dekonstruiert wird und welche Auswirkungen dies auf die Selbstwahrnehmung des Individuums hat.
Häufig gestellte Fragen
Welches literarische Werk steht im Mittelpunkt dieser Analyse?
Die Arbeit analysiert den Roman "The Sense of an Ending" (Vom Ende einer Geschichte) von Julian Barnes.
Was ist das Hauptthema der Untersuchung?
Das zentrale Thema ist die Unsicherheit von Erinnerung und die daraus resultierende Problematik bei der Konstruktion von Lebensnarrativen.
Wer ist der Protagonist des Romans?
Der Protagonist ist Tony Webster, der eine Episode aus seiner Vergangenheit rekonstruiert und später aufgrund neuer Informationen revidieren muss.
Welche Rolle spielt die Theorie von Hayden White in der Arbeit?
Die Arbeit nutzt Whites Thesen zur Dekonstruktion faktualer Historiographie, um die Grenzen objektiver Geschichtsschreibung aufzuzeigen.
Was wird unter einer "fiktiven Autobiographie" verstanden?
Es handelt sich um eine literarische Form, die die Grenzen zwischen Fiktion und Faktizität auflöst, oft durch den Einsatz eines unzuverlässigen Ich-Erzählers.
Wie funktioniert der Prozess des autobiographischen Erinnerns laut der Arbeit?
Erinnerungen haben einen re-konstruktiven Charakter; sie werden selektiv abgerufen und zu einem "persönlichen Mythos" zusammengefügt.
- Citar trabajo
- Martin Boldt (Autor), 2014, "There ist great unrest". Die Unsicherheit von Erinnerung in Julian Barnes' "The Sense of an Ending", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273468