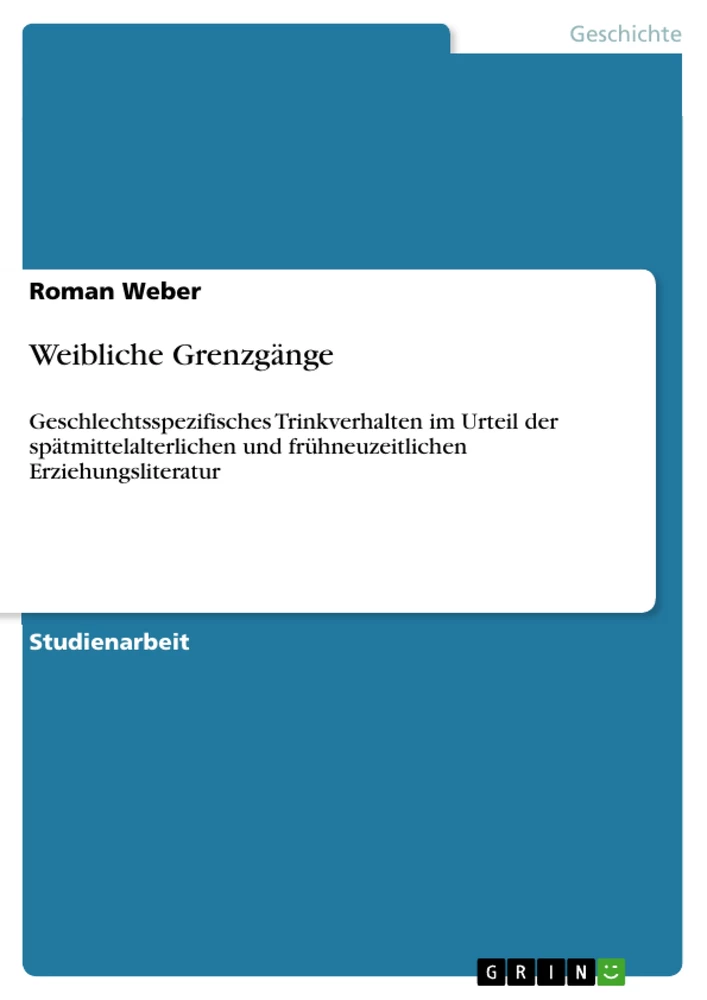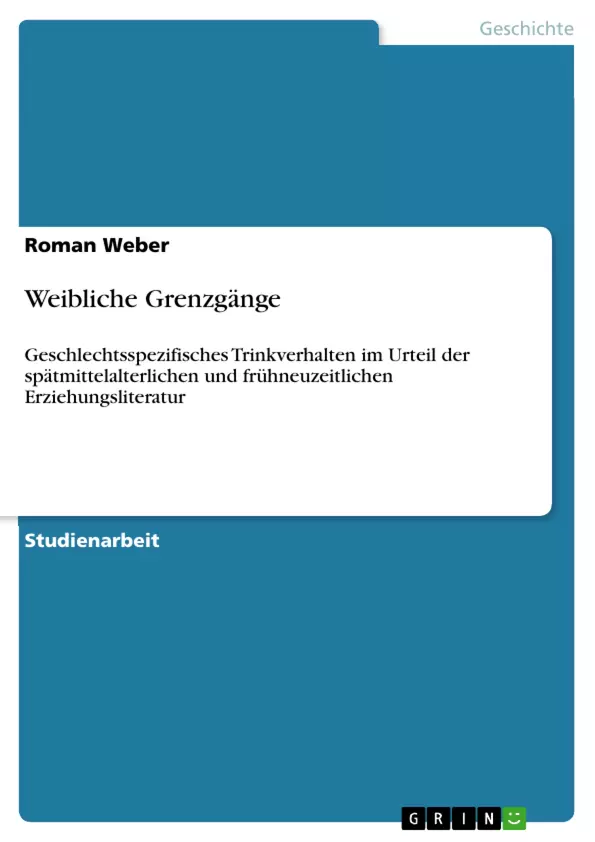Trinken und Trunkenheit sind kulturelle Merkmale, die Einblicke in gesellschaftliche Wertvorstellungen ermöglichen. In der Beurteilung des Trinkens und der Bewertung von Trunkenheit widerspiegeln sich allgemeine gesellschaftliche Normen, die Handlungsformen in zeitgenössischen Geschlechterrollen definieren. Infolgedessen werden im Umgang mit Alkohol asymmetrische Geschlechterverhältnisse und traditionelle Rollenzuschreibungen sichtbar. Wie Zeitgenossen weibliches und männliches Trinkverhalten bewerten und wahrnehmen, hängt von den tradierten geschlechtstypischen Verhaltensmustern ab. Insofern offenbaren Akzeptanz oder Ablehnung einem bestimmten Verhalten gegenüber unterschiedliche Bewertungskonzepte, die auf geschlechtsspezifischen Kategorisierungen beruhen. D.h., dass die Geschlechterrolle als Summe von Verhaltenserwartungen verstanden werden kann, die kulturell geprägt sind. Weil sich in den Beurteilungen von Trinken und Trunkenheit allgemeingültige gesellschaftliche und soziale Wertmassstäbe reflektieren, können wir, um die Worte Martins zu bemühen, durch das Prisma eines Weinglases eine Menge über gesellschaftliche Wertordnungen und Verhaltensnormen erfahren. Zeitgenössische Vorstellungen des Zusammenlebens und des sozialen Gefüges wirken demnach auf das Trinkverhalten ein, auch wenn man, wie Simmel treffend sinnierte, nur als Einzelner trinken und essen könne. In Simmels Betrachtung trennen Essen und Trinken eher, als dass sie soziale Elemente darstellten. Dennoch sind Tischsitten und Trinkrituale, Vorlieben und Schamschwellen sowie Formen des geselligen Trinkens Ausdruck sozialer Übereinkommen. Sie zeigen zudem die Angewiesenheit des Menschen auf soziale Steuerung und Anerkennung an. In der Ordnung des Trinkens spiegeln sich demnach komplexe soziale Bindungen. So gesehen handelt es sich bei der Ungleichheit beim Essen und Trinken um eine ganz spezifische Form paternalistischer Herrschaftsordnung, wie sie sich im zeitgenössischen System der Stände- und Feudalgesellschaft des Mittelalters und der Frühen Neuzeit ausbilden konnte. Blieb beispielsweise einer Ehefrau der Besuch einer Gaststätte verwehrt, hatte dies alleine mit den zeitgenössischen Moral- und Sittenauffassungen zu tun, die jedem Individuum der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft einen bestimmten Platz und einen bestimmten Rang in der Ständepyramide zuwies. Diesbezüglich wurden die Handlungen der Frau stets mit Misstrauen verfolgt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Forschungsstand
- Disposition
- Hauptteil
- Von der Natur des Körpers
- Trinken und Trunkenheit in zeitgenössischer Bewertung
- Weibliche Grenzgänge
- Orte männlicher und weiblicher Sozialisation
- Schlussteil
- Bibliographie
- Gedruckte Quellen
- Darstellungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das geschlechtsspezifische Trinkverhalten im Urteil der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Erziehungsliteratur. Sie analysiert, wie die Gesellschaft den Konsum alkoholhaltiger Getränke wertete, welche Rolle Trinken bei der Konstituierung von weiblichen und männlichen Identitäten spielte und welche Gefahren daraus für die zeitgenössische Geschlechterhierarchie sowie für die traditionelle Rollenzuschreibung resultierten. Die Arbeit basiert auf einer Diskursanalyse, die die Gedanken- und Werthorizonte der damaligen Zeit beleuchtet.
- Die Rolle des Alkoholkonsums bei der Konstituierung von Geschlechterrollen
- Die Bewertung von weiblichem und männlichem Trinkverhalten in der Erziehungsliteratur
- Die Bedeutung von Orten der Sozialisation für das geschlechtsspezifische Trinkverhalten
- Die Verbindung von Trunkenheit mit sexueller Zügellosigkeit und gesellschaftlichem Verfall
- Die Konstruktion von Geschlechterstereotypen durch Sprichwörter und Traktate
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des geschlechtsspezifischen Trinkverhaltens im Urteil der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Erziehungsliteratur ein. Sie stellt die Fragestellung der Arbeit vor, beleuchtet den Forschungsstand und skizziert die Disposition der Arbeit.
Im ersten Teil des Hauptteils werden mittelalterliche Konzepte über die weibliche und männliche Natur auf Basis der antiken Humoralpathologie analysiert. Die These der Temperamentsgrade der Geschlechter wurde von mittelalterlichen Anatomen dazu herangezogen, das Geheimnis des Sexualdimorphismus zu ergründen. Dabei wird der zweitrangige Status der Frau, der bereits durch den Schöpfungsakt, durch Sündenfall und befohlene Unterordnung der Frau unter den Mann erklärt worden ist, hervorgehoben.
Im zweiten Teil des Hauptteils wird das Trinkverhalten in der zeitgenössischen Bewertung beleuchtet. Die gesundheitsschädliche Wirkung von Bier und Wein wurde bereits in der Antike thematisiert. Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit kam eine Vielzahl von Streitschriften, Traktaten und Predigten gegen das übermässige Trinken in Umlauf. Die Folgen der Trunkenheit wurden von Autoren wie Sebastian Franck in den dunkelsten Farben ausgemalt.
Der dritte Teil des Hauptteils widmet sich den weiblichen Grenzgängen. Das ungebührliche Benehmen einer Frau wurde als Herausforderung der männlichen Autorität und der natürlichen Ordnung der Dinge in einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur angesehen. Frauen, die sich dem Wein- und Bierkonsum hingaben, drangen in zwei tabuisierte Bereiche ein: die Aufweichung der reinen Männerdomäne und das Anzeigen einer starken weiblichen Persönlichkeit. Die weibliche Trunkenheit wurde in Sprichwörtern und Redewendungen häufig in scharfem Gegensatz zu männlichen Verhaltensnormen gezeichnet.
Der vierte Teil des Hauptteils untersucht die Orte männlicher und weiblicher Sozialisation. Das Wirtshaus wurde in der kulturgeschichtlichen Forschung vielfach als Auslöser von Gewalt betrachtet, doch es diente auch der Knüpfung und Wiederherstellung sozialer Beziehungen. Das Wirtshaus bildete einen Mittelpunkt geselliger Runden, in denen lebhaft diskutiert werden konnte, doch es wurde auch als Hort teuflischer Pläne typisiert. Das gemeinsame Essen und Trinken wurde als männliche Identitätsbildung und als wichtiger Eckpfeiler in der Sozialisation junger Männer angesehen. Die Gaststätte wurde jedoch auch als Schauplatz von sexuellen Kontaktversuchen und von Ehrverletzungen gesehen.
Der Schlussteil fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zeigt auf, dass die Beurteilung des Trinkens und die Bewertung von Trunkenheit zur Herstellung und Wiederherstellung geschlechtsspezifischer Rollenmuster, ständischer Kontraste und kollektiver Selbstbehauptung dienten. Die Arbeit hebt hervor, dass weibliches Trinken und die weibliche Betrunkene grösserer gesellschaftlicher Ächtung ausgesetzt waren und das weibliche Geschlecht einem obrigkeitlichen Paternalismus ausgeliefert war, der auf antiken und mittelalterlichen Vorstellungen gründete.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das geschlechtsspezifische Trinkverhalten, die Erziehungsliteratur des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit, die Rolle von Alkohol bei der Konstituierung von Geschlechterrollen, die Bewertung von Trunkenheit, die Orte männlicher und weiblicher Sozialisation, die Humoralpathologie, die Geschlechterhierarchie, die traditionelle Rollenzuschreibung, die Konstruktion von Geschlechterstereotypen, Sprichwörter und Traktate, das Wirtshaus und die gesellschaftliche Ächtung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde weibliches Trinken im Mittelalter bewertet?
Weibliches Trinken galt als Herausforderung der männlichen Autorität und wurde oft mit sexueller Zügellosigkeit und gesellschaftlichem Verfall assoziiert.
Was ist die Humoralpathologie?
Es ist die antike Säftelehre, die im Mittelalter genutzt wurde, um die unterschiedliche "Natur" von Mann und Frau sowie deren Temperamente zu erklären.
Welche Rolle spielte das Wirtshaus für die Geschlechter?
Das Wirtshaus war primär ein Ort männlicher Sozialisation und Identitätsbildung. Frauen war der Besuch oft aus moralischen Gründen verwehrt oder sie wurden dort misstrauisch beobachtet.
Warum galt Trunkenheit bei Frauen als schlimmer?
Während männliche Trunkenheit teils als gesellig akzeptiert wurde, sahen Zeitgenossen in betrunkenen Frauen eine Aufweichung der Geschlechterhierarchie und eine Verletzung der Schamschwelle.
Was verraten Tischsitten über die Gesellschaft?
Trinkrituale und Vorlieben sind Ausdruck sozialer Übereinkommen und spiegeln die hierarchische Ordnung der Stände- und Feudalgesellschaft wider.
- Citar trabajo
- Master of Arts UZH Roman Weber (Autor), 2012, Weibliche Grenzgänge, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273628