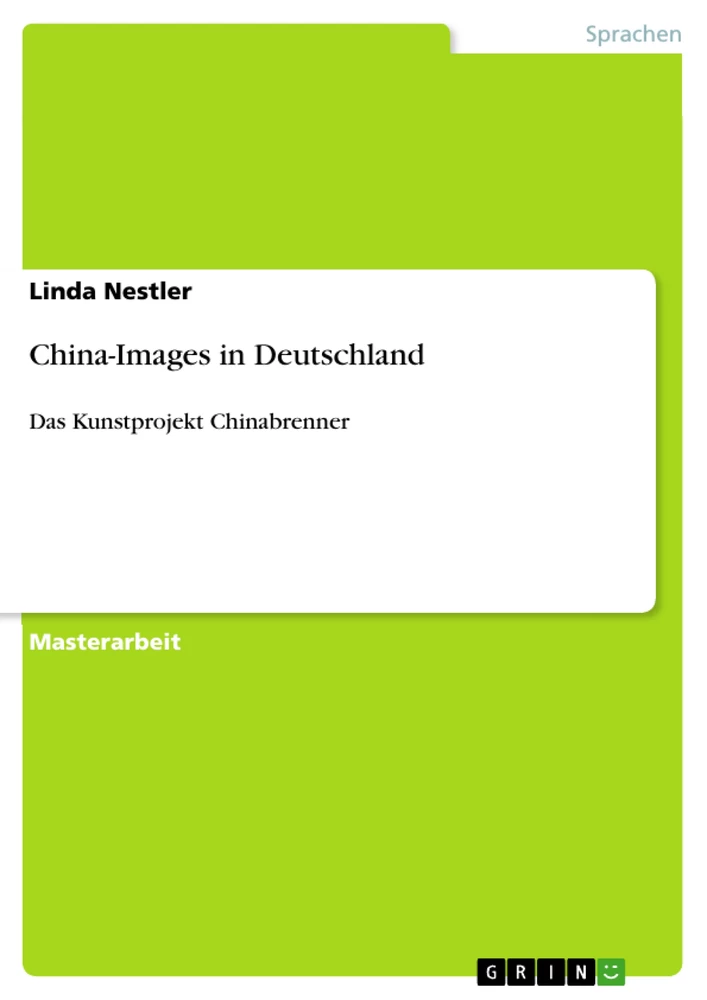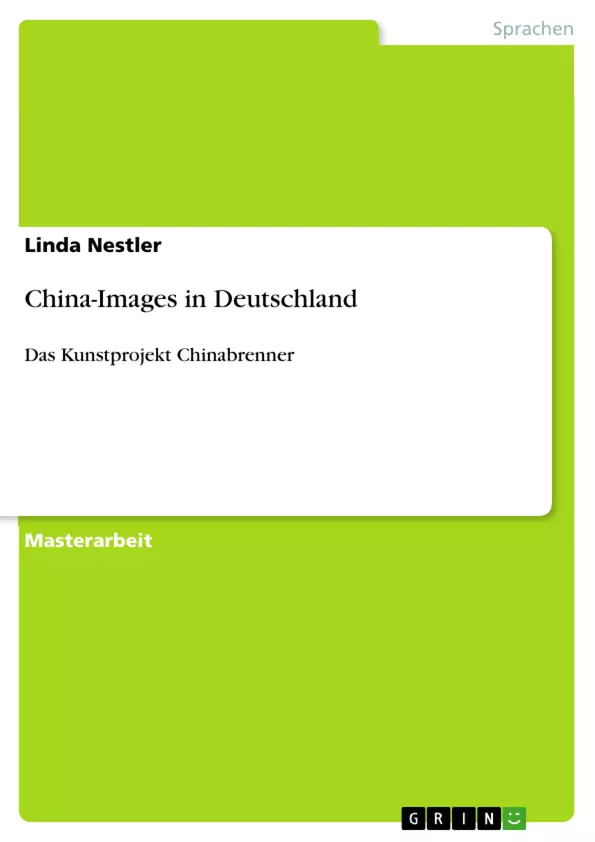Die Arbeit widmet sich der Untersuchung des Images von China in Deutschland. China-Images sind dabei als subjektiv geprägte Vorstellungen und Ideen zu verstehen, die mit China in Verbindung gebracht werden. Es stellt sich daher die Frage, aus welchen Gründen welche China-Images am häufigsten geteilt werden. Deshalb sollen hier mittels psychologischer und soziologischer Image-Theorien häufig geteilte China-Images im Kunstprojekt Chinabrenner in Leipzig untersucht werden.
Dazu soll zunächst untersucht werden, wie Images entstehen, wie sie strukturiert sind und welche Wirkung sie haben. Es werden Theorien und Konzepte herangezogen, die sich an der Schnittstelle zwischen Soziologie und Psychologie bewegen. So können der Begriff, die Entstehung, die Struktur und die Wirkung von Images hinterfragt werden.
Das Kernstück der Arbeit bildet jedoch die Auswertung empirischer Erhebungen. Die qualitative Forschung geschieht durch offene Gespräche mit Gästen und Mitarbeitern im Kunstprojekt Chinabrenner. Hinzukommen quantitative Erhebungen aus der Huawei-Studie zum Thema „Deutschland und China – Wahrnehmung und Realität“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Ziel
- Theoretischer Hintergrund
- Methodik und Vorgehensweise
- Image-Theorien
- Versuch einer Begriffsdefinition
- Entstehung von Images
- Sigmund Freuds psychoanalytischer Beitrag zur Image-Forschung
- Aktuelle psychologische Forschungsansätze zur Image-Entstehung
- Soziologische Theorien zur Image-Entstehung
- Aufbau und Struktur von Images
- Wirkung von Images
- Methodik: Die empirische Sozialforschung
- Qualitative Methoden
- Die teilnehmende Beobachtung
- Das ero-epische Gespräch
- Quantitative Methoden
- Schritte der Image-Analyse nach Gerhard Kleinings Bedeutungsanalyse
- Praxis: Eine Bedeutungsanalyse von gesammelten China-Images im Kunstprojekt Chinabrenner im Abgleich mit der Huawei-Studie
- Die Befragungssituation: Eine Vorstellung des Kunstprojekts Chinabrenner
- Über Die Huawei-Studie
- Die Befragungen: Häufig geteilte China-Images von Mitarbeitern und Gästen des Chinabrenners im Abgleich mit der Huawei-Studie
- Kontakte der Befragten mit China
- Politische China-Images
- Wirtschaftliche China-Images
- Kulturelle China-Images
- Eine Analyse der geteilten China-Images hinsichtlich ihrer Entstehung und Struktur
- Die soziale Wirkung der geteilten China-Images
- Schluss
- Anhang
- Gesprächsverzelchnis
- Gesprächsprotokolle
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Untersuchung von China-Images im Kontext des Kunstprojekts Chinabrenner in Leipzig. Sie analysiert, welche China-Images von den Mitarbeitern und Gästen des Chinabrenners am häufigsten geteilt werden und bewertet diese mithilfe psychologischer und soziologischer Image-Theorien. Die Arbeit geht dabei insbesondere auf die Entstehung, Struktur und Wirkung von Images ein.
- Entstehung von China-Images: Die Arbeit beleuchtet, wie China-Images bei Individuen entstehen, indem sie sowohl psychologische als auch soziologische Faktoren berücksichtigt. Dazu werden die Theorien von Sigmund Freud, Trigant Burrow und Gerhard Kleining sowie aktuelle Ansätze von Günter Bentele und Reinhold Bergler herangezogen.
- Struktur von China-Images: Die Arbeit untersucht, welche strukturellen Merkmale China-Images auszeichnen, insbesondere die Aspekte Nähe und Stabilität. Dabei werden die Theorien von Gerhard Kleining, Hans-Peter Dreitzel, Günter Bentele und Walter Lippmann in Bezug gesetzt.
- Wirkung von China-Images: Die Arbeit analysiert, welche Wirkung China-Images auf das soziale Verhalten der Befragten haben. Dazu werden die Theorien von Gerhard Kleining, Hans-Peter Dreitzel, York Kautt und Walter Lippmann im Hinblick auf die Entlastung und Orientierungsfunktion von Images diskutiert.
- Abgleich mit der Huawei-Studie: Die Arbeit vergleicht die im Chinabrenner gewonnenen China-Images mit den Ergebnissen der repräsentativen Huawei-Studie zum Thema Deutschland und China, um die soziale Verbreitung und Bedeutung der geteilten China-Images zu beleuchten.
- Einfluss des Chinabrenners als Befragungsort: Die Arbeit untersucht, welchen Einfluss der Chinabrenner als Befragungsort auf die China-Images der Befragten hat.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und das Ziel der Arbeit dar. Sie beschreibt die Forschungsfrage, welche China-Images von Mitarbeitern und Gästen des Chinabrenners am häufigsten geteilt werden. Außerdem werden der theoretische Rahmen und die methodische Vorgehensweise der Arbeit erläutert.
Kapitel 2 widmet sich der Image-Debatte aus verschiedenen Wissenschaftszweigen. Es werden verschiedene Theorien zur Entstehung, Struktur und Wirkung von Images vorgestellt, insbesondere die Theorien von Gerhard Kleining und Hans-Peter Dreitzel. Außerdem werden aktuelle Ansätze aus der Markt- und Medienforschung sowie die Bedeutung des Begriffs Stereotyp im Zusammenhang mit Images diskutiert.
Kapitel 3 beschreibt die empirische Sozialforschung, die Grundlage für die Untersuchung der China-Images bildet. Es werden die Methoden der quantitativen und qualitativen Sozialforschung erläutert, insbesondere die teilnehmende Beobachtung und das ero-epische Gespräch. Außerdem wird die Bedeutungsanalyse nach Gerhard Kleining als Hauptinstrument für die Analyse der gesammelten China-Images vorgestellt.
Kapitel 4 stellt die Ergebnisse der Bedeutungsanalyse von gesammelten China-Images im Chinabrenner im Abgleich mit der Huawei-Studie vor. Es werden die Befragungssituationen im Chinabrenner und in der Huawei-Studie vorgestellt sowie die häufig geteilten China-Images der Befragten im Chinabrenner in den Bereichen Kontakte mit China, Politik, Wirtschaft und Kultur gruppiert. Die Arbeit analysiert die geteilten China-Images hinsichtlich ihrer Entstehung und Struktur und untersucht die soziale Wirkung der geteilten China-Images.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen China-Images, Kunstprojekt Chinabrenner, Image-Theorien, Entstehung, Struktur, Wirkung, qualitative und quantitative Methoden, Bedeutungsanalyse, Huawei-Studie, Deutschland und China, Wahrnehmung und Realität, Kontakte mit China, politische, wirtschaftliche und kulturelle China-Images, soziale Wirkung.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstehen China-Images in Deutschland?
Images entstehen durch eine Mischung aus individueller Wahrnehmung, soziologischen Faktoren und medialer Berichterstattung, oft als Stereotype zur Orientierung.
Was ist das Kunstprojekt „Chinabrenner“?
Ein Projekt in Leipzig, das als Befragungsort diente, um qualitative Daten über die China-Bilder von Gästen und Mitarbeitern zu sammeln.
Welche Ergebnisse liefert die Huawei-Studie?
Die repräsentative Studie vergleicht Wahrnehmung und Realität in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur zwischen Deutschland und China.
Welche Rolle spielen Stereotype bei der Image-Bildung?
Stereotype dienen der Entlastung und Orientierung in einer komplexen Welt, können aber auch die objektive Wahrnehmung der Realität verzerren.
Wie wirken sich China-Images auf das soziale Verhalten aus?
Images beeinflussen die Offenheit gegenüber chinesischen Produkten, politischen Entscheidungen und interkulturellen Kontakten.
- Citar trabajo
- Linda Nestler (Autor), 2013, China-Images in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273636