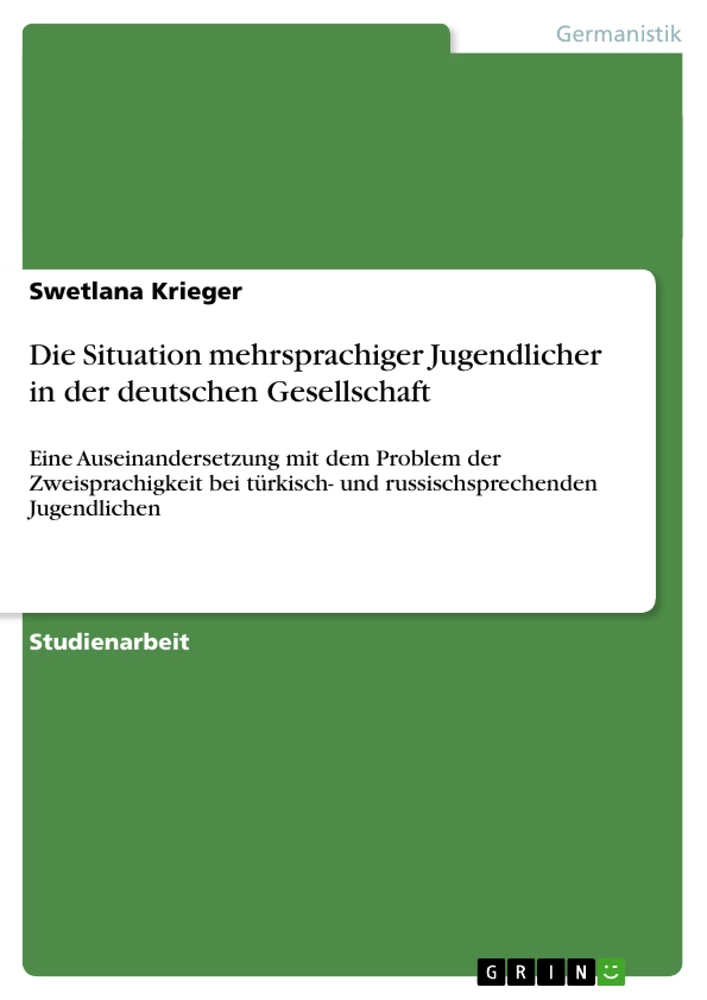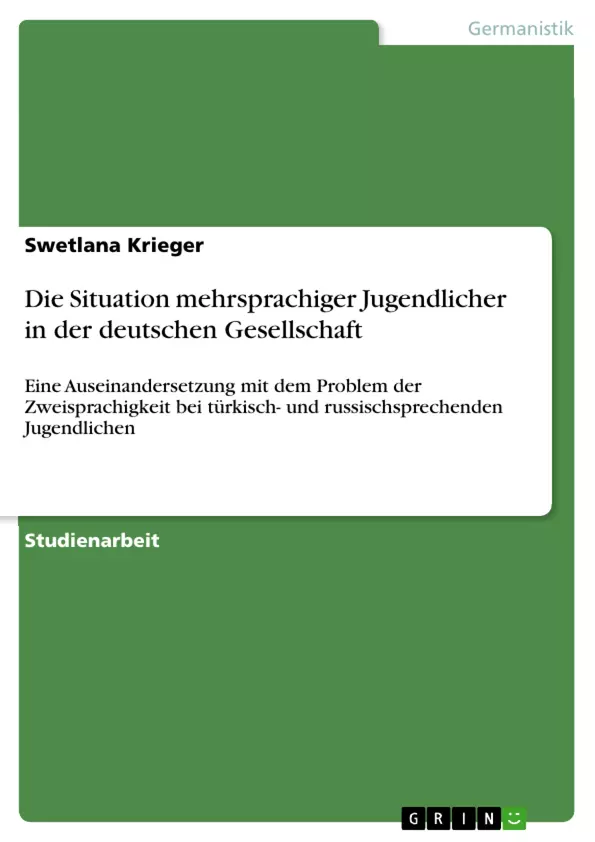Als junge Aussiedlerin verkehre ich seit meiner Kindheit in den Kreisen von Meinesgleichen. Dabei fällt mir immer wieder auf, dass sowohl erwachsene als auch jugendliche Aussiedler die deutsche und die russische Sprache miteinander verknüpfen.
Ich finde das sehr interessant und habe beschlossen, der Sache genauer auf den Grund gehen. Zunächst versuchte ich selbst zu überlegen, warum sie die beiden Sprachen miteinander vermischen und von Sprache zu Sprache „springen“ und kam zu dem Ergebnis: Die Aussiedlerjugendlichen sprechen gemischt, weil sie die deutsche Sprache noch nicht perfekt können, die russische aber auch nicht weiter entwickeln. Diese Tatsache machte mir zuerst Sorgen. Dann stieß ich beim Recherchieren auf einen interessanten Aufsatz von Volker Hinnenkamp, in dem er das „Gemischt sprechen“ der Jugendlichen gar nicht tadelt, sondern lobt.1 Dies führte dazu, dass ich anfing, das Problem von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten und die Ergebnisse meines weiteren Recherchierens zum Thema dieser Arbeit zu machen.
Ich halte es für sinnvoll, auf den ersten Seiten dieser Arbeit das Problem der Intelligenz und der Zweisprachigkeit zu erläutern, damit der Leser mit einigen Meinungsverschiedenheiten bekannt gemacht wird. Dann erst stelle ich zwei sprachliche Welten nebeneinander: Die russischsprachige und die türkischsprachige Welt. Den Schwerpunkt legte ich auf die junge Generation der beiden Welten, wobei ich vom
Vorschulstand der Kinder langsam auf das Jugendalter fortschreite. Erwähnenswert finde ich auch die Ansichten der Jugendlichen über ihr Sprechverhalten und ihr emotionales Empfinden. Zum Schluss versuche ich einige positive Argumente für das „Gemischt sprechen“ anzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Bilinguale Entwicklung des Kindes als Weg zum präzisen Switchen
- 2. Switchen als Zeichen der Intelligenz
- 3. Russischer Migrationshintergrund
- 3.1 Geschichtlicher Exkurs
- 3.2 Die Situation russischsprechender Jugendlicher
- 3.2.1 Die Vorschulkinder
- a) Einfluss der Eltern
- b) Aneignung der Sprachen im frühen Kindesalter
- c) Aneignung der Sprachen mit zunehmendem Alter
- d) Besondere Fähigkeiten der Kinder
- 3.2.2 Die Jugendlichen
- a) Ausreisen aus dem Herkunftsort
- b) Einstellung der Jugendlichen gegenüber den beiden Sprachen
- c) Strittige Identität?
- d) Unterschiedliche Ansichten der Jugendlichen
- e) Alter und Spracherwerb
- f) Sprachförderung
- g) Deutsch-russisch der Aussiedlerjugendlichen
- 3.2.1 Die Vorschulkinder
- 4. Türkischer Migrationshintergrund
- 4.1 Zuwanderzugsgeschichte
- 4.2 Die Maßnahmen
- 4.3 Situation der türkeistämmigen Jugendlichen
- 4.3.1 Die Vorschulkinder
- a) Besonderheiten im Spracherwerb
- b) Emotionale Vorlieben
- 4.3.2 Türkisch-deutsch der türkeistämmigen Jugendlichen
- a) Sprachspiel
- b) Die Sicht der Jugendlichen
- c) Situationen des Sprachwechsels
- 4.3.1 Die Vorschulkinder
- 5. „Gemischt sprechen" — ein Zeichen des aktiven Sprachhandels
- 5.1 Code-Switching aus der Vergangenheit
- 5.2 Sprachhandel und Gesellschaft
- 6. Fazit
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des „Gemischtsprechens" bei Jugendlichen mit russischem und türkischem Migrationshintergrund in Deutschland. Die Autorin analysiert die Sprachentwicklung dieser Jugendlichen, untersucht die Gründe für das Mischen von Deutsch und ihrer jeweiligen Herkunftsprache und beleuchtet die Auswirkungen dieser Sprachvarietät auf die Integration in die deutsche Gesellschaft.
- Sprachentwicklung und Spracherwerb bei bilingualen Kindern und Jugendlichen
- Code-Switching und Code-Mixing als sprachliche Strategien
- Die Rolle der Kultur und Identität im Sprachgebrauch
- Die Auswirkungen von Bilingualität auf die Integration und soziale Interaktion
- Die Bedeutung des „Gemischtsprechens" für die Sprachdynamik und Sprachentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die bilinguale Entwicklung des Kindes und stellt die Beobachtungen von Ruke-Dravina über die Sprachentwicklung ihrer beiden schwedisch-lettisch bilingualen Kinder vor. Die Autorin zeigt, wie die Kinder schon in jungen Jahren die Trennung der Sprachen lernen und zwischen ihnen wechseln. Im zweiten Kapitel wird die Frage nach der Intelligenz und der Zweisprachigkeit diskutiert. Die Autorin stellt die gegensätzlichen Ansichten von Leo Weisgerber und Wallace Lambert gegenüber und argumentiert, dass Zweisprachigkeit nicht zu einem Defizit, sondern eher zu einer höheren Intelligenz und Flexibilität im Denken führt.
Kapitel 3 widmet sich dem russischen Migrationshintergrund in Deutschland. Die Autorin zeichnet die historische Entwicklung der russischsprachigen Minderheit in Deutschland nach und beschreibt die Sprachsituation russischsprachiger Kinder und Jugendlicher. Sie beleuchtet den Einfluss der Eltern auf die Sprachentwicklung ihrer Kinder, die Besonderheiten des Spracherwerbs im frühen Kindesalter und die Herausforderungen des Spracherwerbs im Jugendalter.
Kapitel 4 behandelt den türkischen Migrationshintergrund in Deutschland. Die Autorin schildert die Geschichte der türkischen Zuwanderung nach Deutschland und die Auswirkungen auf die Sprachentwicklung türkischstämmiger Kinder und Jugendlicher. Sie analysiert die Besonderheiten des Spracherwerbs im frühen Kindesalter, die sprachlichen Strategien türkischstämmiger Jugendlicher und die Auswirkungen von Code-Switching und Code-Mixing auf ihre sprachliche Identität.
Kapitel 5 widmet sich dem Phänomen des „Gemischtsprechens" als Zeichen des aktiven Sprachhandels. Die Autorin zeigt, wie zweisprachige Jugendliche ihre Sprachen kreativ und flexibel miteinander verknüpfen und neue sprachliche Elemente schaffen. Sie bezieht sich dabei auf Beispiele aus der Vergangenheit, wie Martin Luther die lateinische Sprache mit dem Frühneuhochdeutsch vermischte, und argumentiert, dass das „Gemischtsprechen" nicht als Sprachdefizit, sondern als Zeichen hoher Sprachkompetenz und Kreativität zu verstehen ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Spracherwerb bei bilingualen Kindern und Jugendlichen, Code-Switching und Code-Mixing, Sprachdynamik, Sprachentwicklung, kulturelle Identität, Integration, russischer und türkischer Migrationshintergrund sowie die deutsche Sprache.
Häufig gestellte Fragen
Ist das Mischen von Sprachen bei Jugendlichen ein Zeichen von Defiziten?
Nein, moderne Ansätze wie die von Volker Hinnenkamp betrachten das "Gemischtsprechen" als Zeichen hoher Sprachkompetenz, Kreativität und aktiven Sprachhandels, nicht als mangelndes Beherrschen einer Einzelsprache.
Was versteht man unter Code-Switching?
Code-Switching bezeichnet den bewussten Wechsel zwischen zwei Sprachen innerhalb eines Gesprächs. Bei bilingualen Jugendlichen dient es oft als präzise sprachliche Strategie.
Fördert Zweisprachigkeit die Intelligenz?
Die Arbeit argumentiert, dass Zweisprachigkeit zu einer höheren kognitiven Flexibilität und Intelligenz führt, da Kinder früh lernen, sprachliche Systeme zu trennen und kreativ zu nutzen.
Wie unterscheidet sich die Situation bei russischen und türkischen Migranten?
Beide Gruppen nutzen das Sprachmischen als Teil ihrer Identität, jedoch sind die historischen Hintergründe und die emotionalen Vorlieben für die Herkunftssprachen kulturell unterschiedlich geprägt.
Gibt es historische Beispiele für Sprachmischung?
Ja, die Autorin zieht Parallelen zu Martin Luther, der Latein und Frühneuhochdeutsch miteinander verknüpfte, um die schöpferische Kraft des Sprachwechsels zu verdeutlichen.
- Citar trabajo
- Swetlana Krieger (Autor), 2014, Die Situation mehrsprachiger Jugendlicher in der deutschen Gesellschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273745