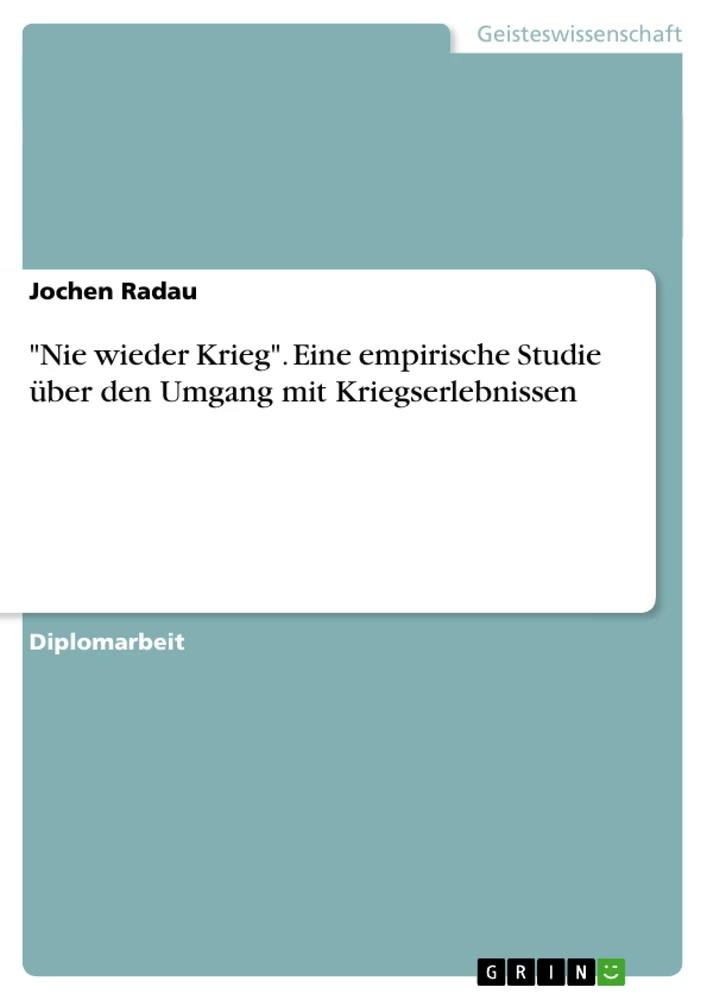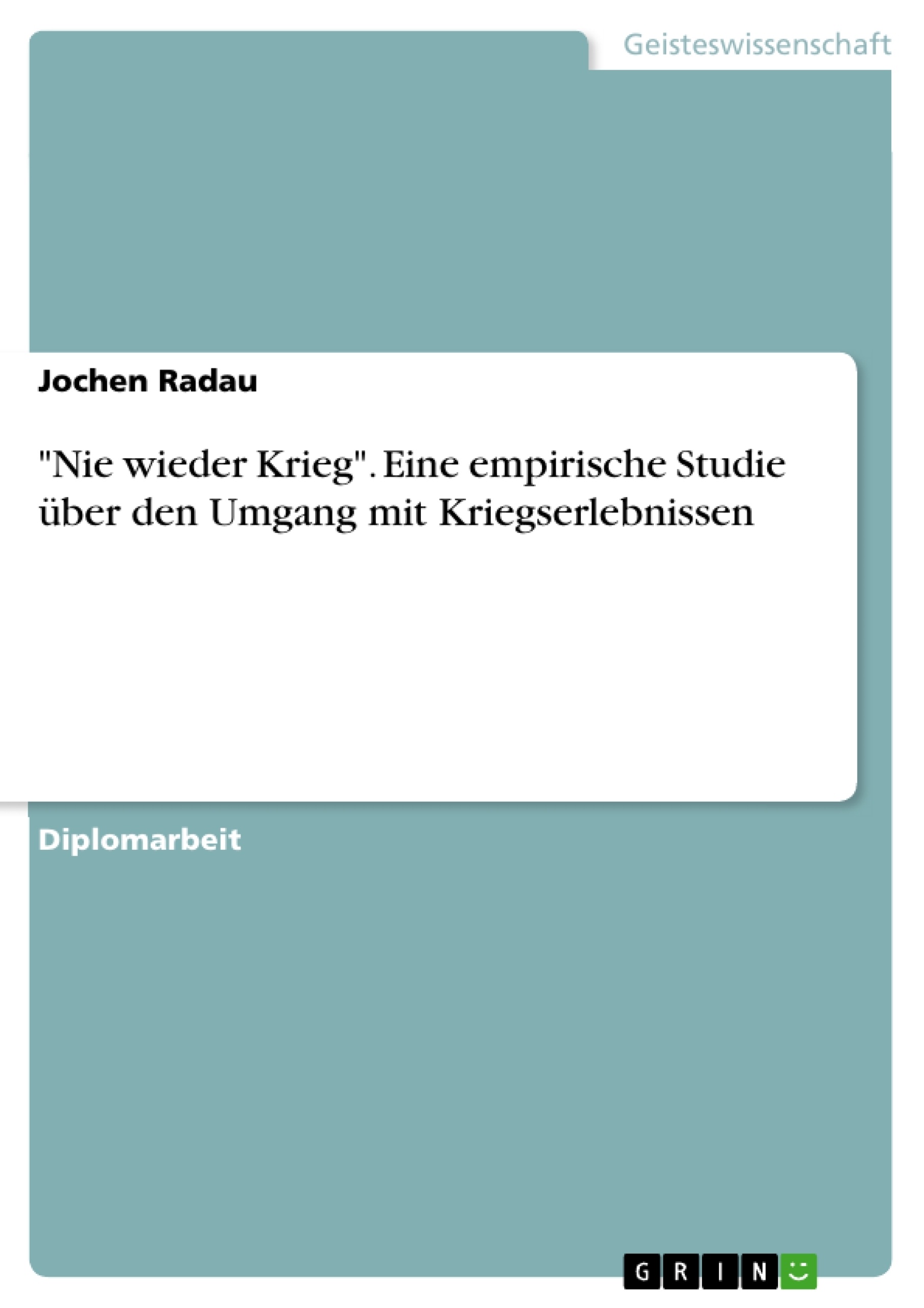Diese Studie untersucht wie Soldaten des Zweiten Weltkriegs mit ihren Erlebnissen umgegangen sind, wie sie diese verarbeitet haben und welche Bedeutung sie Ihnen aus heutiger Sicht zuschreiben.
In einem ersten Teil enthält die Studie die theoretischen Grundlagen zu den Folgen von Krieg und Gefangenschaft für die betroffenen Personen und den Möglichkeiten des Umgangs mit den existenziellen Bedrohungen dieser Erlebnisse vor dem zeitlichen Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Dazu werden Studien, Untersuchungen und Veröffentlichungen aus dem Zeitraum der 50’er Jahre bis in die heutige Zeit herangezogen.
Im zweiten Teil werden diese Erkenntnisse auf die Ergebnisse der eigenen Befragung ehemaliger Soldaten und Kriegsgefangener angewendet. Die Befragung der Zeitzeugen erfolgt dabei mittels eines Interviewleitfadens, der sich an der Bedürfnistheorie der Sozialarbeitswissenschaftlerin Sylvia Staub Bernasconi orientiert.
Aus der Sicht der sozialen Arbeit betrachte ich im Rahmen dieser Arbeit, welche Wege die Betroffenen damals finden konnten, um mit ihren Erlebnissen umzugehen. Außerdem möchte ich erfahren welche subjektive Bedeutung sie dem Erlebten heute geben.
Zusätzlich zu meinem Forschungsinteresse liegt ein Ziel dieser Arbeit darin, den Betroffenen eine Möglichkeit zu geben vertieft aus Ihrem Erfahrungsschatz zu berichten und darzulegen, welchen Stellenwert das Erlebte heute für sie hat. Damit leistet diese Arbeit auch einen Beitrag zur Erhaltung eines bedeutenden und zugleich schauerlichen Teils deutscher Zeitgeschichte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Gegenstand und Erkenntnisinteresse der Untersuchung
- Definitionen
- Definition Kriegserlebnis
- Unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Erlebten
- Kriegserlebnis als Problem
- Überblick
- Kriegserlebnis als Tabuthema
- Physische Folgen von Kriegserlebnissen
- Kriegserlebnis als mehrdimensionale soziale Problematik
- Überblick
- Probleme der individuellen Bedürfnis- und Wunscherfüllung - Ausstattungsprobleme
- Probleme des asymmetrischen Austauschs: Austauschprobleme - soziale Beziehungsprobleme von Individuen
- Machtprobleme
- Werte- und Kriterienprobleme
- Traumatisierung
- Überblick
- Posttraumatische Belastungsstörung
- Langfristige Traumatisierung
- Umgang mit Kriegserlebnissen
- Bewältigung
- Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen
- Prozessmerkmale
- Antezendenzmerkmale
- Personenmerkmale
- Kontextmerkmale
- Ereignismerkmale
- Konsequenzmerkmale
- Historischer und kultureller Kontext
- Nationalsozialistischer Erziehungsstaat
- Holocaust und Nürnberger Prozesse
- Eckpunkte des Zweiten Weltkriegs
- Militärische Erfolge und Kriegswende
- Krieg im Süden und Westen ab 1943
- Krieg gegen die Sowjetunion
- Minderjährige und alte Soldaten
- Kriegsgefangene in der Sowjetunion
- Methodisches Vorgehen
- Grundsätze qualitativer Sozialforschung
- Datenerhebung mit dem problemzentrierten Interview
- Grundlagen
- Anforderungen an die Gesprächsführung
- Auswertung mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring
- Die Datenerhebung
- Der Interviewleitfaden
- Grundlagen des Interviewleitfadens
- Beschreibung der Kategorien
- Sozialdaten
- Das Erlebnis
- Umgang mit sozialen Problemen
- Vorauslaufende Bedingungen
- Subjektive Bedeutung für die Betroffenen
- Gliederung des Interviewleitfadens
- Die Interviewpartner
- Auswahlkriterien für die Interviewpartner
- Die Gewinnung der Interviewpartner
- Der erste Kontakt mit potenziellen Interviewpartnern
- Beschreibung der Interviewpartner
- Durchführung der Interviews
- Datenerhebung und Datenerfassung
- Ablauf des Interviews
- Persönliche Reflexion
- Der Interviewleitfaden
- Auswertung mit der qualitativen Inhaltsanalyse
- Beschreibung des Kategoriensystems zur Auswertung
- Sozialdaten
- Beschreibung des Erlebnisses
- Umgang mit der Ausstattung
- Umgang mit dem Austausch
- Umgang mit Macht
- Umgang mit Werten und Kriterien
- Vorauslaufende Bedingungen
- Subjektive Bedeutung für Betroffene
- Besonderheiten im Nachgespräch
- Auswertung der Kategorieninhalte
- Sozialdaten
- Beschreibung des Erlebnisses
- Umgang mit der Ausstattung
- Umgang mit dem Austausch
- Umgang mit Macht
- Umgang mit Werten und Kriterien
- Vorrauslaufende Bedingungem
- Subjektive Bedeutung
- Besonderheiten im Nachgespräch
- Beschreibung des Kategoriensystems zur Auswertung
- Interpretation
- Sozialdatem
- Beschreibung der Erlebnisse
- Erzählstil
- Schwerpunkte
- Heimkehr nach Deutschland
- Umgang mit der Ausstattung
- Umgang mit der Versorgungssituation
- Umgang mit körperlichen Reaktionen
- Kognitiver Umgang mit dem Gegebenen
- Umgang mit Gefühlen und Empfindungen
- Sinngebung des eigenen Handelns
- Rolle der Religiom
- Soziale Beziehungen
- Umgang mit dem Austausch
- Rolle von Gesprächen
- Rolle von Feldpost und Tagebuch
- Gegenseitige Hilfe und Behinderung
- Zusammenarbeit in der Wehrmacht
- Umgang mit Macht oder Überlegenheit
- Möglichkeiten der Einflussnahme auf das Geschehen
- Macht oder Überlegenheit
- Regeln, wie über Erlebtes gesprochen oder berichtet wird
- Informationen
- Umgang mit Werten und Kriterien
- Orientierungsmaßstäbe
- Missachtung von Werten
- Vorrauslaufende Bedingungen
- Informationen und Vorerfahrungen
- Wirkung der Vorerfahrung
- Subjektive Bedeutung
- Folgen des Erlebnisses
- Veränderungen im Laufe der Zeit
- Erhaltene Unterstützung
- Heutige Gedanken über das Erlebte
- Heutige Gedanken und Bewenungen über Krieg
- Aus dem Erlebnis heraus wichtig geworden
- Bedeutung des Gesprächs
- Besonderheiten im Nachgespräch
- Kritische Reflexion
- Schluß
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht den Umgang von Soldaten des Zweiten Weltkriegs mit ihren Kriegserlebnissen, insbesondere die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Erlebten und die subjektive Bedeutung, die ihnen das Erlebte heute gibt. Die Arbeit basiert auf problemzentrierten Interviews mit ehemaligen Soldaten und Kriegsgefangenen.
- Die Auswirkungen von Kriegserlebnissen auf das soziale, psychische und körperliche Wohlbefinden der Betroffenen
- Die Bedeutung von sozialen Problemen, wie Ausstattungsproblemen, Austauschproblemen, Machtproblemen und Werte- und Kriterienproblemen im Kontext von Kriegserlebnissen
- Die Rolle von Traumatisierung im Zusammenhang mit Kriegserlebnissen
- Die Bedeutung von Bewältigungsstrategien und Ressourcen für den Umgang mit Kriegserlebnissen
- Der historische und kulturelle Kontext des Zweiten Weltkriegs und dessen Einfluss auf Kriegserlebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit dar. Sie beschreibt die Beobachtungen, die zur Entstehung der Forschungsfrage führten, und erläutert die Bedeutung der Untersuchung für die Soziale Arbeit.
Das Kapitel "Grundlagen" definiert zentrale Begriffe wie Kriegserlebnis und unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Erlebten. Es analysiert die Problematik von Kriegserlebnissen, insbesondere im Hinblick auf soziale Probleme und Traumatisierung. Das Kapitel beleuchtet auch den historischen und kulturellen Kontext des Zweiten Weltkriegs und dessen Einfluss auf die Kriegserlebnisse der Soldaten.
Das Kapitel "Methodisches Vorgehen" beschreibt die gewählte Forschungsmethode, die qualitative Sozialforschung, und erläutert die Prinzipien dieser Methode. Es wird das problemzentrierte Interview als Datenerhebungsmethode vorgestellt und die Anforderungen an die Gesprächsführung erläutert. Das Kapitel beschreibt auch die Auswertungsmethode, die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring.
Das Kapitel "Die Datenerhebung" stellt den Interviewleitfaden vor, der im Rahmen der Untersuchung verwendet wurde. Es beschreibt die Auswahlkriterien für die Interviewpartner, die Gewinnung der Interviewpartner und die Durchführung der Interviews.
Das Kapitel "Auswertung mit der qualitativen Inhaltsanalyse" beschreibt das Kategoriensystem, das für die Auswertung der Interviews verwendet wurde. Es präsentiert die Ergebnisse der Auswertung in Form von Tabellen und Texten.
Das Kapitel "Interpretation" analysiert die Ergebnisse der Untersuchung und beleuchtet die unterschiedlichen Formen des Umgangs mit Kriegserlebnissen. Es untersucht die Auswirkungen von Kriegserlebnissen auf das Leben der Betroffenen, die Bedeutung von sozialen Problemen und Traumatisierung und die Rolle von Bewältigungsstrategien und Ressourcen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Kriegserlebnisse, Kriegstrauma, Traumabewältigung, soziale Probleme, Kriegsgefangenschaft, Zweiter Weltkrieg, qualitative Sozialforschung, problemzentriertes Interview, qualitative Inhaltsanalyse, historische und kulturelle Kontext, Nationalsozialismus.
Häufig gestellte Fragen
Wie verarbeiteten Soldaten des Zweiten Weltkriegs ihre Erlebnisse?
Die Verarbeitung erfolgte individuell sehr unterschiedlich; oft wurden die Erlebnisse über Jahrzehnte tabuisiert oder in privaten Kreisen durch Erzählungen und Tagebücher verarbeitet.
Was ist eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) bei Kriegsveteranen?
PTBS umfasst langfristige psychische Folgen wie Flashbacks, Angstzustände und emotionale Taubheit, die durch die existenziellen Bedrohungen im Krieg ausgelöst wurden.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei der Aufarbeitung von Kriegstraumata?
Soziale Arbeit untersucht die Wege, wie Betroffene mit ihren sozialen und psychischen Problemen umgingen, und bietet heute Methoden zur biografischen Aufarbeitung an.
Warum war das Kriegserlebnis lange ein Tabuthema?
Der gesellschaftliche Kontext der Nachkriegszeit, die Schuldfrage und der Fokus auf den Wiederaufbau führten dazu, dass über das subjektive Leid der Soldaten oft geschwiegen wurde.
Was ist das Ziel der Zeitzeugenbefragung in dieser Studie?
Ziel ist es, den Betroffenen eine Stimme zu geben und zu dokumentieren, welche subjektive Bedeutung sie ihren Erlebnissen heute, viele Jahrzehnte später, zuschreiben.
- Citar trabajo
- Jochen Radau (Autor), 2003, "Nie wieder Krieg". Eine empirische Studie über den Umgang mit Kriegserlebnissen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274398