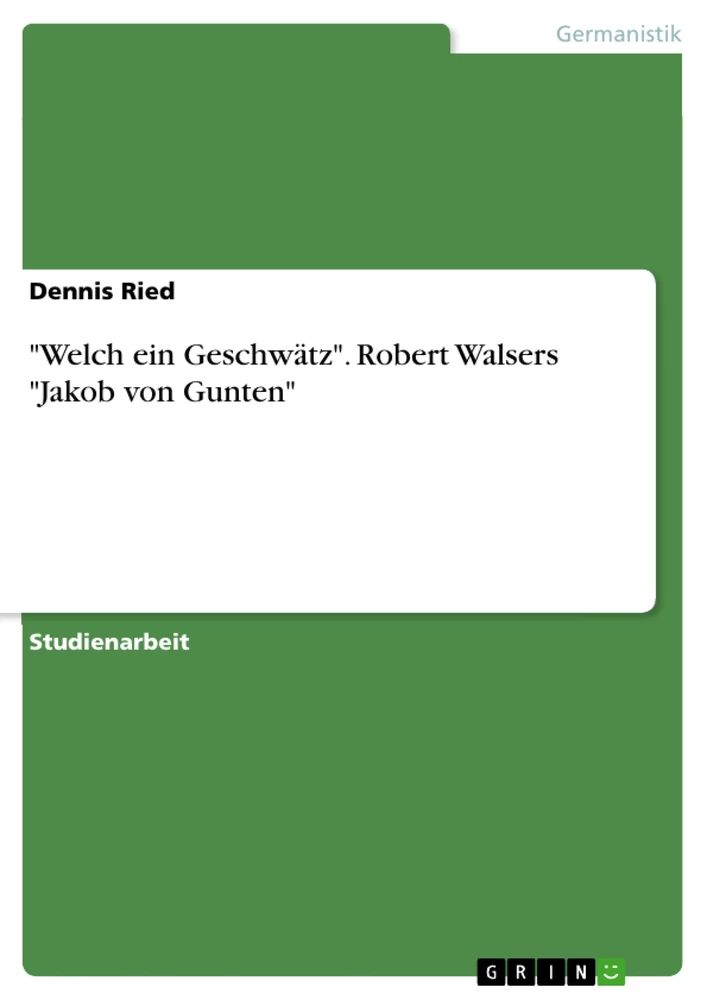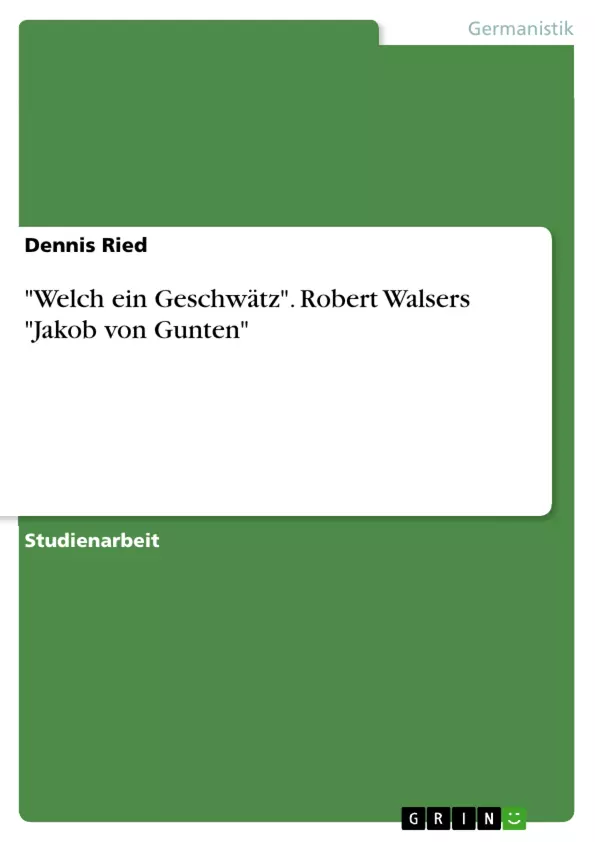Robert Walsers Werk umfasst insgesamt nur drei Romane, die allesamt in Berlin entstanden sind. Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit dem letzten Roman "Jakob von Gunten", welchen Walser 1908 veröffentlichte. Aufgrund von zahlreichen Lesarten, die der Roman bietet, wird zunächst der Aspekt der Genrezugehörigkeit
und der Romanart näher betrachtet. Daraus folgt die nähere Untersuchung des Genres Tagebuch und seine formale Übereinstimmung mit bzw. Anwendbarkeit auf "Jakob von Gunten". In Kapitel 1.2 geht es um den Aspekt der Zeit, welcher primär eine direkte Verbindung mit dem Tagebuch als zeitabhängige Gattung aufweist. mit dem Tagebuch als zeitabhängige Gattung zu tun hat. In wie weit ‚Zeit‘ in diesem Roman überhaupt existiert, wird auch hinterfragt.
Ein weiterer thematischer Aspekt, den Walser behandelt, ist die Bildung, deren Verständnis und Ausprägung untersucht wird. Auch gibt es im Institut Benjamenta nur ein einziges Lehrbuch, dessen Inhalt förmlich das Gesetz bildet und in einem Bestimmten Verhältnis (Gesetz und Kommentar) zum Protagonisten Jakob steht. Damit beschäftigt sich das Kapitel 1.3 Wissen und Lernen, Gesetz und Kommentar. Kapitel 2 widmet sich dem Begriff des ‚Kleinen‘ in Jakob von Gunten und Jakobs Idee vom Dienen. Es wird in diesem Kapitel zu klären sein, ob Jakobs Dieneridee für ihn ein reales und somit erreichbares Ziel bildet, oder ob es ein Ideal bleibt. Vor der abschließenden Zusammenfassung wird in aller Kürze auf die Frage ,Wer herrscht wirklich?‘ eingegangen. Ob Jakob sich unterordnet und von Herrn und Fräulein Benjamenta beherrscht wird, oder ob die beiden nicht eher von Jakob abhängig sind bzw. werden, wird dort angeschnitten. Zur vereinfachten Nachvollziehbarkeit von Primärtextzitaten wurden alle Seitenangaben, die
sich in zitierter Sekundärliteratur auf eine andere als die hier verwendete Ausgabe von Jakob von Gunten beziehen, auf die hier verwendete Ausgabe angepasst. Verwendet wurde für diese Ausarbeitung die im Literaturverzeichnis ausgewiesene Ausgabe, die 2013 im Verlag Suhrkamp in der 17. Auflage erschienen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Tagebuch, Zeit und Wissen
- 1.1. Tagebuch
- 1.2. Zeit
- 1.3. Wissen und Lernen, Gesetz und Kommentar
- 2. Das Kleine
- 2.1. Jakobs Idee vom Dienen
- 3. Wer herrscht wirklich?
- 4. Fazit
- 5. Literaturverzeichnis
- 5.1. Primärliteratur
- 5.2. Sekundärliteratur
- 6. Anlage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung analysiert Robert Walsers Roman „Jakob von Gunten" und untersucht verschiedene Aspekte des Werks, insbesondere die Genrezugehörigkeit, die Rolle des Tagebuchs, das Thema der Zeit und die Bildungslandschaft des Instituts Benjamenta.
- Genrezugehörigkeit und Romanart
- Das Tagebuch als formale Struktur des Romans
- Zeitlichkeit und Zeitlosigkeit in „Jakob von Gunten"
- Bildung und Selbsterziehung im Institut Benjamenta
- Jakobs Idee vom Dienen und die Frage nach der wahren Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Frage nach der Genrezugehörigkeit von „Jakob von Gunten". Der Roman wird in der Forschung kontrovers diskutiert, wobei verschiedene Positionen vertreten werden, die ihn als Bildungsroman, Anti-Bildungsroman, Parodie oder Tagebuchroman einordnen. Der Autor selbst äußert sich kaum zum Genre, was die Interpretationen noch komplexer macht. Die Analyse zeigt, dass der Roman zwar Elemente des Tagebuchs aufweist, aber gleichzeitig auch die Grenzen dieser Gattung überschreitet.
Das zweite Kapitel untersucht die Rolle der Zeit in „Jakob von Gunten". Die fehlende Datierung der Tagebucheinträge und die allgemeine Zeitlosigkeit des Instituts Benjamenta werden im Kontext des Romans analysiert. Die Kapitel beleuchtet, wie die Abwesenheit von Zeitgefühl und Geschichte die Selbsterfahrung des Protagonisten prägt und gleichzeitig eine Kritik an der modernen Gesellschaft darstellt.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Thema der Bildung im Roman. Das Institut Benjamenta wird als Ort der Selbstverleugnung und der Unterdrückung von Individualität vorgestellt. Die Zöglinge lernen, nichts zu tun und sich dem Willen der Autoritäten zu unterwerfen. Die Kapitel analysiert die Absurdität der Erziehungsmethoden und die Pervertierung des klassischen Bildungsideals.
Das vierte Kapitel befasst sich mit Jakobs Idee vom Dienen. Der Protagonist, der aus einem „guten Hause" stammt, entscheidet sich für ein Leben in Unterwerfung und Demut. Die Kapitel analysiert die Paradoxie von Jakobs „umgestülptem Aristokratismus" und die Frage, ob er tatsächlich eine „Null" werden kann.
Das fünfte Kapitel untersucht das Verhältnis von Jakob zu den anderen Protagonisten des Romans, insbesondere zu Herrn und Fräulein Benjamenta. Die Kapitel beleuchtet die komplizierten Machtstrukturen des Instituts und die Frage, wer letztendlich die Kontrolle hat.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Robert Walser, Jakob von Gunten, Bildungsroman, Anti-Bildungsroman, Tagebuch, Zeit, Zeitlosigkeit, Geschichte, Bildung, Selbsterziehung, Institut Benjamenta, Dienen, Unterwerfung, Herrschaft, Demut, Kleinheit, Großstadt, Moderne, Gesellschaft, Interpretation, Analyse, Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Robert Walsers Roman „Jakob von Gunten“?
Der Roman beschreibt die Erlebnisse des jungen Jakob von Gunten im Institut Benjamenta, einer Schule für Diener, in der das Ziel die vollkommene Unterordnung ist.
Zu welcher literarischen Gattung gehört das Werk?
Das Werk wird oft als Tagebuchroman eingeordnet, zeigt aber auch Züge eines Bildungsromans bzw. Anti-Bildungsromans.
Was ist das Institut Benjamenta?
Es ist ein Ort der Selbsterziehung zum „Dienen“, an dem Individualität unterdrückt wird und die Zöglinge lernen, „eine Null“ zu sein.
Welche Rolle spielt die Zeit im Roman?
Der Roman ist geprägt von einer gewissen Zeitlosigkeit; die Tagebucheinträge sind nicht datiert, was die Isolation des Instituts von der Außenwelt unterstreicht.
Wer hat im Roman wirklich die Macht?
Die Arbeit hinterfragt die Hierarchie zwischen Jakob und den Leitern (Herr und Fräulein Benjamenta) und ob die Herrschenden nicht letztlich von den Dienenden abhängig sind.
- Quote paper
- stud. phil. Dennis Ried (Author), 2014, "Welch ein Geschwätz". Robert Walsers "Jakob von Gunten", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274726