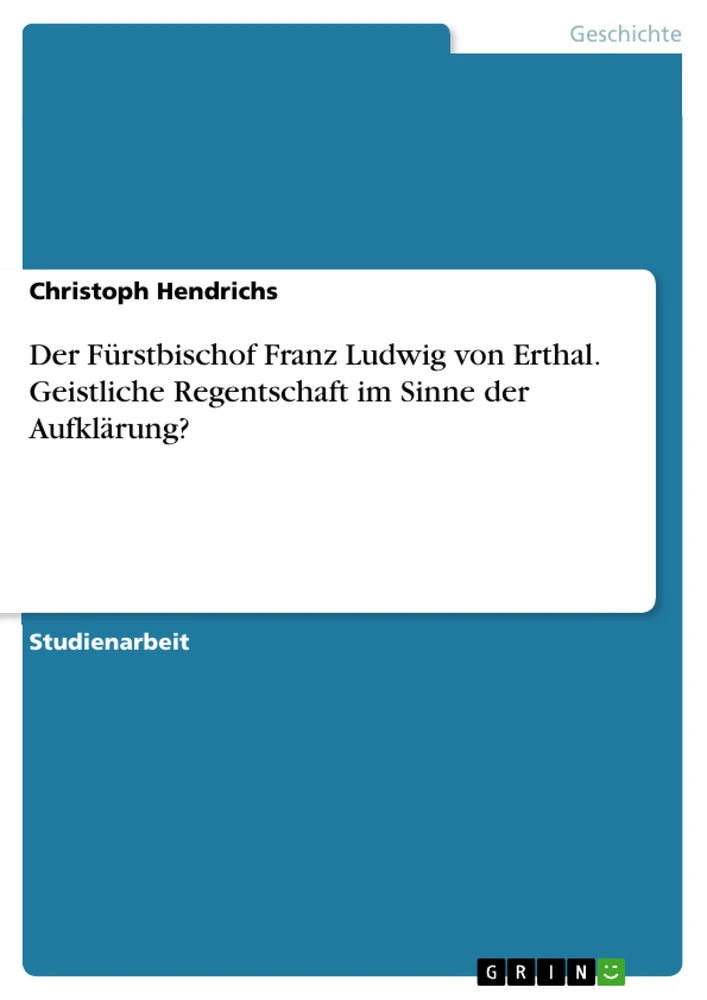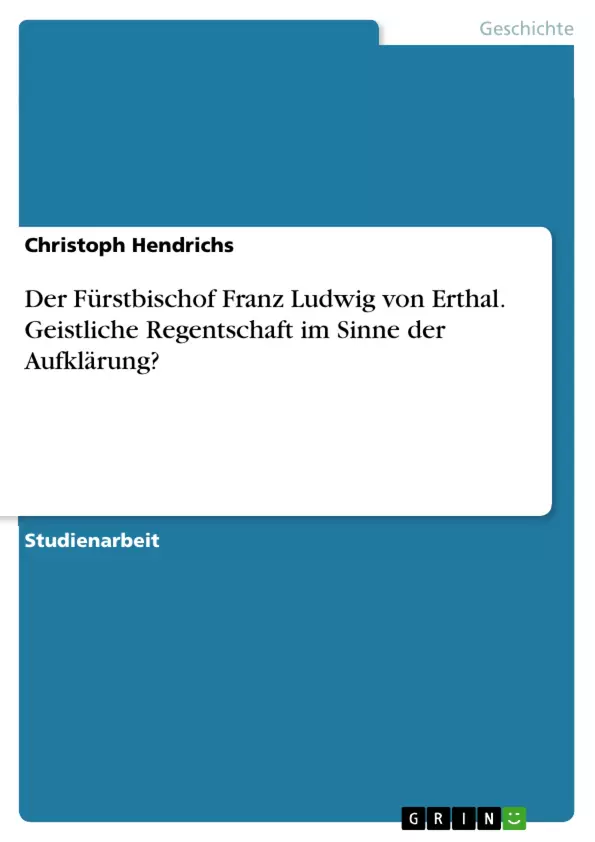Lange galten in der Forschung Rückständigkeit und mangelnde Modernisierungsbereitschaft als Merkmale der geistlichen Fürstentümer des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Die im Zuge des Reichsdeputationshauptschlusses im Jahre 1803 erfolgte Säkularisation der „Krummstabländer“ wurde folglich damit erklärt, dass die „veralteten“ geistlichen Staaten mit dem im Zeichen der Aufklärung fortschreitenden und sich verändernden Denken nicht mehr mithalten konnten. Tatsächlich sahen sich die geistlichen Fürstentümer in der Zeit der Aufklärung auch mit zeitgenössischer Kritik konfrontiert, so etwa durch die im „Journal von und für Deutschland“ formulierte Bibrasche Preisfrage, die die öffentliche Meinung über zu behebende Mängel in geistlichen Territorien einholen sollte. Laut dem Historiker Kurt Andermann seien die zeitgenössischen Antworten in der Forschung jedoch oft zu einseitig als Quellenbeleg für die Untersuchung der Zustände geistlicher Staaten herangezogen und so das einseitige Bild von deren Rückständigkeit evoziert worden. Insgesamt ist die neuere Forschung inzwischen darum bemüht, diesen Gegenstand zumindest differenzierter in den Blick zu nehmen, sodass Vorteile in der Verfassung geistlicher Staaten untersucht sowie Beispiele für aufgeklärt und „zeitgemäß“ handelnde geistliche Regenten aufgeführt werden. Einen solchen Regenten stellt der zwischen 1779 und 1795 in Würzburg und Bamberg regierende Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal dar, der als aufgeklärter und reformwilliger geistlicher Herrscher auftrat. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, inwiefern dieser angesichts der Kritik der bürgerlich-aufgeklärten Öffentlichkeit ein neues geistliches Fürstenideal vertrat. In diesem Zusammenhang wird am Beispiel von Franz Ludwig von Erthal auch der in der Forschung oft generalisierte Vorwurf untersucht, dass aufgeklärte geistliche Regenten nicht aus Überzeugung, sondern nur aufgrund des Drucks der öffentlichen Meinung neue Wege einschlugen. In einem ersten Schritt werden auf Grundlage von Einsendungen zur Bibraschen Preisfrage sowie auf sie Bezug nehmender Literatur die Kernpunkte zeitgenössischer Kritik herausgearbeitet, um sie im Anschluss daran mit den Regierungsgrundsätzen Franz Ludwig von Erthals zu konfrontieren. Zur Vervollständigung der Untersuchung sollen die Regierungstätigkeiten des Fürstbischofs auf die Frage hin beleuchtet werden, ob und inwiefern man ihn als Vertreter eines neuen geistlichen Fürstenideals bezeichnen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geistliche Fürstentümer im Spiegel zeitgenössischer Kritik
- Kritik an der Verfassung geistlicher Fürstentümer
- Antiklerikale und aufgeklärte Kritik
- Das Idealbild eines geistlichen Fürsten
- Franz Ludwig von Erthals Regierungsgrundsätze
- Absolutistische Herrschaftsansprüche
- Das Wohl der Untertanen als Endzweck
- Zur Doppelrolle des Fürstbischofs
- Franz Ludwig von Erthals Regierungsweise
- Zur Durchsetzung absolutistischer Herrschaftsansprüche
- Maßnahmen zur Beförderung der allgemeinen Wohlfahrt
- Zur Ausübung seiner Doppelrolle
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Regierung des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal in Würzburg und Bamberg (1779-1795) und analysiert, inwiefern seine Regierungsweise dem Ideal eines aufgeklärten geistlichen Fürsten entspricht. Darüber hinaus wird die gängige These, dass aufgeklärte geistliche Regenten aufgrund des Drucks der öffentlichen Meinung und nicht aus eigener Überzeugung neue Wege einschlugen, am Beispiel von Erthal geprüft.
- Kritik an der Verfassung geistlicher Fürstentümer im ausgehenden 18. Jahrhundert
- Das Idealbild eines aufgeklärten geistlichen Fürsten
- Franz Ludwig von Erthals Regierungsgrundsätze und ihre Umsetzung
- Die Rolle der öffentlichen Meinung in Erthals Regierungsweise
- Franz Ludwig von Erthal als Vertreter eines neuen geistlichen Fürstenideals
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung setzt sich mit der Forschungsgeschichte des Themas auseinander und stellt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit vor. Kapitel 2 beleuchtet die Kritik an geistlichen Fürstentümern im ausgehenden 18. Jahrhundert anhand von Einsendungen zur Bibraschen Preisfrage und zeitgenössischen Publikationen. Es werden die wichtigsten Kritikpunkte und Vorstellungen über das Ideal eines geistlichen Fürsten herausgearbeitet. Kapitel 3 analysiert die Regierungsgrundsätze Franz Ludwig von Erthals, die als eine Art Leitfaden für seine Regierungstätigkeit entstanden sind. Anhand dieser Quelle wird untersucht, ob und inwiefern Erthal von einem aufgeklärten Geist durchdrungen war. Kapitel 4 betrachtet die Regierungspraxis des Fürstbischofs und beleuchtet, ob und inwiefern er als Vertreter eines neuen geistlichen Fürstenideals bezeichnet werden kann.
Schlüsselwörter
Geistliche Fürstentümer, Aufklärung, Franz Ludwig von Erthal, Bibrasche Preisfrage, Wahlkapitulationen, Regierungsgrundsätze, Idealbild, Kritik, Absolutismus, Wohlfahrt, Doppelrolle, öffentliche Meinung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Franz Ludwig von Erthal?
Er war Fürstbischof von Würzburg und Bamberg (1779–1795) und gilt als Vertreter eines aufgeklärten und reformwilligen geistlichen Herrschers.
Was war die Bibrasche Preisfrage?
Eine öffentliche Umfrage im 18. Jahrhundert, die Mängel in geistlichen Territorien aufzeigen sollte und die öffentliche Meinung über die „Krummstabländer“ widerspiegelte.
War Erthal ein rein absolutistischer Herrscher?
Er verband absolutistische Herrschaftsansprüche mit dem Ziel der allgemeinen Wohlfahrt seiner Untertanen, ganz im Sinne des aufgeklärten Absolutismus.
Wie reagierte Erthal auf die Kritik der bürgerlichen Öffentlichkeit?
Die Arbeit untersucht, ob seine Reformen aus eigener Überzeugung oder lediglich als Reaktion auf den Druck der öffentlichen Meinung entstanden.
Was versteht man unter der „Doppelrolle“ des Fürstbischofs?
Ein Fürstbischof war gleichzeitig geistliches Oberhaupt (Bischof) und weltlicher Landesherr (Fürst), was oft zu Spannungsfeldern in der Amtsführung führte.
- Quote paper
- B.Ed. Christoph Hendrichs (Author), 2013, Der Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal. Geistliche Regentschaft im Sinne der Aufklärung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274969