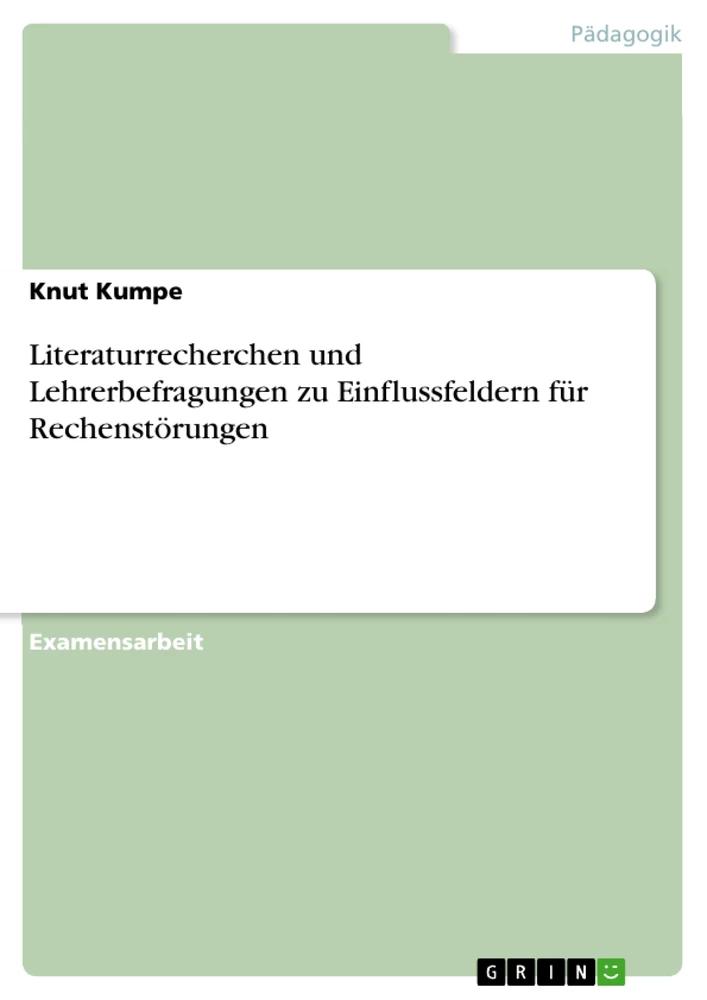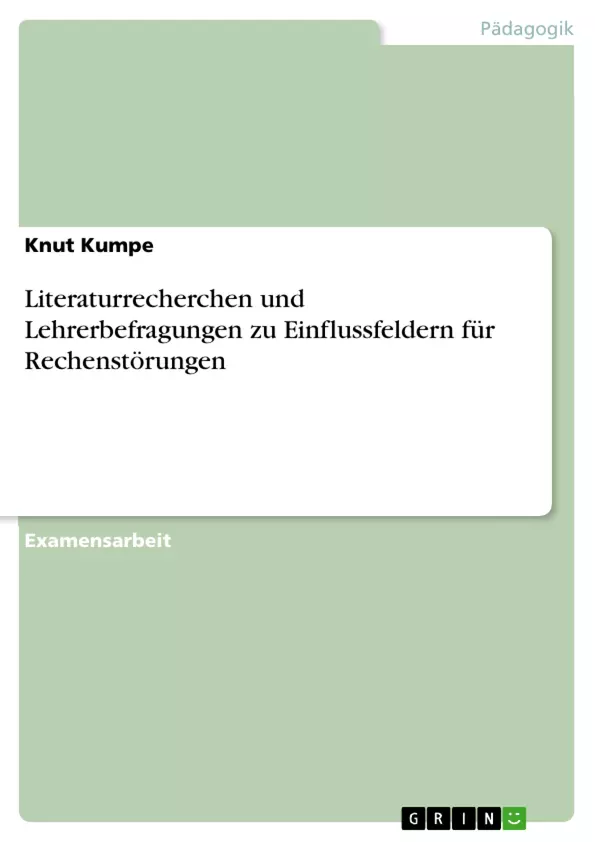Diese Staatsarbeit ist in zwei unterschiedliche Teile gegliedert. Nach der Einleitung vollzieht sich eine Aufarbeitung der verschiedenen Termini, die allgemein im Zusammenhang mit Problemen im Fach Mathematik bzw. beim Rechnen gebraucht werden. Ferner werden verschiedene Ansätze bzgl. einer Definition des Begriffs der „Rechenschwäche“ vorgestellt.
Im dritten Kapitel stellt der Verfasser drei Fallbeispiele aus seinem näheren Umfeld vor: Zwei der drei Schüler weisen eine positive Dyskalkuliediagnose durch anerkannte Psychologen auf, während das dritte (ungetestete) Kind aufgrund von Minderleistungen im Fach Mathematik diverse Symptome einer Rechenschwäche zeigt. Das dritte Kapitel hat damit zum Zweck, ein und dasselbe Phänomen in seiner Vielfalt zu veranschaulichen und ein Bewusstsein für die Gesamtproblematik „Rechenstörung“ zu vermitteln.
Das darauffolgende Kapitel 4 widmet sich den Einflussfaktoren, die eine Rechenstörung auslösen bzw. verstärken können, und es wird ein Literaturüberblick (Kap. 4.1) über ebendiese Faktoren und deren Wechselwirkungen gegeben.
In Kapitel 4.2 erfolgt eine systematische Einteilung dieser Faktoren in drei große Einflussfelder, und es werden fundierte Erkenntnisse, über die seit mehreren Jahrzehnten Einigkeit besteht, wie auch Ergebnisse aktuellerer Studien diskutiert und dokumentiert, die ggf. noch ausgiebiger erforscht werden müssten. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse zusammengefasst und ausführlich bewertet.
Der zweite Teil dieser Arbeit (Kapitel 6) besteht aus einer Befragung zu dem Thema „Rechenstörungen verursachende Faktoren“, die unter Lehrkräften einer Recklinghäuser Gesamtschule im September 2013 durchgeführt wurde. In dem ersten Untersuchungsschritt werden mithilfe von Informationsgesprächen mögliche Faktoren herausgearbeitet, die eine Rechenstörung hervorrufen oder verstärken können, um den Kenntnisstand der Lehrerinnen und Lehrer bezüglich der aktuellen Fachliteratur festzustellen. In einem zweiten Schritt werden die genannten Einflussfaktoren hinsichtlich ihrer Wichtigkeit durch die Lehrer anhand eines weiteren Fragebogens bewertet und sortiert, um darüber aufzuklären, inwieweit
Einigkeit bezüglich der Bedeutung bestimmter Einflussfaktoren herrscht.
Es folgen im 7. Kapitel eine Darstellung und Bewertung der gesamten Resultate der Untersuchung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Die phänomenologischen Ansätze
- Diskrepanzdefinitionen
- Vorstellung der drei Fallbeispiele
- Bemerkung
- Fallbeispiel l: Jana
- Familiäre Situation, körperliche Entwicklung und schulisches Gesamtleistungsbild
- Janas Leistungen im Fach Mathematik
- Arbeits- und Sozialverhalten
- Diesjähriger Wechsel an die Gesamtschule Suderwich
- Fallbeispiel 11: Katharina
- Familiäre Situation, Entwicklung und schulisches Gesamtleistungsbild
- Vorgeschichte
- Katharinas Leistungen im Fach Mathematik vor Therapiebeginn
- Darstellung des Umgangs mit mathematischen Operationen
- Zahlbegriff
- Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 10
- Kopfrechnen
- Stellenwertsystem
- Multiplikation und Division
- Sachaufgaben
- Therapieverlauf
- Arbeits- und Sozialverhalten
- Leistungen in anderen Fächern
- Psychische Belastung oder die Frage: Ist Katharina noch motiviert?
- Darstellung des Umgangs mit mathematischen Operationen
- Fallbeispiel Miguel
- Vorbemerkung
- Familiäre Situation, körperliche Entwicklung und schulisches Gesamtleistungsbild
- Gegenwärtige und vorangegangene Klassensituation
- Leistungen in anderen Fächern
- Miguels Leistungen im Fach Mathematik
- Arbeits- und Sozialverhalten
- Nachbetrachtung
- Einflussfaktoren für Rechenstörungen
- Literaturüberblick
- Erklärungen zu den einzelnen Einflussfeldern
- Einflussfeld Kind
- Kongenitale Einflüsse
- Neuropsychologische Einflüsse
- Psychische Einflüsse
- Soziokulturelles und familiäres Einflussfeld
- Schulisches Umfeld als Einflussfeld
- Einflussfeld Kind
- Evaluation der Literaturrecherchen
- Lehrerbefragungen zu den Einflussfaktoren für Rechenstörungen
- Anlage und Ziel der Untersuchung
- Durchführung der Untersuchung
- Versuchspersonen
- Erhebungsmethoden
- Dokumentation und Auswertung der Daten
- Darstellung und Ergebnisse der einzelnen Untersuchungsphasen
- Vorbemerkung
- Darstellung und Bewertung der Ergebnisse der Informationsgespräche
- Darstellung und Bewertung der Ergebnisse des Fragebogens
- Ergebnisse der beiden Untersuchungsschritte
- Resümee und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Fallbeispiel l: Jana
- Dyskalkulie-Diagnose (S. 1/3)
- Beispielaufgaben aus ihrem Schulheft (S. 2/3)
- Erste Klassenarbeit der weiterführenden Schule (S. 3/3)
- Probleme mit dem Stellenwertsystem
- Fallbeispiel 11: Katharina
- Dyskalkulie-Diagnose (S. 1/2)
- Beispielaufgaben aus ihrem Schulheft (S. 2/2)
- Beispielaufgaben aus ihrem Schulheft
- Fallbeispiel 111: Miguel
- Diagnose ADHS (S. 1,2)
- Beispielaufgaben aus seinem Schulheft (S. 2/2)
- Beispielaufgaben aus seinem Schulheft
- Beispielaufgaben aus seinem Schulheft
- Gesprächsleitfaden „Rechenstörungen"
- Protokoll des Informationsgesprächs (blanco)
- Protokolle der befragten Lehrer
- Fragebogen (blanco)
- Fragcbögcn der Lehrer
- Fallbeispiel l: Jana
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen der Rechenstörungen und analysiert die verschiedenen Einflussfaktoren, die zu ihrer Entstehung beitragen können. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Im ersten Teil wird eine umfassende Begriffsklärung des Themas „Rechenstörungen" vorgenommen, wobei verschiedene Definitionen und Ansätze aus der Fachliteratur vorgestellt und kritisch beleuchtet werden. Anschließend werden drei Fallbeispiele aus der schulischen Praxis vorgestellt, die das Phänomen der Rechenschwäche bzw. -störung verdeutlichen und die Komplexität des Themas aufzeigen. Im zweiten Teil der Arbeit werden die Ergebnisse von Literaturrecherchen und Lehrerbefragungen dargestellt und ausgewertet, um die Bedeutung der verschiedenen Einflussfaktoren für die Entstehung von Rechenstörungen zu erforschen. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die aktuellen Forschungsansätze diskutiert und es werden Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen.
- Begriffsklärung und Definition von Rechenstörungen
- Darstellung von Fallbeispielen aus der schulischen Praxis
- Analyse von Einflussfaktoren für Rechenstörungen aus der Literatur
- Bewertung von Einflussfaktoren durch Lehrerbefragungen
- Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Rechenstörungen" ein und beleuchtet die Bedeutung des Rechnens als Kulturtechnik und Schlüsselqualifikation. Die Arbeit stellt die Problematik von Rechenstörungen im Kontext des schulischen und beruflichen Erfolgs sowie der psychischen Belastung der Betroffenen dar.
Das Kapitel „Begriffsklärung" analysiert verschiedene Definitionen und Ansätze zum Thema „Rechenstörungen" aus der Fachliteratur. Es werden die phänomenologischen Ansätze und die Diskrepanzdefinitionen vorgestellt und kritisch diskutiert. Die Arbeit zeigt die Schwierigkeiten bei der eindeutigen Definition und Diagnostik von Rechenstörungen auf.
Das Kapitel „Vorstellung der drei Fallbeispiele" präsentiert drei authentische Fallbeispiele aus der schulischen Realität, die das Phänomen der Rechenschwäche bzw. -störung illustrieren. Die Fallbeispiele Jana, Katharina und Miguel zeigen die Vielschichtigkeit des Themas und die unterschiedlichen Einflussfaktoren, die zu Rechenstörungen beitragen können.
Das Kapitel „Einflussfaktoren für Rechenstörungen" widmet sich der Analyse der verschiedenen Faktoren, die die Entstehung von Rechenstörungen begünstigen können. Es werden die drei wesentlichen Einflussfelder „Kind", „Schule" und „Soziokulturelles und familiäres Umfeld" vorgestellt und die wichtigsten Einflussfaktoren innerhalb dieser Felder erläutert. Die Arbeit zeigt die komplexe Wechselwirkung der verschiedenen Faktoren auf und stellt verschiedene multikausale Erklärungsmodelle vor.
Das Kapitel „Evaluation der Literaturrecherchen" bewertet die Ergebnisse der Literaturrecherchen und zeigt die Schwierigkeiten bei der eindeutigen Identifizierung von Ursachen für Rechenstörungen auf. Die Arbeit stellt fest, dass es viele verschiedene Ansätze und Interpretationen gibt und dass ein Konsens bezüglich der Ursachen noch nicht erreicht wurde.
Das Kapitel „Lehrerbefragungen zu den Einflussfaktoren für Rechenstörungen" präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, die an einer Recklinghäuser Gesamtschule durchgeführt wurde. Die Untersuchung bestand aus zwei Teilen: Informationsgesprächen mit Lehrkräften und einer schriftlichen Befragung mithilfe eines Fragebogens. Die Ergebnisse der Befragung werden dargestellt und ausgewertet, um den Informationsstand der Lehrer hinsichtlich der aktuellen Fachliteratur und ihre persönlichen Anschauungen bezüglich der Einflussfaktoren für Rechenstörungen zu erforschen.
Das Kapitel „Darstellung und Ergebnisse der einzelnen Untersuchungsphasen" fasst die Ergebnisse der Informationsgespräche und der Fragebogenbefragung zusammen und bewertet diese im Hinblick auf die Arbeitshypothesen der Untersuchung. Die Arbeit analysiert die Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Lehrerbefragung und den Erkenntnissen aus der Fachliteratur.
Das Kapitel „Resümee und Ausblick" fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen für die Praxis. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, sich zukünftig stärker mit dem Phänomen der Rechenschwäche zu befassen und die universitäre Lehrerausbildung sowie die Fortbildung von Lehrkräften im Bereich „Umgang mit Rechenstörungen" zu verbessern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Rechenstörungen, Dyskalkulie, Rechenschwäche, Einflussfaktoren, familiäres Umfeld, schulisches Umfeld, Lehrerbefragungen, Literaturrecherchen, Diagnose, Therapie, Förderung, Mathematikunterricht, Lehrerausbildung, Schulsystem, Bildung, Lernprozess, Motivation, Konzentration, Selbstwertgefühl, Wahrnehmung, Gedächtnis, Intelligenz.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer Rechenstörung (Dyskalkulie)?
Rechenstörungen bezeichnen erhebliche Schwierigkeiten beim Erlernen mathematischer Grundlagen, die oft durch phänomenologische Ansätze oder Diskrepanzdefinitionen beschrieben werden.
Welche Faktoren beeinflussen die Entstehung von Rechenstörungen?
Es gibt drei Hauptfelder: Faktoren im Kind selbst (z. B. neuropsychologisch), das soziokulturelle/familiäre Umfeld und das schulische Umfeld.
Wie beurteilen Lehrkräfte die Ursachen von Rechenstörungen?
Eine Befragung von Lehrkräften zeigt, dass oft Unklarheit über die Gewichtung der Faktoren herrscht, wobei persönliche Anschauungen und Fachliteratur teilweise voneinander abweichen.
Welche Rolle spielt das Selbstwertgefühl bei betroffenen Kindern?
Rechenstörungen führen oft zu hoher psychischer Belastung, Motivationsverlust und einer Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls bei den Schülern.
Was sind Diskrepanzdefinitionen im Kontext von Lernstörungen?
Diese Definitionen stützen sich auf den Unterschied zwischen der allgemeinen Intelligenz eines Kindes und seinen tatsächlichen Leistungen im Rechnen.
- Quote paper
- Knut Kumpe (Author), 2014, Literaturrecherchen und Lehrerbefragungen zu Einflussfeldern für Rechenstörungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275065