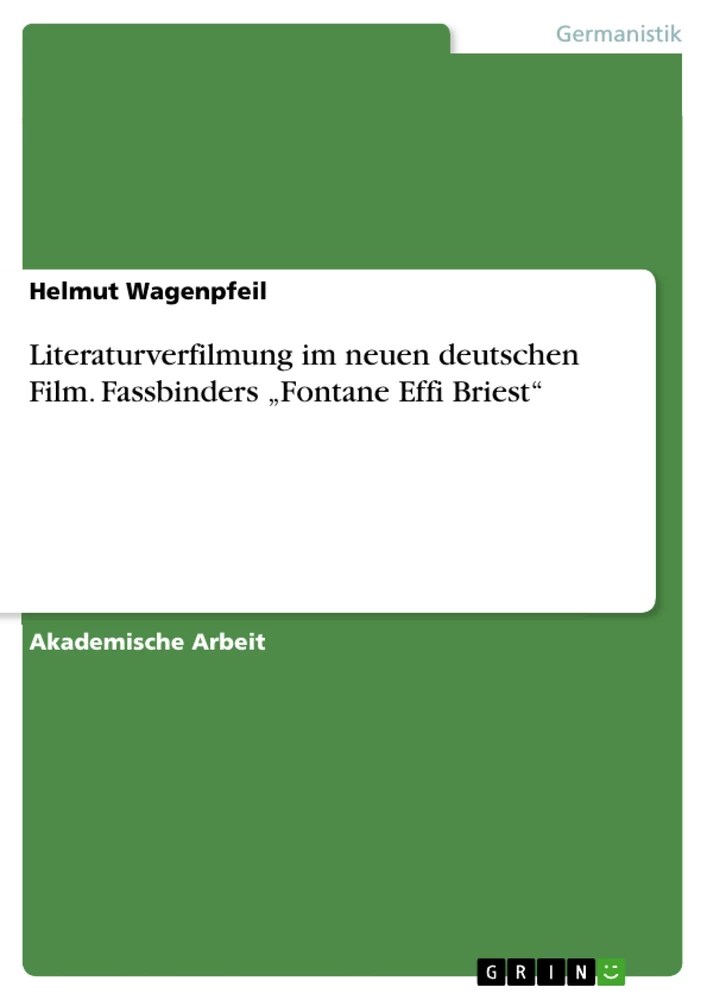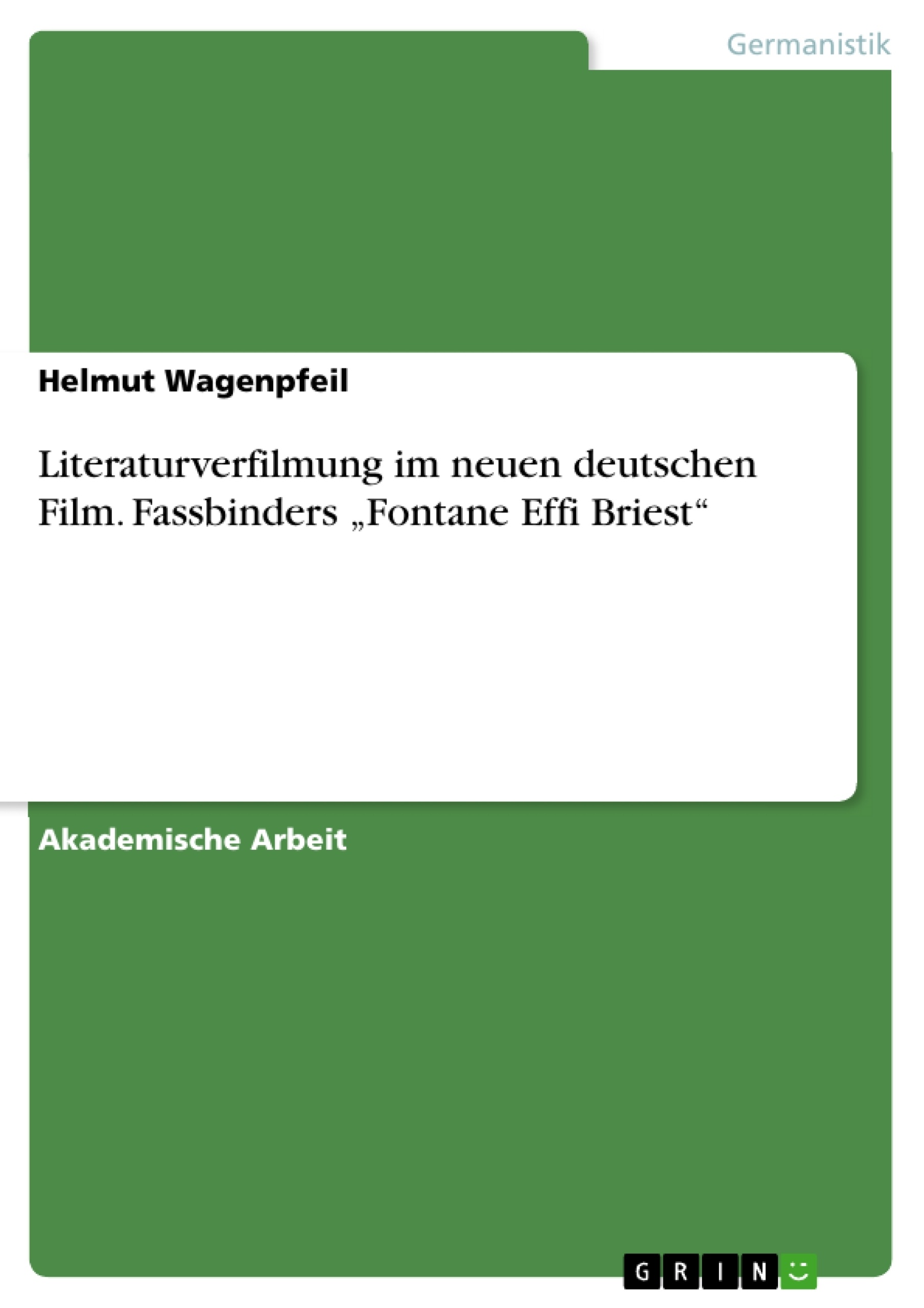Als Louis Lumière 1896 einen Film nach Motiven aus Goethes Faust produzierte, war der Film als solcher gerade ein Jahr alt. Gegen die Widerstände der traditionellen Künste, wie der Literatur oder der Malerei, die der neuen Kunstform der Kinematographie ihre Kunstfähigkeit absprachen, entwickelte sich der Film rasant weiter. Als sich die Auflösungsängste der alten Künste allmählich gelegt hatten, entwickelte sich eine fruchtbare Beziehung zwischen dem Kino und der übrigen Kunst. Im ersten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts entstand sodann eine tiefe Verbindung zwischen Literatur und Film. Das Genre der Literaturverfilmung etablierte sich und somit bewegte sich die Kinematographie auf die Literatur zu. Andersherum fingen berühmte Theaterschauspieler an, in Filmen aufzutreten und der Herausgeber Kurt Pinthus sammelte mit seinem „Kinobuch“ Beiträge namhafter Autoren, wie Else Lasker-Schüler oder Max Brod, für das Kino.
Das Kino konnte sich etablieren und hat die übrigen Kunstformen in der Breite seiner Wahrnehmung, vor allem durch seinen Nachfolger das Fernsehen, weit überflügelt. Heute finden sich kaum noch generelle Vorbehalte gegen die Literaturverfilmung. Dass der Film weniger hochwertige Kunst als die Literatur sei und sich dem Maßstab der „Werktreue“ stellen müsse, ist eine Aussage die zunehmend der Vergangenheit angehört. Die Adaption von Literatur im Film wird heute als eigenständige medienspezifische Ausformung der Literatur gesehen.
Einen großen Beitrag zu dieser Entwicklung leistete das Neue Deutsche Kino. Eine Reihe von jungen Autoren, Regisseuren und Produzenten schloss sich Anfang der sechziger Jahre zusammen, um eine Kampfansage gegen die herrschende Filmpraxis zu machen und den „neuen deutschen Spielfilm“ zu schaffen. Hierbei sollten die „Freiheit von der Beeinflussung durch kommerzielle Partner“, von „branchenüblichen Konventionen“, von der „Bevormundung durch Interessensgruppen“ im Mittelpunkt stehen. Daraus resultierte auch eine neue Sichtweise der Literaturverfilmung.
Aus dem Inhalt:
- Erzählstrukturen,
- Erzählperspektiven,
- Erzählstile,
- umsetzung von Motiven,
- Roman- und Filmfiguren
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung I Hintergründe
- Effi Briest, der Roman
- FONTANE EFFI BRIEST, der Film
- Formale Aspekte
- Erzählstruktur bei Fontane
- Erzählstruktur des Films
- Erzählperspektive bei Fontane
- Erzählperspektive bei Fassbinder
- Erzählstil Fontanes
- Erzählstil Fassbinders
- Inhaltliche Aspekte
- Motive im Roman
- Die Ehe
- Die Ehre
- Gesellschaft versus Individuum
- Symbolhafte Motive
- Das Unheimliche
- Das Schaukel-Motiv
- Wasser / Sumpf
- Motivumsetzung im Film
- Umgang mit dem Motiv Ehe
- Umsetzung des Ehrbegriffs
- Gesellschaft versus Individuum bei Fassbinder
- Umsetzung der symbolhaften Motive
- Das Unheimliche
- Das Schaukelmotiv
- Wasser / Sumpf
- Statuen
- Figuren bei Fontane
- Effi Briest
- Innstetten
- Crampas
- Effis Eltern
- Johanna und Roswitha
- Figuren im Film
- Schauspielführung
- Effi Briest
- Innstetten
- Crampas
- Die Eltern
- Johanna und Roswitha
- Intention des Romans
- Treue zum Original und eigener Anspruch: Fassbinders Intention
- Schlussbetrachtungen
- Quellenverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
- Primärliteratur
- Film
- Sekundärliteratur
- Zur Literaturverfilmung im Allgemeinen
- Zu Max Frisch und „Homo faber"
- Zu Theodor Fontane und „Effi Briest"
- Zu Fassbinder und "Fontane Effi Briest"
- Zeitungsartikel zu Fassbinders Verfilmung
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Verfilmung von Theodor Fontanes Roman „Effi Briest" durch Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1974. Ziel ist es, die filmische Umsetzung des Romans in Bezug auf formale und inhaltliche Aspekte zu analysieren und das Verhältnis zwischen der Vorlage und der Adaption zu beleuchten. Dabei wird insbesondere die Frage nach der Treue zum Original und dem individuellen Anspruch des Filmemachers behandelt.
- Die Ehe als gesellschaftliche Institution und ihre Auswirkungen auf das Individuum
- Der Ehrenkodex der adeligen Gesellschaft und seine Folgen für die Figuren
- Das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft im 19. Jahrhundert
- Die symbolische Bedeutung von Motiven wie dem Unheimlichen, der Schaukel und dem Wasser
- Fassbinders gesellschaftskritische Sichtweise und seine Aktualisierung des historischen Stoffes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Entstehung der Literaturverfilmung als Genre dar und führt in die Besonderheiten des Neuen Deutschen Kinos ein. Anschließend wird auf die Entstehung von Fontanes „Effi Briest" und Fassbinders Verfilmung eingegangen. Im Abschnitt „Formale Aspekte" werden die Erzählstrukturen, Perspektiven und Stile des Romans und des Films gegenübergestellt. Die „Inhaltlichen Aspekte" behandeln die Motive, Figuren und Intentionen der Vorlage und ihre Umsetzung im Film. Die Schlussbetrachtungen fassen die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewerten die Verfilmung in Bezug auf ihre Anspruchserfüllung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Literaturverfilmung, Theodor Fontane, „Effi Briest", Rainer Werner Fassbinder, die adelige Gesellschaft im 19. Jahrhundert, Ehe, Ehre, Individuum versus Gesellschaft, Symbolismus, Filmsprache, Erzähltheorie, Intention, Gesellschaftskritik, Aktualisierung, Filmgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wie nähert sich Fassbinder Fontanes Roman „Effi Briest“?
Fassbinder sieht die Literaturverfilmung als eigenständige medienspezifische Ausformung und bricht mit dem klassischen Maßstab der rein illustrativen „Werktreue“.
Welche zentralen Motive werden im Film umgesetzt?
Zentrale Themen sind die Ehe als gesellschaftliche Institution, der Ehrenkodex der Adelsgesellschaft und der Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft.
Welche Symbole spielen in der Verfilmung eine Rolle?
Wichtige Symbole sind das Schaukel-Motiv, das Unheimliche (der Chinese), sowie die Elemente Wasser und Sumpf.
Was zeichnet den Erzählstil von Fassbinder aus?
Fassbinder nutzt spezifische formale Mittel des Neuen Deutschen Films, um die Distanz und die gesellschaftliche Enge des 19. Jahrhunderts spürbar zu machen.
Welche Rolle spielt das „Neue Deutsche Kino“ für die Literaturverfilmung?
Es forderte die Freiheit von kommerziellen Konventionen und ermöglichte eine neue, oft gesellschaftskritische Sichtweise auf literarische Klassiker.
- Motive im Roman
- Citar trabajo
- M.A. Helmut Wagenpfeil (Autor), 2003, Literaturverfilmung im neuen deutschen Film. Fassbinders „Fontane Effi Briest“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275386