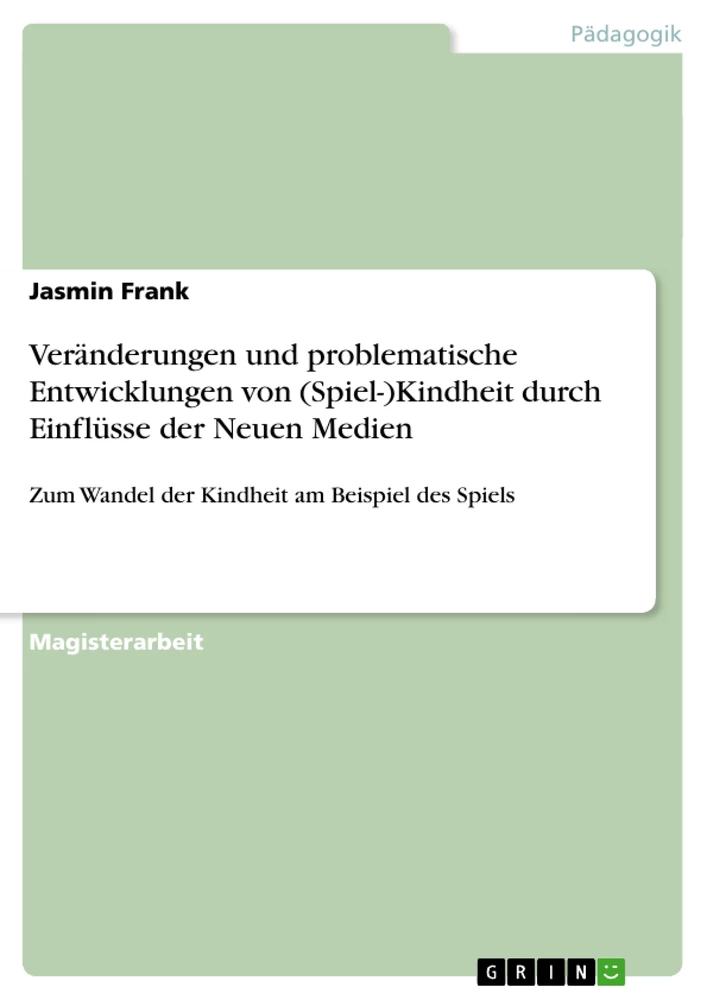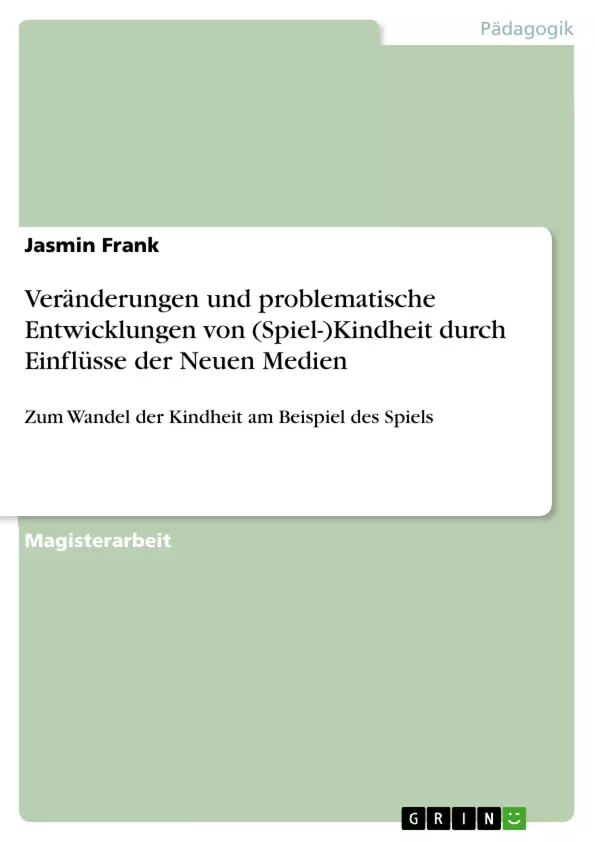In der vorliegenden Magisterarbeit wird nach Zusammenhängen zwischen der Ausbreitung moderner Massenmedien (Fernsehen, Computer, Internet), Medienkonsumverhalten und kindlicher Entwicklung gefragt. Hierzu wird zunächst eine These von Neil Postman analysiert, die besagt, dass Kindheit seit den 70er Jahren zunehmend verschwinde, indem Erwachsene und Kinder sich einander angleichen und das klassische Kinderspiel verdrängt werde. Der Schuldige bei Postman ist schnell gefunden: Das Fernsehen. Die vorliegende Arbeit schaut genauer hin und zeigt, dass Kinder nicht so viel fernsehen wie es uns unsere ausschnitthafte, subjektive Wahrnehmung vorgaukelt und dass der - trotz allem unstreitbar gestiegene Fernsehkonsum - nicht zwangsläufig einhergeht mit Verzicht auf das traditionelle Spiel. Zudem wird gezeigt, dass nicht allein Fernsehen für die Veränderungen innerhalb moderner Kindheiten verantwortlich zeichnet, sondern ebenso die Umwelt, die hauptsächlich von Erwachsenen für Erwachsene gemacht ist. In einem letzten Schritt werden verschiedene Problematiken der zuvor gezeigten Entwicklungslinien aufgezeigt und entsprechende Lösungsansätze präsentiert.
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- I Zum Zusammenhang von Kindheit und Spiel(en)
- 1.1 Kindheit
- 1.1.1 Kindheit bei Postman
- 1.2 Spiel(en)
- 1.2.1 Die allgemeine Bedeutung des Spiels innerhalb der Kindheit
- 1.2.2 Das Spiel bei Postman
- 1.2.3 Die Bedeutung des Spiels nach Winnicott
- 1.2.4 Spiel bei Mead - „Game", „play" und die Entwicklung des Selbst
- 1.2.4.1 Play
- 1.2.4.2 Exkurs: Das Selbst
- 1.2.4.3 Game
- 1.3 Zwischenzusammenfassung
- II Veränderungen des Spiels - Veränderungen der Kindheit
- 11.1 Zur Entwicklung von der Straßenkindheit zur verhäuslichten Kindheit
- 11.1.1 Gründe für die „Verhäuslichung" von (Spiel-)Kindheit
- 11.1.2 Negative Aspekte des Straßenspiels
- 11.1.3 Positive Aspekte des verhäuslichten Spiels
- 11.2 Wie oft, wie lange, wo und was spielen Kinder heute?
- 11.2.1 Zur allgemeinen mediengestützten Freizeitgestaltung von Kindern
- 11.2.2 Fernsehen
- 11.2.3 Spielen am Computer
- 11.3 Qualitative Veränderungen des Kinderspiels durch Bildschirmmedien
- 11.3.1 Wie Fernsehen das Kinderspiel beeinflusst
- 11.3.2 Wie der Computer das Kinderspiel verändert
- 11.3.2.1 Sind Computerspiele echte Spiele?
- 11.3.2.2 Wie sich Spielen am Computer vom traditionellen Spielen unterscheidet
- 11.3.2.3 Was beim Spielen am Computer nicht gelernt wird
- III. 'Medien-Kindheit' als Problemfeld moderner Pädagogik
- 111.1 Postmans medienzentrierter Sozialisationsbegriff in der Kritik
- 111.2 Problematiken medienbehafteter Sozialisation
- 111.2.1 Wahrnehmungsveränderungen durch Mediensozialisation als Problem und Chance
- 111.2.1.1 Schwierigkeiten des Unterscheidens
- 111.2.1.2 Optionenvielfalt und Schwierigkeiten sich zu entscheiden
- 111.2.1.3 Veroberflächlichung der Wahrnehmungstätigkeit
- 111.2.2 „Anerzogene" Unfähigkeit zu spielen?
- 111.2.3 Der „Kind-Erwachsene" oder der „Narzißtisch geprägte Sozialisationstyp" als Sozialcharakter der Moderne?
- 111.2.3.1 Der Kind-Erwachsene
- 111.2.3.2 Der narzißtisch geprägte Sozialisationstyp
- IV. Die Zukunft der (Spiel-)Kindheit zwischen freiem Spiel und Medienkonsum
- IV.I Bewahrpädagogische Ansätze
- IV.I.I Kontrolle der Informationsumgebung
- IV.l.2 Wiederbelebung des freien Spiels im öffentlichen Raum
- IV.2 Subjektorientierte Ansätze
- IV.2.1 Nachspielen von Medienerlebnissen
- IV.2.2 Etablierung einer medienbezogenen Gesprächskultur
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Verzeichnis verwendeter Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern sich die Sozialisation von Kindern durch den Einfluss Neuer Medien verändert hat und welche Auswirkungen diese Veränderungen auf die Lebensphase Kindheit haben. Der Fokus liegt dabei auf dem Kinderspiel als Indikator für kindliche Sozialisationsprozesse und als Ausdruck von Kindheit.
- Veränderung des Kinderspiels durch die Verhäuslichung von Kindheit
- Einfluss von Bildschirmmedien auf das Spielverhalten von Kindern
- Qualitative Veränderungen des Kinderspiels durch den Einfluss von Medieninhalten
- Problematiken medienbehafteter Sozialisation
- Pädagogische Ansätze zum Umgang mit den Auswirkungen von Medien auf die Kindheit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert den Zusammenhang von Kindheit und Spiel(en) und definiert die beiden Begriffe. Es werden außerdem die Theorien von Postman, Mead und Winnicott zum Thema Spiel und Sozialisation vorgestellt.
Kapitel II widmet sich den Veränderungen des Kinderspiels und der Kindheit im Allgemeinen. Es werden die Entwicklung von der Straßenkindheit zur verhäuslichten Kindheit sowie die quantitative und qualitative Veränderung des Spielverhaltens durch den Einfluss Neuer Medien beschrieben.
Kapitel III beleuchtet die Problematiken, die aus einer durch Neue Medien geprägten Sozialisation resultieren können. Es wird Postmans medienzentrierter Sozialisationsbegriff kritisch betrachtet und die Problemfelder Wahrnehmungsveränderungen, „anerzogene" Unfähigkeit zu spielen und der „Kind-Erwachsene" oder der „Narzißtisch geprägte Sozialisationstyp" als Sozialcharakter der Moderne diskutiert.
Kapitel IV stellt verschiedene pädagogische Ansätze zum Umgang mit den Auswirkungen von Medien auf die Kindheit vor. Es werden bewahrpädagogische Ansätze wie die Kontrolle der Informationsumgebung und die Wiederbelebung des freien Spiels im öffentlichen Raum sowie subjektorientierte Ansätze wie das Nachspielen von Medienerlebnissen und die Etablierung einer medienbezogenen Gesprächskultur beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Kindheit, das Kinderspiel, die Sozialisation, Neue Medien, Bildschirmmedien, Medienkonsum, Verhäuslichung, Mediensozialisation, Wahrnehmungsveränderungen, „Kind-Erwachsener", „Narzißtisch geprägter Sozialisationstyp", bewahrpädagogische Ansätze, subjektorientierte Ansätze, Medienpädagogik.
- Citation du texte
- Jasmin Frank (Auteur), 2014, Veränderungen und problematische Entwicklungen von (Spiel-)Kindheit durch Einflüsse der Neuen Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275622