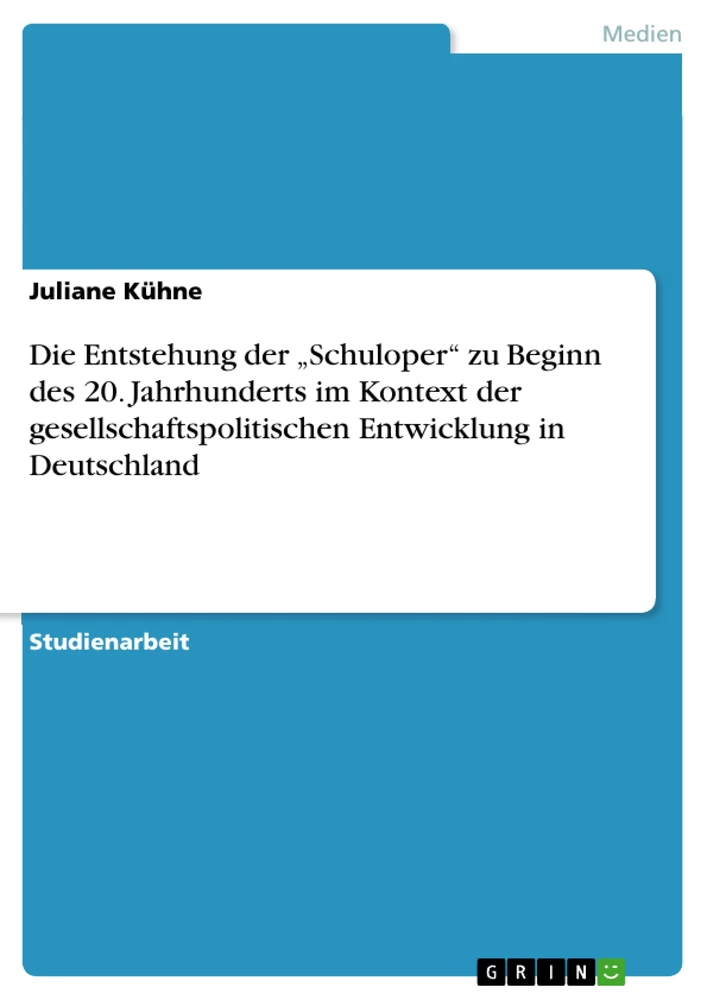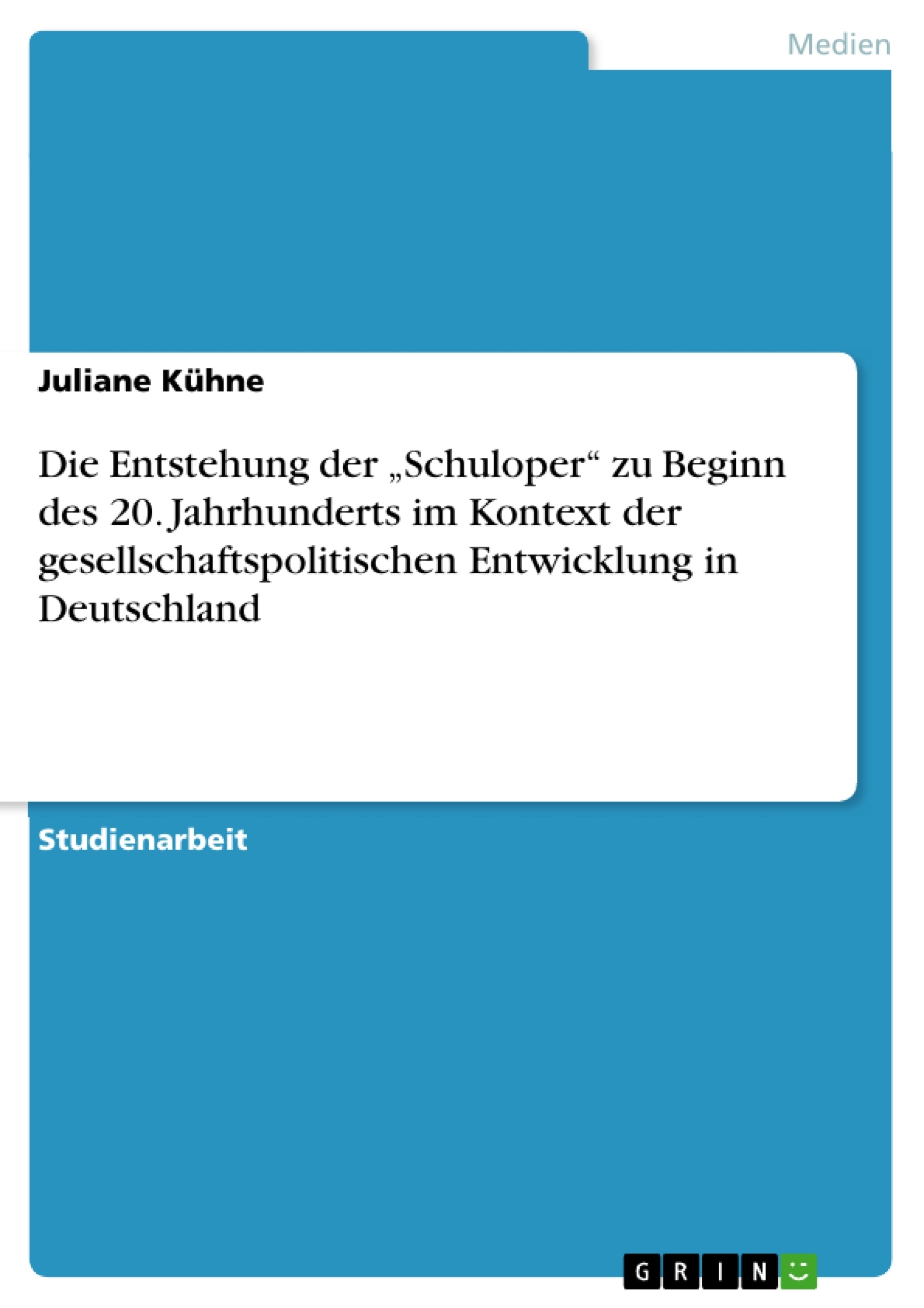Die Beeinflussung von Denken und Handeln, also Indoktrination und Manipulation, sind Themen, die mich nicht erst seit meinem Lehramtsstudium beschäftigen. Musik wurde und wird dabei oft zum Erreichen bestimmter, auch erzieherischer Ziele eingesetzt. Und wann
scheint dies offensichtlicher der Fall gewesen zu sein als in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts? Und zu keiner Zeit scheint es so offensichtlich um zumeist inhumane Ziele gegangen zu sein.
Aber ist denn die Zielsetzung das entscheidende Kriterium, um Beeinflussung durch Musik gut oder schlecht zu heißen? Oder müsste man nicht Manipulation und Indoktrination mittels Musik grundsätzlich ablehnen? Ohne die Frage hier beantworten zu können, kann man aber davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche solchen Erziehungsmaßnahmen besonders wehrlos ausgeliefert sind. Musik für die Gruppe der Heranwachsenden war schon immer mit bestimmten Zielen verknüpft, und seien es „nur“ allgemeinerzieherische oder musikpädagogische.
Ich möchte hier der Frage nachgehen, welche esellschaftspolitischen und musikalischen Entwicklungen zur Entstehung des „Jasager“ von Brecht und Weill führten – „das erste als „Schuloper“ bezeichnete musikalische Werk des 20. Jahrhunderts“ (Brock 1978: 77), welche Ziele beide verfolgten und welche Reaktionen sie letztendlich hervorriefen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Musiktheater für Kinder und Jugendliche
- Reformpädagogik und Jugendmusikbewegung
- Kulturpolitische Entwicklungen
- Neue Musik in Donaueschingen und Baden-Baden
- Exkurs: Gebrauchsmusik
- Episches Theater bei Brecht
- Der Lehrstückgedanke
- Brecht/Weills „Der Jasager"
- Der Gestus in der Musik
- Musikalische Synthese und Verfremdung
- Schuloperkomposition und das Prinzip der Einfachheit
- „Der Jasager (11)" und „Der Neinsager"
- Schulopern nach 1930
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
- Noten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Hausarbeit analysiert die Entstehung der „Schuloper" zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland, insbesondere am Beispiel von Brecht/Weills „Der Jasager". Die Arbeit untersucht die gesellschaftspolitischen und musikalischen Entwicklungen, die zur Entstehung der „Schuloper" führten, sowie die Ziele und Reaktionen, die mit diesem neuen Genre verbunden waren.
- Die Entwicklung der „Schuloper" im Kontext der Reformpädagogik und Jugendmusikbewegung
- Der Einfluss von Brechts epischem Theater und Lehrstückgedanken auf die „Schuloper"
- Die musikalischen Besonderheiten von Weills „Der Jasager", insbesondere die Anwendung des „Gestus" und die Synthese von klassischer und populärer Musik
- Die pädagogische Funktion der „Schuloper" und die Kritik an der Botschaft von „Der Jasager"
- Die Weiterentwicklung des „Jasager" zu „Der Neinsager" und die Bedeutung des „Einverständnisses" als zentrales Thema
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Frage nach der Beeinflussung von Denken und Handeln durch Musik, insbesondere im Kontext der 1930er Jahre. Sie beleuchtet die besondere Bedeutung von Musik für Kinder und Jugendliche und skizziert die historische Entwicklung des Musiktheaters für diese Altersgruppe.
Kapitel 3 widmet sich der Reformpädagogik und der Jugendmusikbewegung, die im frühen 20. Jahrhundert eine neue Sicht auf Kindheit und Jugend einleiteten. Die Betonung des Schöpferischen und Kreativen führte zu einer verstärkten Bedeutung von Musik und bildender Kunst in der Erziehung. Die Jugendmusikbewegung strebte nach einer einfachen, volkstümlichen Musik, die von vielen Menschen „gebraucht" und „getätigt" werden sollte.
Kapitel 4 beleuchtet die kulturpolitischen Entwicklungen nach dem Ersten Weltkrieg. Die bürgerliche Mittelschicht verlor an Einfluss, während neue Schichten sich für Unterhaltungsformen wie Operetten, Revuen und Sportveranstaltungen interessierten. Die Neue Musik hatte es schwer, sich gegen den Widerstand des etablierten Musikbetriebs durchzusetzen. Die Komponisten suchten nach einem Mittelweg zwischen klassisch-romantischen und zeitgenössischen Strömungen, um neue Publikumsschichten zu erschließen. Das Konzept der autonomen Kunst wurde in Frage gestellt und durch eine Politisierung der Kunst ersetzt. Die Neue Musik suchte nach einer gesellschaftlichen Funktion und einem „Gebrauch", um eine größere Relevanz zu erlangen.
Kapitel 5 analysiert Brecht/Weills „Der Jasager" als erste „Schuloper" des 20. Jahrhunderts. Das Stück entstand im Kontext des Festivals „Neue Musik Berlin 1930" und wurde von Brecht und Weill als Experiment im Sinne des Lehrstücks konzipiert. Die Arbeit untersucht die musikalischen Besonderheiten von Weills Komposition, insbesondere die Anwendung des „Gestus" und die Synthese von klassischer und populärer Musik. Sie beleuchtet auch die pädagogische Funktion der „Schuloper" und die Kritik an der Botschaft von „Der Jasager", die sowohl von rechtskonservativen als auch von linken Kritikern geäußert wurde.
Kapitel 6 befasst sich mit den beiden Versionen von „Der Jasager" und „Der Neinsager". Brecht entwickelte eine alternative Version des „Jasager", die den Titel „Der Jasager (11)" trägt. In dieser Version wird der „Brauch" des Talsturzes in Frage gestellt und der Knabe verweigert sein Einverständnis. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede zwischen den beiden Versionen und die Bedeutung des „Einverständnisses" als zentrales Thema.
Kapitel 7 gibt einen kurzen Überblick über Schulopern, die nach 1930 entstanden sind. Die Arbeit stellt einige Beispiele für Schulopern vor, die in unterschiedlichen Richtungen entstanden sind, und zeigt, dass die „Schuloper" als Genre nach dem Erfolg von „Der Jasager" eine gewisse Popularität erlangte.
Die Schlussbemerkung fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und betont die Bedeutung von Musik als Träger von Ideologien. Die Arbeit plädiert für eine kritische Auseinandersetzung mit Musik und für eine Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Musik nicht nur „kulinarisch zu genießen", sondern auch hinterfragen zu können.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Entstehung der „Schuloper", die Reformpädagogik, die Jugendmusikbewegung, Brechts episches Theater und Lehrstückgedanke, Weills „Der Jasager", die musikalische Synthese und Verfremdung, die pädagogische Funktion der „Schuloper" sowie die Kritik an der Botschaft von „Der Jasager".
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine "Schuloper"?
Die Schuloper ist ein im frühen 20. Jahrhundert entstandenes Genre, das musikpädagogische Ziele verfolgt und oft für die Aufführung durch Schüler konzipiert wurde.
Welche Bedeutung hat "Der Jasager" von Brecht und Weill?
Es gilt als das erste als „Schuloper“ bezeichnete Werk des 20. Jahrhunderts und basiert auf dem Lehrstückgedanken von Bertolt Brecht.
Wie hängen Reformpädagogik und Schuloper zusammen?
Die Reformpädagogik betonte das Schöpferische und Kreative, was zur Entwicklung neuer Formen des Musiktheaters für Kinder und Jugendliche führte.
Was unterscheidet "Der Jasager" von "Der Neinsager"?
Während im ersten Stück das Einverständnis mit dem Brauch im Vordergrund steht, verweigert der Knabe im "Neinsager" die Zustimmung zu einer inhumanen Tradition.
Was versteht man unter "Gebrauchsmusik"?
Es ist Musik, die nicht für den reinen Konzertsaal ("kulinarischer Genuss"), sondern für einen bestimmten Zweck oder eine soziale Funktion (z.B. Erziehung) geschaffen wurde.
- Quote paper
- Juliane Kühne (Author), 2013, Die Entstehung der „Schuloper“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Kontext der gesellschaftspolitischen Entwicklung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275637