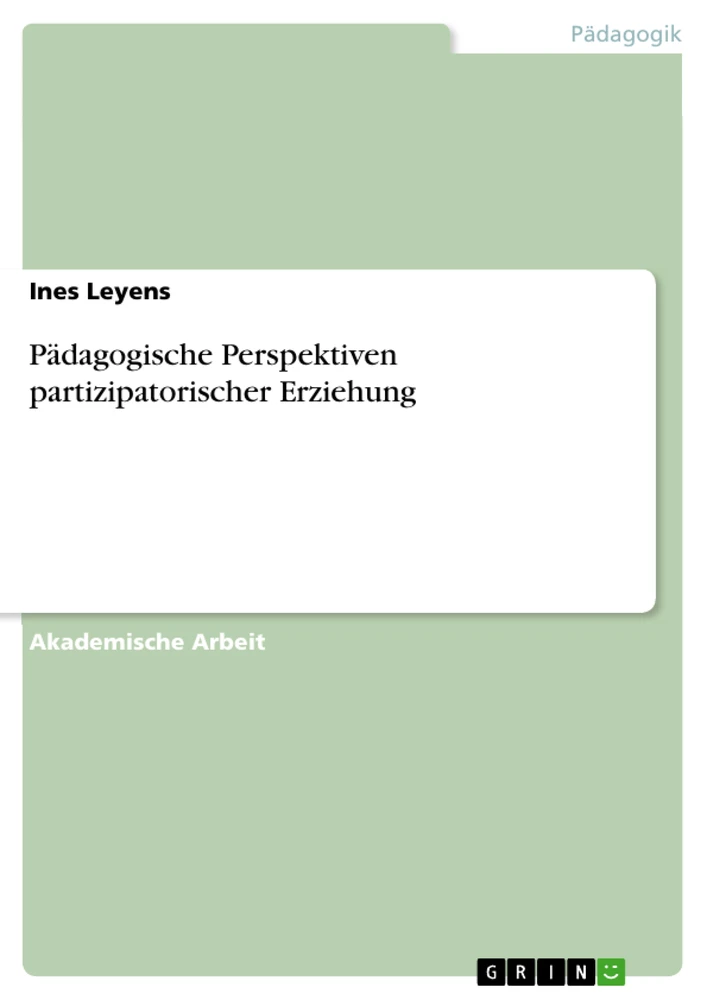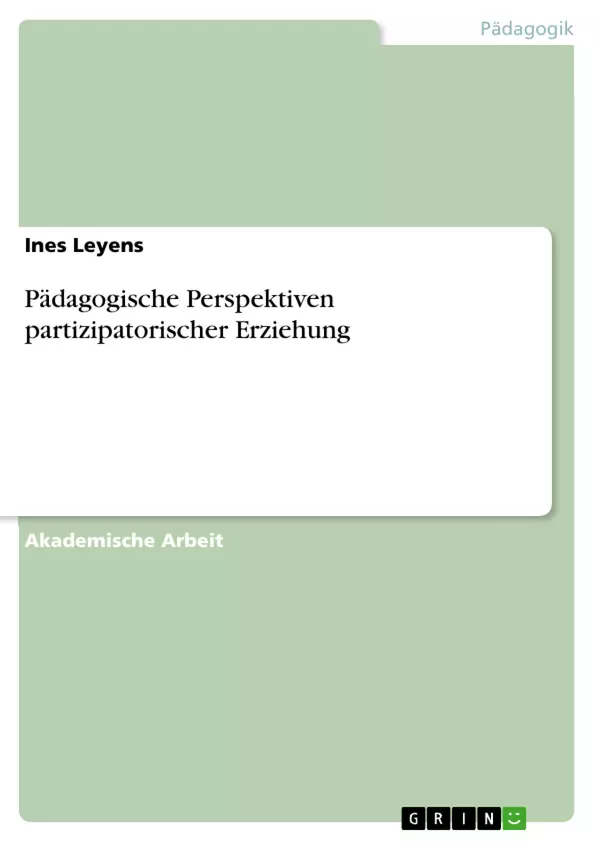Das Ziel von Erziehung ist die Mündigkeit eines Menschen, welches man nur durch einen emanzipatorischen Erziehungsstil erreicht. Emanzipatorische Erziehung soll zur Selbstbestimmung befreien (vgl. Roth, 1971). In der partizipatorischen Erziehung lassen die ErzieherInnen mehr Spielraum für selbständiges Entscheiden und Handeln zu, sie respektieren das kindliche Bedürfnis, „etwas selbst tun“ zu dürfen. Die demokratische Kooperation soll den Willen zeigen, die Kinder an Entscheidungs- und Lernprozessen zu beteiligen und Konflikte auf demokratische Weise zu regeln. Offene Diskussionen mit vernünftigen Argumenten, auch Appelle an das Gewissen fördern das schöpferische und problemorientierte Lösungsdenken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Pädagogische Perspektiven der partizipatorischen Erziehung
- Wegbereiter praktizierter Demokratie mit Kindern
- Rousseau, Pestalozzi und Fröbel
- Montessori, Korczak und Freinet
- Summerhill und Neill
- Elterninitiativen, Reggio und Antipädagogik
- Ansprüche der aktuellen Elementarpädagogik
- Veränderte Kindheit
- Ideen, Konzepte und Ansprüche aus praxisorientierter Literatur
- Forderungen des Partizipationsgedankens im Situationsansatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch "Pädagogische Perspektiven partizipatorischer Erziehung" von Ines Leyens befasst sich mit der Entwicklung und den aktuellen Ansprüchen des Mitbestimmungsgedankens in der Erziehung. Die Autorin untersucht dabei, wie sich die Idee der Partizipation in verschiedenen pädagogischen Strömungen vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart entwickelt hat und welche Bedeutung sie für die aktuelle Elementarpädagogik hat.
- Die historischen Wurzeln der Partizipation in der Pädagogik
- Die Bedeutung des Partizipationsgedankens für die Entwicklung des Kindes
- Die Umsetzung von Partizipation in verschiedenen pädagogischen Konzepten
- Die Herausforderungen der Partizipation in der heutigen Gesellschaft
- Die Rolle der Erzieherin in der Förderung von Partizipation
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel des Buches beleuchtet die historischen Wurzeln des Partizipationsgedankens in der Pädagogik. Dabei werden die Ansätze von Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Montessori, Korczak, Freinet und Neill vorgestellt und in Bezug auf ihren Stellenwert für die Mitbestimmung von Kindern diskutiert. Im zweiten Kapitel werden die Ansprüche der aktuellen Elementarpädagogik in den Fokus gerückt. Insbesondere die Veränderungen in der Kindheit und die daraus resultierenden Anforderungen an die Erziehung werden beleuchtet. Außerdem werden aktuelle Konzepte und Ideen aus der praxisorientierten Literatur vorgestellt, die sich mit der Förderung von Selbstbestimmung und Partizipation von Kindern beschäftigen.
Schlüsselwörter
Die Kernthemen des Buches "Pädagogische Perspektiven partizipatorischer Erziehung" sind die pädagogische Förderung von Selbstbestimmung und Partizipation von Kindern. Die Autorin untersucht dabei die historischen Wurzeln des Mitbestimmungsgedankens, aktuelle Herausforderungen und Möglichkeiten der Partizipation sowie die Bedeutung des Situationsansatzes für die Umsetzung von Partizipation in der Elementarpädagogik. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Selbstbestimmung, Partizipation, Mitbestimmung, Demokratie, Situationsansatz, Elementarpädagogik, Kinderrechte, Kinderkonferenzen, pädagogische Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel partizipatorischer Erziehung?
Das Ziel ist die Mündigkeit des Menschen. Durch einen emanzipatorischen Erziehungsstil sollen Kinder zur Selbstbestimmung befähigt werden und lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.
Wer sind wichtige historische Wegbereiter der Partizipation?
Dazu zählen Klassiker wie Rousseau, Pestalozzi und Fröbel sowie Reformpädagogen wie Maria Montessori, Janusz Korczak, Célestin Freinet und A.S. Neill (Summerhill).
Was bedeutet Partizipation im Kontext des Situationsansatzes?
Im Situationsansatz ist Partizipation ein zentrales Prinzip: Kinder werden an Entscheidungs- und Lernprozessen aktiv beteiligt. Ihre aktuellen Lebenssituationen und Bedürfnisse bilden die Grundlage für pädagogisches Handeln.
Welche Rolle nehmen ErzieherInnen in diesem Konzept ein?
ErzieherInnen fungieren als Partner, die Spielräume für selbstständiges Entscheiden lassen, kindliche Bedürfnisse respektieren und Konflikte auf demokratische Weise moderieren.
Wie fördern offene Diskussionen die Entwicklung des Kindes?
Durch den Austausch vernünftiger Argumente wird das schöpferische und problemorientierte Lösungsdenken der Kinder gestärkt, was essenziell für eine demokratische Teilhabe ist.
- Citation du texte
- Oberstudienrätin Ines Leyens (Auteur), 2002, Pädagogische Perspektiven partizipatorischer Erziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275659