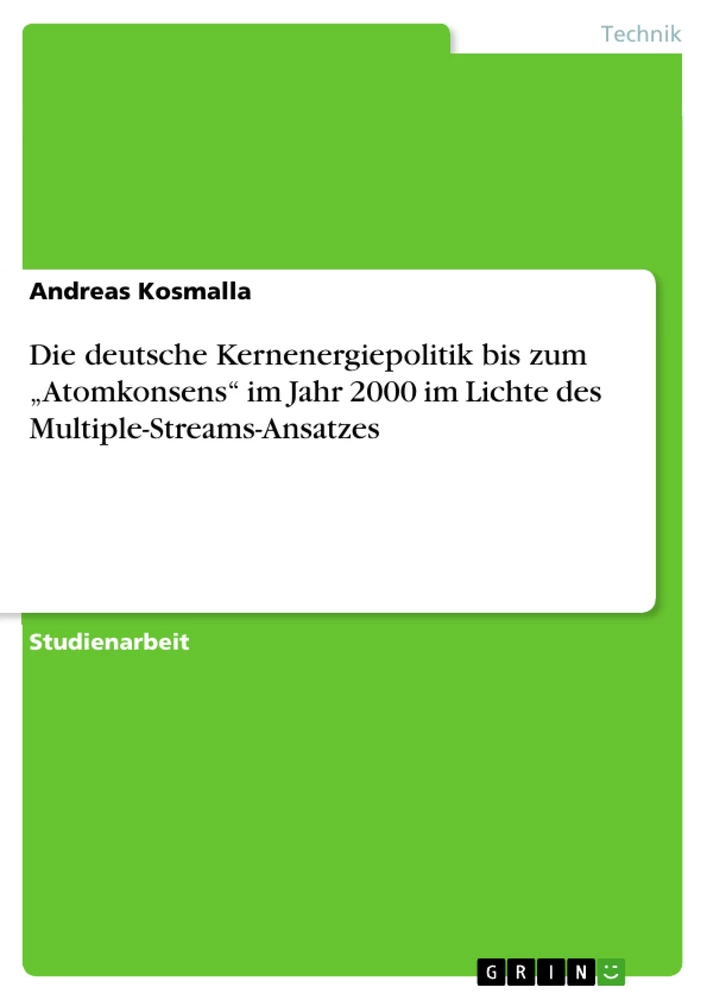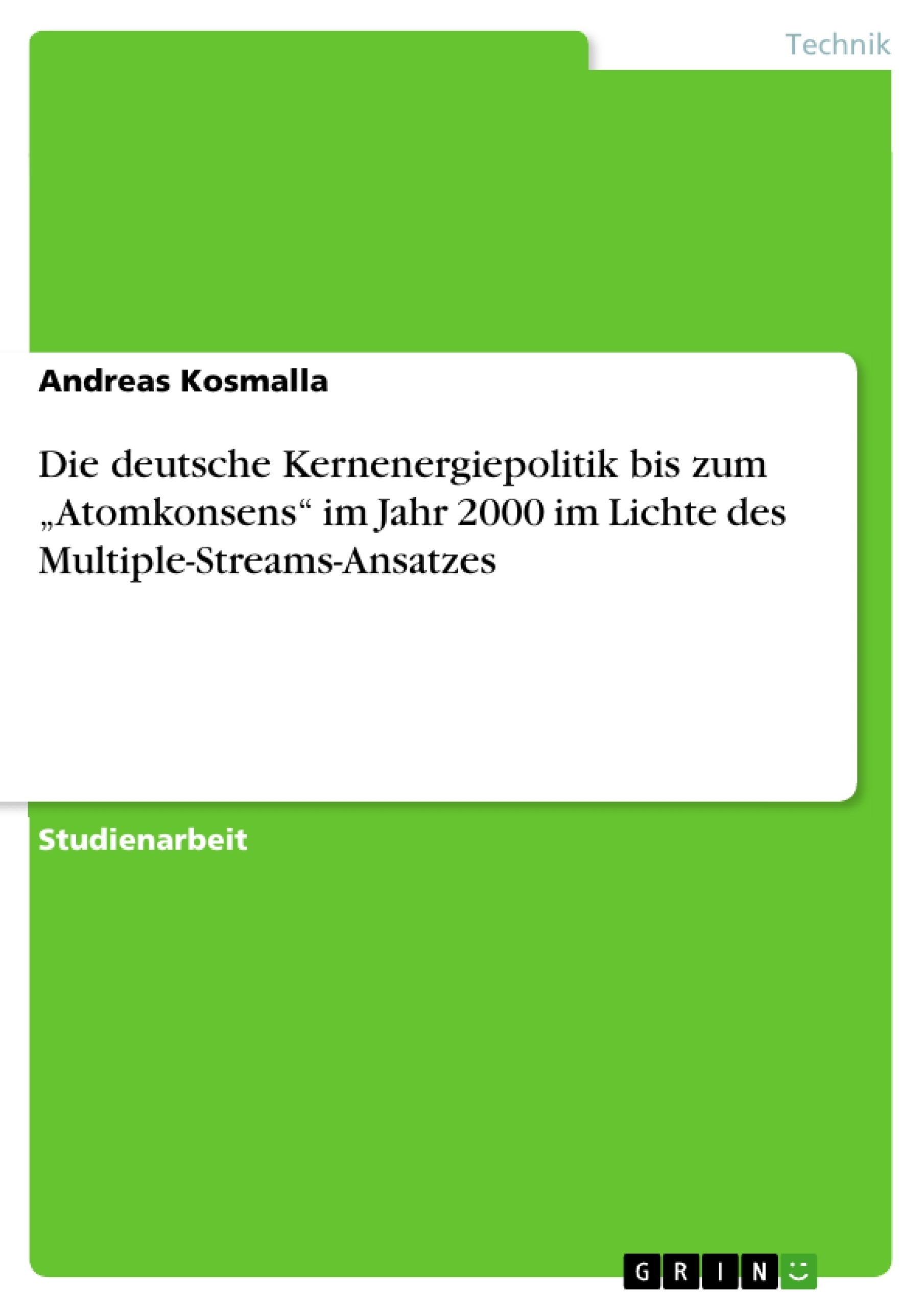Ziel dieser Ausarbeitung war die Klärung der Frage, inwieweit sich das Zustandekommen des „Atomkonsenses“ im Jahr 2000 mit einem nicht von vornherein politische Rationalität unterstellenden Modell wie dem Multiple-Streams-Ansatz von John Kingdon beschreiben und erklären lässt.
In Kapitel 1 werden die theoretischen Grundlagen des Multiple-Streams-Modells vorgestellt. Nach einer Beschreibung allgemeiner Grundannahmen zum politischen Prozess wird zunächst das sogenannte „Garbage-Can-Modell“ von Cohen, March und Olsen vorgestellt, auf dessen Grundlage anschließend Kingdons Modifikationen zum Multiple-Streams-Modell erläutert werden. Es folgt ein historische Kurzüberblick zur deutschen Kernenergiepolitik. Breiten Raum nimmt im nachfolgenden Kapitel 3 die konkrete Identifizierung der „klassischen“ Elemente des Multiple-Streams-Modells im Hinblick auf das betrachtete Fallbeispiel „Kernenergiepolitik“ ein.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Der Multiple-Streams-Ansatz als Erklärungsmodell in der Politikfeldanalyse
- 1.1. Regieren als anarchischer Prozess
- 1.2. Das Garbage-Can-Modell
- 1.3. Auslösebedingungen von Policies
- 2. Kernenergiepolitik in Deutschland bis zum „Atomkonsens“ im Jahr 2000
- 3. Der „Atomkonsens“ im Jahr 2000 als Kopplungsergebnis kontingenter Politikströme
- 3.1. Kernenergie als politischer Problemstrom
- 3.2. Ideen und Optionen im Policy-Strom
- 3.3. Interessen und Ideologien im Strom der „Politics“
- 3.4. Entscheidungsfenster und politisches Unternehmertum
- 4. Fazit
- LITERATUR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die deutsche Kernenergiepolitik bis zum „Atomkonsens“ im Jahr 2000 im Lichte des Multiple-Streams-Ansatzes. Ziel ist es, die Entstehung des „Atomkonsenses“ als Ergebnis kontingenter Politikströme zu erklären und die Anwendbarkeit des Multiple-Streams-Ansatzes auf das Politikfeld Kernenergie zu untersuchen.
- Der Multiple-Streams-Ansatz als Erklärungsmodell für politische Entscheidungen
- Die Entwicklung der deutschen Kernenergiepolitik von ihren Anfängen bis zum „Atomkonsens“
- Die Identifizierung der drei Politikströme (Problemstrom, Policy-Strom, Politics-Strom) im Kontext der Kernenergiepolitik
- Die Rolle von Entscheidungsfenstern und politischem Unternehmertum bei der Entstehung des „Atomkonsenses“
- Die Grenzen und Möglichkeiten des Multiple-Streams-Ansatzes für die Analyse von Politikfeldern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit vor. Kapitel 1 erläutert den Multiple-Streams-Ansatz als Erklärungsmodell für politische Entscheidungen. Es werden die Grundannahmen des Modells, das Garbage-Can-Modell und die Auslösebedingungen von Policies vorgestellt. Kapitel 2 bietet einen historischen Überblick über die deutsche Kernenergiepolitik von ihren Anfängen bis zum „Atomkonsens“ im Jahr 2000. Kapitel 3 analysiert die Entstehung des „Atomkonsenses“ im Lichte des Multiple-Streams-Ansatzes. Es werden die drei Politikströme (Problemstrom, Policy-Strom, Politics-Strom) im Kontext der Kernenergiepolitik identifiziert und die Rolle von Entscheidungsfenstern und politischem Unternehmertum bei der Entstehung des „Atomkonsenses“ untersucht. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Grenzen und Möglichkeiten des Multiple-Streams-Ansatzes für die Analyse von Politikfeldern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Multiple-Streams-Ansatz, die deutsche Kernenergiepolitik, den „Atomkonsens“ im Jahr 2000, politische Entscheidungen, Politikströme, Problemstrom, Policy-Strom, Politics-Strom, Entscheidungsfenster, politisches Unternehmertum, Kontingenz, Rationalität, Politikfeldanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was erklärt der Multiple-Streams-Ansatz (MSA) in dieser Arbeit?
Der MSA nach John Kingdon wird genutzt, um das Zustandekommen des deutschen „Atomkonsenses“ im Jahr 2000 als Ergebnis der Kopplung von Problem-, Policy- und Politics-Strömen zu erklären.
Was ist das „Garbage-Can-Modell“?
Es ist die theoretische Grundlage des MSA, die politische Entscheidungsprozesse als eher anarchisch und ungeplant beschreibt, anstatt von strikter rationaler Planung auszugehen.
Welche drei Ströme werden in der Kernenergiepolitik identifiziert?
Die Arbeit untersucht den Problemstrom (Kernenergie als Risiko), den Policy-Strom (technische und politische Ausstiegsoptionen) und den Politics-Strom (Interessenverbände und Ideologien).
Was ist ein „Entscheidungsfenster“ im Kontext des Atomkonsenses?
Ein Entscheidungsfenster bezeichnet eine günstige Gelegenheit, bei der die drei Ströme zusammengeführt werden können, um eine politische Entscheidung wie den Atomausstieg zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt das „politische Unternehmertum“?
Politische Unternehmer sind Akteure, die aktiv daran arbeiten, die verschiedenen Ströme zum richtigen Zeitpunkt miteinander zu verknüpfen, um ihre politischen Ziele durchzusetzen.
Bis zu welchem Jahr wird die Kernenergiepolitik betrachtet?
Die Analyse umfasst die Entwicklung der deutschen Kernenergiepolitik von den Anfängen bis zum Jahr 2000.
- Citar trabajo
- Andreas Kosmalla (Autor), 2010, Die deutsche Kernenergiepolitik bis zum „Atomkonsens“ im Jahr 2000 im Lichte des Multiple-Streams-Ansatzes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276048