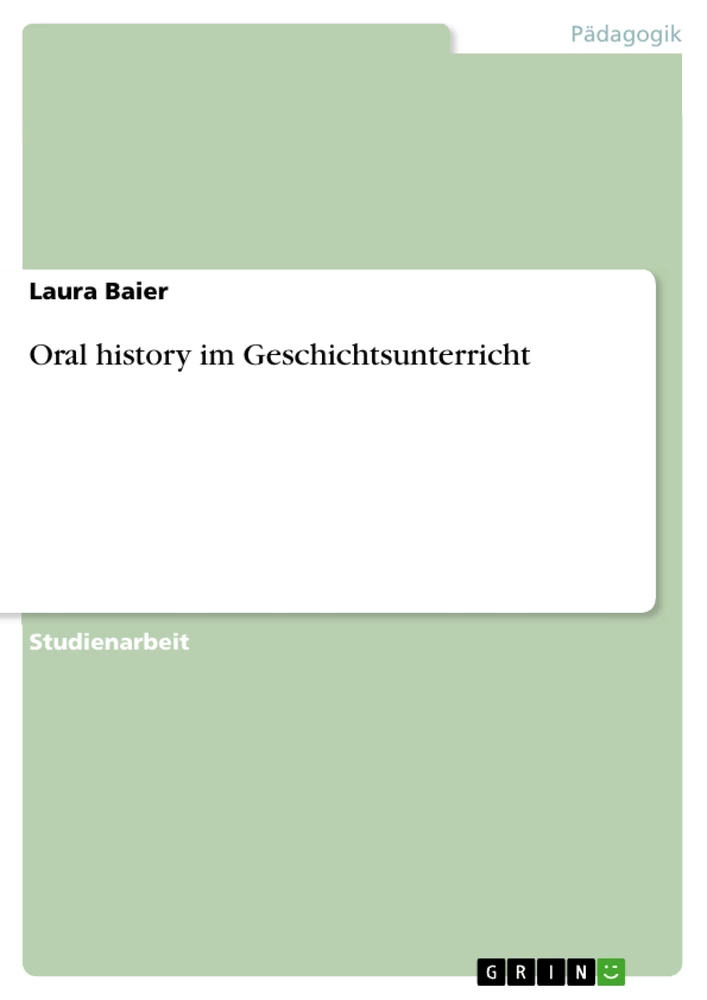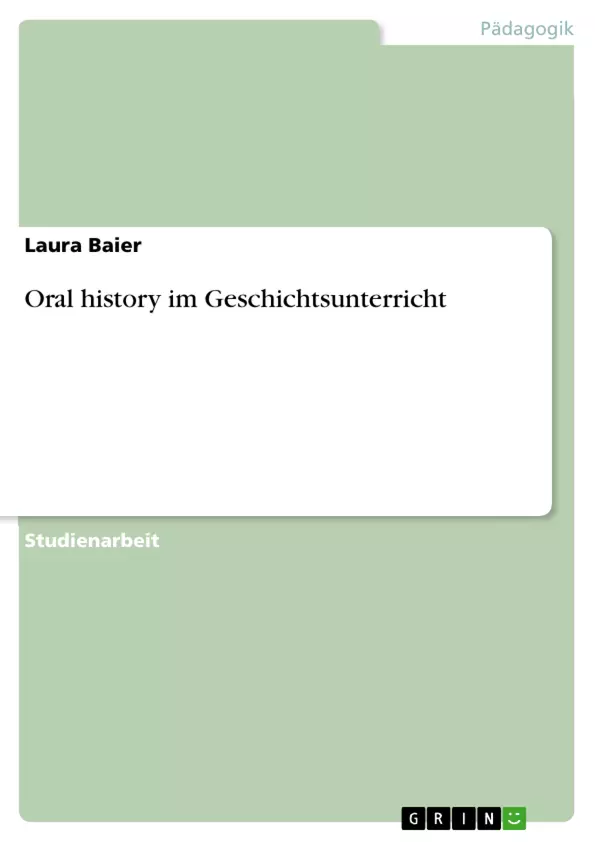Paul Kirn definiert für die Historiographie alle Texte, Gegenstände und Tatsachen, aus denen Erkenntnis aus der Vergangenheit gezogen werden kann, als Quellen. Darunter fällt auch die menschliche Erinnerung, aus der fassbar werden kann, was Menschen aus ihrer Erfahrung unter Einfluss verschiedener Faktoren, z.B. der historischen Situation, der Betrachterperspektive, Erinnerungsfähigkeit und verfügbaren überlieferten Quellen als eigene Geschichte verstehen. Erinnerung ist dabei ein mehrdimensionaler Prozess, da das Erinnerte in der Vergangenheit liegt, der Moment der Erinnerung aber gegenwärtig ist. Cladenius formulierte: „Every man his own history“, womit er darauf anspielt, dass Erinnerung standortgebunden, perspektivisch, relativ, unvollständig und subjektiv ist und dass die Vergangenheit eine andere ist als das rekonstruierte Bild von ihr. Dies führt zu der erkenntnisleitenden Frage „Können vor diesem Hintergrund SchülerInnen im Geschichtsunterricht mit Oral History umgehen?“, die in vorliegender Hausarbeit vom Allgemeinen zum Besonderen untersucht wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zwei Debatten zur Oral History
- Zeitzeugenarbeit im Geschichtsunterricht
- Was ist ein Zeitzeuge?
- Auswahl von und Umgang mit Zeitzeugen vor, während und nach Interviews
- Vorzüge und Bedenken von Oral History im Geschichtsunterricht
- Vorschlag für eine Unterrichtseinheit der Zeitdetektive
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob SchülerInnen im Geschichtsunterricht mit Oral History umgehen können. Sie untersucht die Entstehung und Entwicklung von Oral History sowohl in der Geschichtswissenschaft als auch im Geschichtsunterricht. Die Arbeit analysiert die Vor- und Nachteile der Methode und bietet einen konkreten Unterrichtsvorschlag, der die SchülerInnen zu Zeitdetektiven werden lässt.
- Entwicklung und Etablierung von Oral History in der Geschichtswissenschaft
- Einsatz von Oral History im Geschichtsunterricht
- Vor- und Nachteile der Methode
- Entwicklung eines Unterrichtsvorschlags
- Kompetenzförderung und Lernziele
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Oral History ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Bedeutung von Erinnerung als Quelle für die Geschichtsforschung und die Herausforderungen, die sich aus der Subjektivität und Perspektivität von Zeitzeugen ergeben.
Das zweite Kapitel beleuchtet zwei Debatten zur Oral History. Zunächst wird die Entstehung und Entwicklung der Methode in der Geschichtswissenschaft dargestellt, wobei die Marginalisierung mündlicher Überlieferungen zugunsten schriftlicher Quellen im 19. Jahrhundert und die spätere Etablierung von Oral History als eigenständige Subdisziplin im 20. Jahrhundert thematisiert werden. Anschließend wird die Frage diskutiert, ob SchülerInnen im Geschichtsunterricht mit Oral History umgehen können. Hierbei werden die Vorteile der Methode, wie z.B. die Möglichkeit, Geschichte lebendig und nachvollziehbar zu machen, sowie die Herausforderungen, die sich aus der Subjektivität von Zeitzeugen ergeben, beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich der Zeitzeugenarbeit im Geschichtsunterricht. Es definiert den Begriff des Zeitzeugen und erläutert die Auswahl von und den Umgang mit Zeitzeugen vor, während und nach Interviews. Darüber hinaus werden die Vorzüge und Bedenken von Oral History im Geschichtsunterricht diskutiert, wobei die Bedeutung der kritischen Reflexion von Zeitzeugenberichten und die Notwendigkeit, die Subjektivität der Zeitzeugen zu berücksichtigen, hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Oral History, Zeitzeugenarbeit, Geschichtsunterricht, Methodendebatte, Subjektivität, Perspektivität, Erinnerung, Geschichte von unten, Alltagsgeschichte, Unterrichtsvorschlag, Zeitdetektive, Kompetenzen, Lernziele.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Oral History im Geschichtsunterricht?
Oral History bezeichnet die Nutzung der menschlichen Erinnerung und von Zeitzeugeninterviews als historische Quelle, um Vergangenes aus der subjektiven Perspektive Erlebender fassbar zu machen.
Welche Herausforderungen bietet die Arbeit mit Zeitzeugen?
Herausforderungen liegen in der Subjektivität, Perspektivität und Unvollständigkeit von Erinnerungen sowie der potenziellen Standortgebundenheit des Erzählers.
Welche Vorteile bietet Oral History für Schüler?
Die Methode macht Geschichte lebendig und nachvollziehbar, fördert die Empathie und ermöglicht eine „Geschichte von unten“, die über rein schriftliche Quellen hinausgeht.
Was ist das Konzept der „Zeitdetektive“?
Es handelt sich um einen Unterrichtsvorschlag, bei dem Schüler selbstständig Interviews führen und wie Detektive historische Erkenntnisse aus mündlichen Berichten gewinnen.
Warum wurde Oral History früher in der Geschichtswissenschaft marginalisiert?
Im 19. Jahrhundert wurden schriftliche Quellen als objektiver angesehen; erst im 20. Jahrhundert etablierte sich die Oral History als eigenständige Subdisziplin.
- Citar trabajo
- Laura Baier (Autor), 2014, Oral history im Geschichtsunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276232