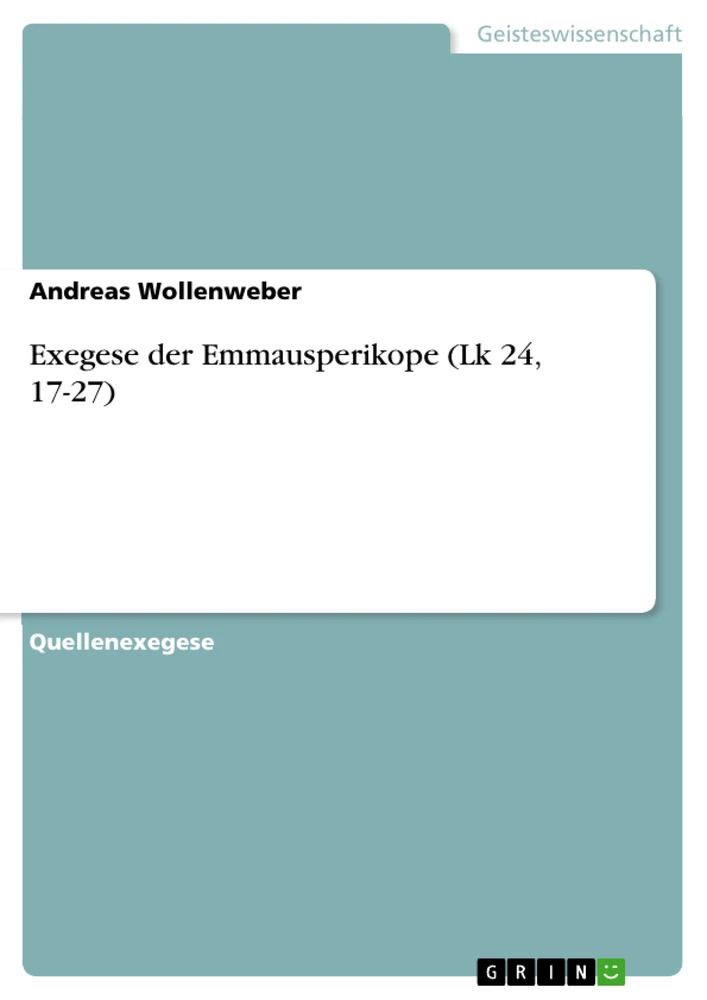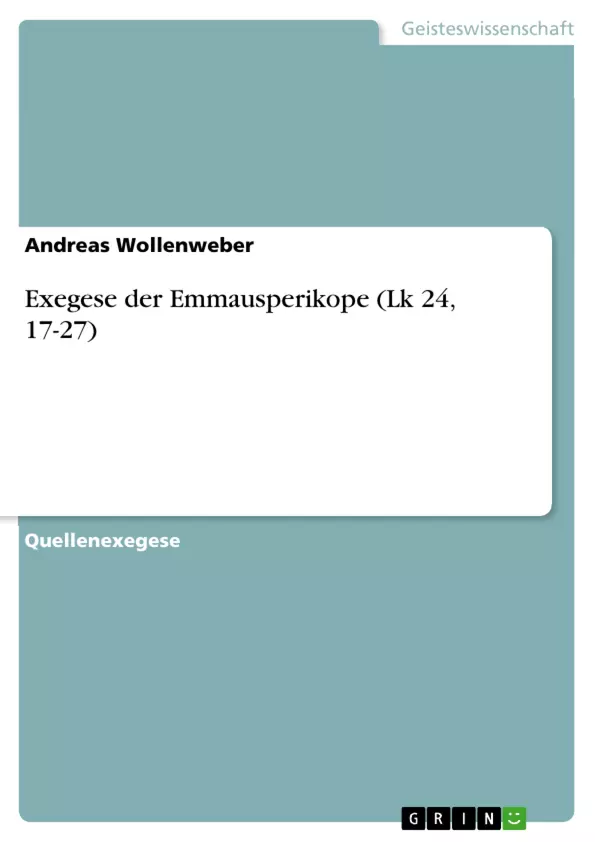Unter den Osterberichten der Evangelien nimmt die Emmauserzählung Lk 24, 17-27 in vielerlei Hinsicht eine Sonderrolle ein: Auffällig ist ihre enorme Länge sowie ihre große Geschlossenheit und Anschaulichkeit der Darstellung. Zudem wird hier nicht von den Aposteln oder anderen aus dem Neuen Testament bekannten Personen berichtet, sondern von zwei unbekannten Jüngern. Jedoch erweist sich die Emmauserzählung wegen ihres besonderen Sinngehalts als besonders widerspenstig gegen alle Harmonisierungen mit den übrigen Ostertraditionen und hat daher in vielen Fällen in der gegenwärtigen Exegese eine deutliche Vernachlässigung erfahren.
Daher soll diese Exegese eine umfassende wissenschaftliche Analyse jener Perikope liefern, welche trotz ihrer inhaltlichen Bedeutung aufgrund der oben genannten Probleme in der bisherigen Forschung eher nebensächlich behandelt worden ist.
Inhaltsverzeichnis
- I: Vorwort.
- II: Textkritik/Textanalyse.
- III: Literarkritik.
- IV: Formgeschichte/Traditionsgeschichte.
- V: Redaktionsgeschichte.
- VI: Begriffs-/Motivgeschichte.
- VII: Religionsgeschichtlicher Vergleich.
- VIII: Übersetzungsvergleich mit dem Urtext.
- IX: Das Fazit der Untersuchung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Exegese der Emmausperikope (Lk 24,17-27) verfolgt das Ziel, eine umfassende wissenschaftliche Analyse dieser Perikope zu liefern. Trotz ihrer inhaltlichen Bedeutung wurde die Emmauserzählung in der bisherigen Forschung aufgrund ihrer besonderen Eigenheiten und ihres widerspenstigen Charakters gegenüber Harmonisierungen mit anderen Ostertraditionen oft vernachlässigt.
- Textkritische und Textanalytische Aspekte der Perikope
- Literarkritische Analyse der Emmauserzählung
- Formgeschichte und Traditionsgeschichte der Emmauserzählung
- Redaktionsgeschichtliche Untersuchung der Perikope
- Begriffs- und Motivgeschichte in Bezug auf die Emmauserzählung
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Die Emmauserzählung nimmt eine besondere Rolle unter den Osterberichten ein, zeichnet sich durch ihre Länge, Geschlossenheit und Anschaulichkeit aus, berichtet von unbekannten Jüngern und erweist sich als widerspenstig gegenüber Harmonisierungen mit anderen Ostertraditionen.
- Textkritik/Textanalyse: Der Kern der Perikope liegt im Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern, eingerahmt von Jesu Auftreten und Verschwinden. Der Text zeigt Symmetrien in der Erzählstruktur, wie beispielsweise die angespannte Diskussion der Jünger und ihre Bitte an Jesus, bei ihnen zu bleiben.
- Literarkritik: Der Dialog in direkter Rede ist ein wichtiges literarisches Stilmittel in der Emmauserzählung. Vergleiche mit anderen Texten, wie den Apostelgeschichten, zeigen lukanische Spracheigentümlichkeiten.
- Formgeschichte/Traditionsgeschichte: Der zentrale Teil der Perikope beinhaltet zwei Zusammenfassungen von Reden, die der Jünger und die Jesu. Es gibt Symmetrien und Inklusionen im Text, die auf die Bedeutung des Geschehens hinweisen.
- Redaktionsgeschichte: Die Emmauserzählung zeigt apologetische Tendenzen im Bezug auf die Rolle der jüdischen Eliten in der Kreuzigung Jesu. Lukas lässt die Jünger ihre messianische Erwartung beschreiben, die durch Jesu Leidens- und Todesgeschick zerstört zu sein scheint.
Schlüsselwörter
Die Emmauserzählung, Textkritik, Textanalyse, Literarkritik, Formgeschichte, Traditionsgeschichte, Redaktionsgeschichte, Begriffsgeschichte, Motivgeschichte, Messiaskonzeptionen, Osterberichten, Emmausjünger, lukanischer Wortgebrauch, apologetische Tendenzen, messianische Erwartung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an der Emmauserzählung (Lk 24, 17-27)?
Sie zeichnet sich durch große Länge, Anschaulichkeit und die Tatsache aus, dass unbekannte Jünger die Hauptrollen spielen.
Warum wurde diese Perikope in der Forschung oft vernachlässigt?
Wegen ihres widerspenstigen Charakters gegenüber Harmonisierungsversuchen mit anderen Ostertraditionen im Neuen Testament.
Welche Rolle spielt die Redaktionsgeschichte bei Lukas?
Lukas zeigt apologetische Tendenzen bezüglich der Rolle jüdischer Eliten und thematisiert die zerstörte messianische Erwartung der Jünger.
Was wird in der Formgeschichte dieser Perikope untersucht?
Sie analysiert die Symmetrien im Text, wie die Zusammenfassungen der Reden der Jünger und Jesu.
Was ist das Ziel dieser wissenschaftlichen Exegese?
Eine umfassende Analyse mittels Text-, Literar-, Form- und Redaktionskritik sowie ein religionsgeschichtlicher Vergleich.
- Citar trabajo
- Andreas Wollenweber (Autor), 2013, Exegese der Emmausperikope (Lk 24, 17-27), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276545