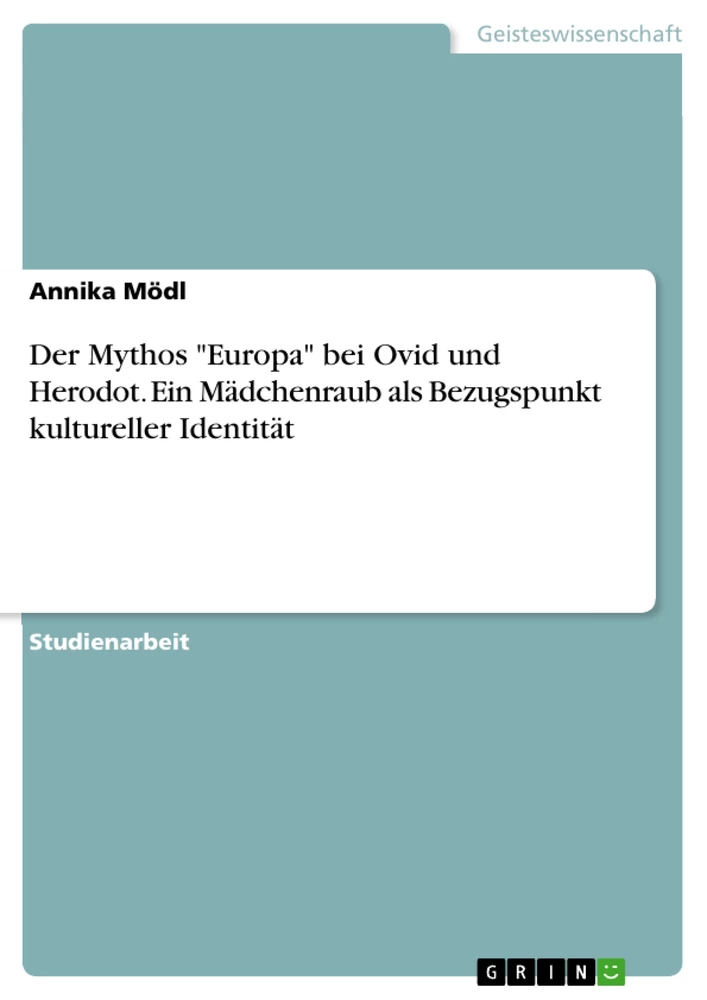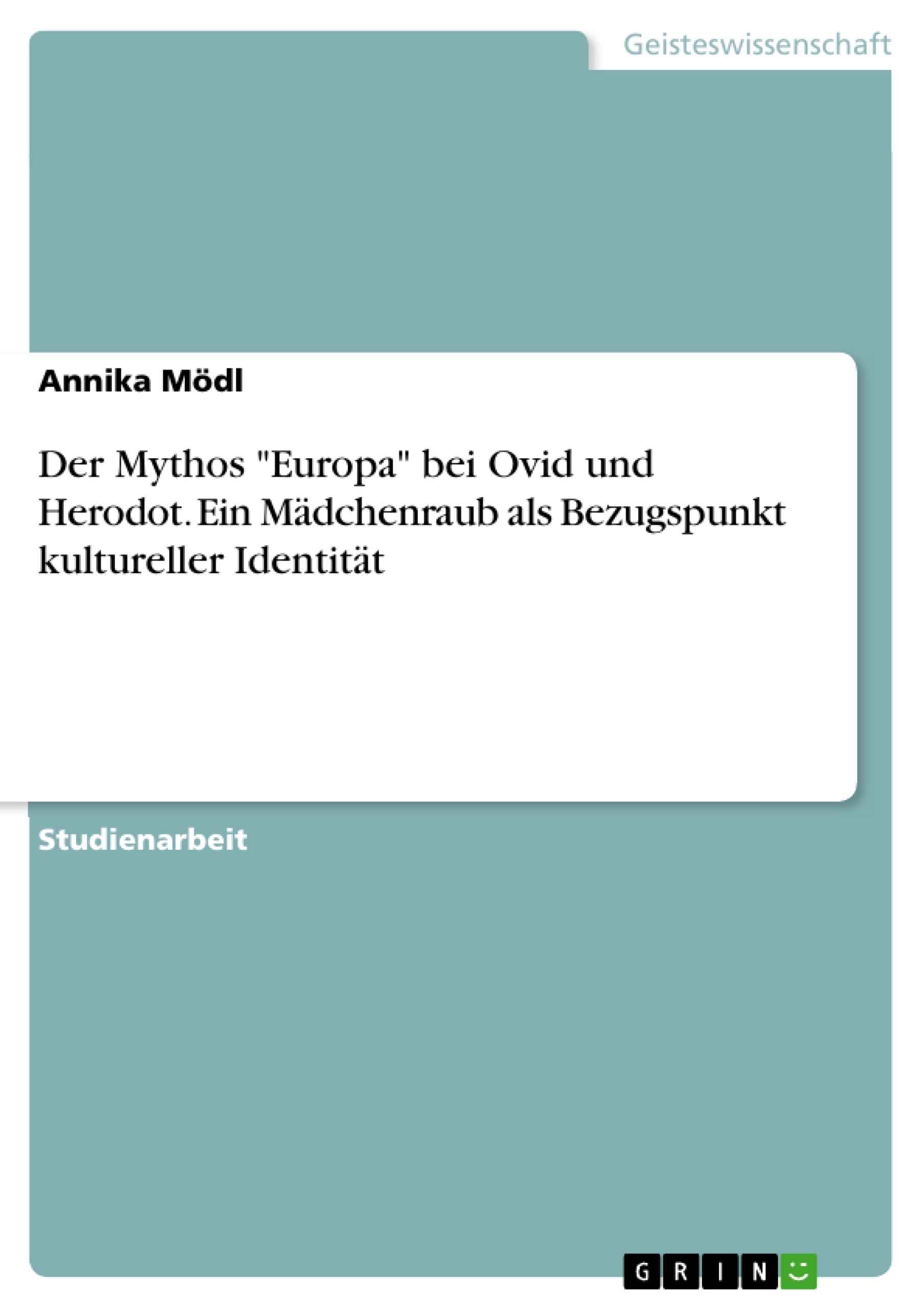Im Zuge des Gesellschaftswandels erfuhr auch der Begriff „Europa“ einen vielfachen Bedeutungswandel. Er wurde auf vielerlei angewandt. Auf die mythologische Königstochter, Erdallegorie, politische Propaganda, Wirtschafts-, Glaubens-, Wertegemeinschaft und die kulturelle Identität. Allerdings war es die mythologische Figur, die den Mythos ins Leben rief und ihm den Nimbus verlieh der ihn auch heute noch auszeichnet. Doch die Herkunft des Wortes bleibt umstritten. In „Europa“ verbirgt sich das asyrische „erp“ (dunkel, finster, wo die Sonne untergeht), romantisierend eindeutig als das Abendland zu verstehen. Das Gegenteil zu „Asien“, dem Morgenland, dem Land der aufgehenden Sonne. Für die ältere Geschichte der Erdteile lässt sich das Gegensatzpaar erp-asis durchaus übertragen. Asien, als Wiege der glänzenden Hochkultur – Europa als finstere, barbarische Peripherie, zu der im Prozess der Zivilisation die Sonne der ersten Hochkulturen nur mühsam durchdrang. Auch die antiken Grammatiker befassten sich mit der Herkunft des Wortes im Hinblick auf die mythologische Person. Sie erkannten „Europa“ als eine Zusammensetzung der Wörter „breit“ und „sehen“, in der Bedeutung „weitsehend“ aufgefasst. Die Versuche moderner Sprachforscher, den Namen aus dem griechischen abzuleiten, müssen als gescheitert angesehen werden. Gegen die wiederholt aufgegriffene griechische Etymologie spricht der unerklärliche Ausfall einzelner Buchstaben. Heute neigt man eher dazu, den vorgriechischen Ursprung anzunehmen. In der folgenden Arbeit möchte ich nicht nur die Herkunft und die Bedeutung des Wortes „Europa“ hinterfragen. Vielmehr soll eine eingehende Betrachtung der Rezeption des Mythos durch Herodot und Ovid erfolgen. Ferner möchte ich der Frage nachgehen, in welcher Weise diese Geschichte um die phönizische Königstochter noch eine Bedeutung für die heutige Gesellschaft haben kann. Braucht Europa überhaupt einen gemeinsamen Mythos und kann ein Mädchenraub als ein solcher fungieren?
Inhaltsverzeichnis
- A. Die Etymologie des Wortes „Europa“
- B. Der Mythos Europa
- I. Die Bedeutung von Mythen
- II. Der Mythos Europa in der Antike
- 1. Der Inhalt der Erzählung
- 2. Der Europamythos in der antiken Literatur
- III. Der Mythos in der Gegenwart
- C. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Etymologie des Wortes "Europa" und die Rezeption des Mythos von Europa bei Herodot und Ovid. Ziel ist es, die Bedeutung dieses Mythos für die heutige Gesellschaft zu hinterfragen und zu analysieren, ob er als Identitätsstifter für Europa fungieren kann und ob die Geschichte eines Mädchenraubs als solcher Mythos tauglich ist.
- Etymologie und Bedeutungswandel des Wortes "Europa"
- Die Rolle von Mythen in der Gesellschaft und ihre Anpassungsfähigkeit
- Der Mythos von Europa in der Antike: Inhalt und Interpretationen
- Die Darstellung des Mythos bei Herodot und Ovid
- Die Relevanz des Mythos für die heutige europäische Identität
Zusammenfassung der Kapitel
A. Die Etymologie des Wortes „Europa“: Der Begriff "Europa" hat im Laufe der Geschichte einen vielschichtigen Bedeutungswandel erfahren, von der mythologischen Königstochter bis hin zu einer kulturellen Identität. Die Herkunft des Wortes ist umstritten; Theorien reichen von einer asyrischen Wurzel ("erp", Abendland) bis hin zu einer griechischen Ableitung, die jedoch als gescheitert gilt. Die Arbeit beleuchtet diese Debatte und führt in die Thematik ein, indem sie die vielschichtigen Bedeutungen und die historisch-kulturelle Entwicklung des Begriffs "Europa" aufzeigt und die Schwierigkeiten bei der Deutung des Wortursprungs hervorhebt.
B. Der Mythos Europa: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Mythos um den Raub der Europa. Es beleuchtet zunächst die Bedeutung von Mythen im Allgemeinen, ihre Fähigkeit, gesellschaftliche Verhältnisse zu erklären und sich an veränderte Bedingungen anzupassen. Anschließend wird der Mythos von Europa in der Antike detailliert analysiert, inklusive des Inhalts der Erzählung, wobei die unterschiedlichen Interpretationen und Darstellungen der Europa (von der naiven Jungfrau bis zur verführerischen Frau) und die unterschiedlichen Akzente der literarischen Adaptionen (z.B. bei Ovid oder Lukian) betrachtet werden. Der Fokus liegt auf der Vieldeutigkeit des Mythos und seiner Anpassungsfähigkeit über die Jahrhunderte hinweg.
Schlüsselwörter
Europa, Mythos, Herodot, Ovid, Identität, Antike, Gegenwart, Rezeption, Etymologie, Mädchenraub, Mythosdeutung, kulturelle Identität, Bedeutungswandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: "Der Mythos Europa"
Was ist der Inhalt des Textes "Der Mythos Europa"?
Der Text untersucht die Etymologie des Wortes "Europa" und die Rezeption des Mythos von Europa, insbesondere bei Herodot und Ovid. Er analysiert die Bedeutung des Mythos für die heutige Gesellschaft und hinterfragt seine Funktion als möglicher Identitätsstifter für Europa. Die Arbeit beleuchtet die Vielschichtigkeit des Mythos und seine Anpassungsfähigkeit über die Jahrhunderte hinweg.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: die Etymologie und den Bedeutungswandel des Wortes "Europa", die Rolle von Mythen in der Gesellschaft, den Mythos von Europa in der Antike (Inhalt und Interpretationen), die Darstellung des Mythos bei Herodot und Ovid, und die Relevanz des Mythos für die heutige europäische Identität. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vieldeutigkeit des Mythos und seiner Anpassungsfähigkeit.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in die Kapitel "A. Die Etymologie des Wortes „Europa“" und "B. Der Mythos Europa", mit Unterkapiteln zu den jeweiligen Aspekten. Ein abschließendes Fazit (C. Fazit) rundet die Arbeit ab. Kapitel A beleuchtet die ursprüngliche Bedeutung und die Entwicklung des Begriffes "Europa". Kapitel B analysiert den Mythos von Europa in der Antike und in der Gegenwart, untersucht verschiedene Interpretationen und betrachtet seine Adaptionen in der Literatur.
Wie wird der Mythos von Europa im Text dargestellt?
Der Mythos von Europa wird im Text als vielschichtiges und interpretationsoffenes Erzählmotiv dargestellt. Es werden verschiedene Interpretationen der Figur Europa (von der naiven Jungfrau bis zur verführerischen Frau) und die unterschiedlichen Akzente der literarischen Adaptionen (z.B. bei Ovid oder Lukian) betrachtet. Der Fokus liegt auf der Vieldeutigkeit und Anpassungsfähigkeit des Mythos über die Jahrhunderte hinweg.
Welche Rolle spielt die Etymologie des Wortes "Europa" im Text?
Die Etymologie des Wortes "Europa" bildet einen wichtigen Ausgangspunkt des Textes. Die Arbeit untersucht die umstrittene Herkunft des Wortes und beleuchtet die vielschichtigen Bedeutungen und die historisch-kulturelle Entwicklung des Begriffs. Die Schwierigkeiten bei der Deutung des Wortursprungs werden hervorgehoben und in den Kontext der Gesamtbetrachtung des Mythos gestellt.
Welche Autoren werden im Text erwähnt?
Der Text erwähnt Herodot und Ovid als wichtige Autoren, die den Mythos von Europa in ihren Werken verarbeitet haben. Ihre unterschiedlichen Darstellungen und Interpretationen des Mythos werden analysiert und verglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text am besten?
Schlüsselwörter, die den Text prägnant beschreiben, sind: Europa, Mythos, Herodot, Ovid, Identität, Antike, Gegenwart, Rezeption, Etymologie, Mädchenraub, Mythosdeutung, kulturelle Identität, Bedeutungswandel.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text untersucht die Etymologie des Wortes "Europa" und die Rezeption des Mythos von Europa bei Herodot und Ovid. Ziel ist es, die Bedeutung dieses Mythos für die heutige Gesellschaft zu hinterfragen und zu analysieren, ob er als Identitätsstifter für Europa fungieren kann und ob die Geschichte eines Mädchenraubs als solcher Mythos tauglich ist.
- Quote paper
- Annika Mödl (Author), 2012, Der Mythos "Europa" bei Ovid und Herodot. Ein Mädchenraub als Bezugspunkt kultureller Identität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276750