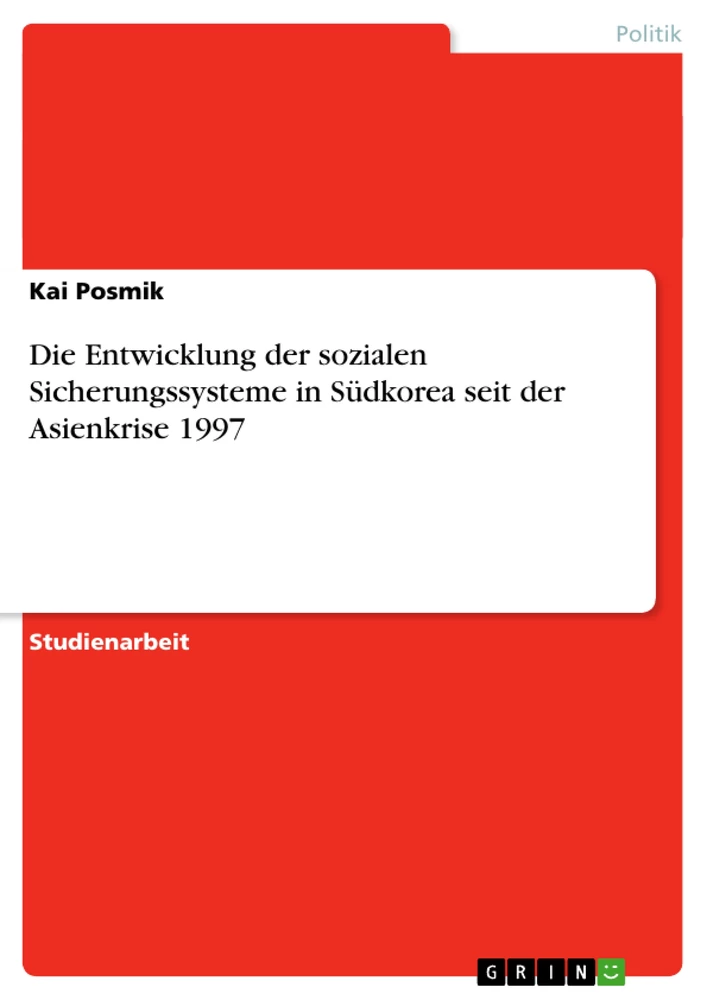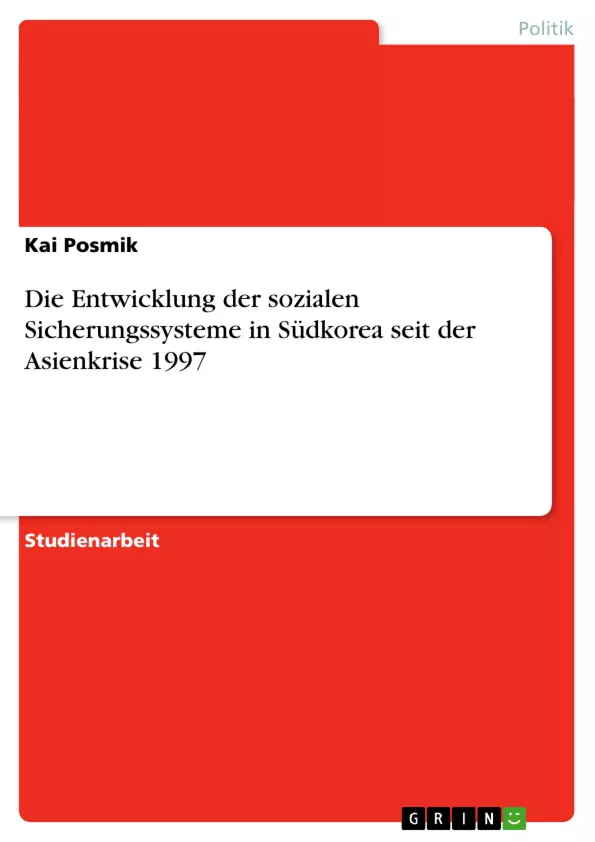Südkorea kann auf eine ökonomische Entwicklung zurückblicken, die ohne Zweifel zu den
bemerkenswertesten in der Welt zählt. Die seit dem Machtantritt des autoritären, das Land mit
„eiserner Faust“1 regierenden Präsidenten Park Chung-hee (1961) auf bedingungsloses ökonomisches
Wachstum ausgerichtete Politik, hat das Land innerhalb nur weniger Dekaden, von
einem überwiegend agrarisch geprägten Staat in eine hochindustrialisierte Gesellschaft verwandelt.
Diese rasante Industrialisierung war nicht zuletzt deshalb möglich, weil Südkorea bis
1987 diktatorisch regiert wurde. Die arbeitenden Menschen wurden als „industrielle Soldaten“
2 missbraucht, Menschenrechte mit Füßen getreten. „Alle gesellschaftlichen Bereiche wie
Erziehung, Presse, Familie, Fabriken, Parlament fungierten organisch in der gleichen Richtung
der weltmarktorientierten Industrialisierung.“3
Dass dieser Industrialisierungsschub nicht ohne Auswirkungen auf die koreanische Gesellschaft
bleiben würde, musste jedem klar sein: Auflösungserscheinungen der traditionellen
asiatischen Familienstrukturen, Urbanisierung, Umweltverschmutzung4 sind nur Teilaspekte,
die durch die ökonomische Prosperität lange verdeckt wurden. Und dass diese Konjunktur
nicht ewig andauern würde, dass insbesondere mit zunehmender Globalisierung der Wirtschaft
vor allem strukturelle Probleme Südkorea (und andere „Tigerstaaten“) vor ernste
Schwierigkeiten stellen würden, davor wurde schon vor der sogenannten Asienkrise gewarnt.5
Und als die Wirtschaftskrise 1997 über das Land hereinbrach und das Bruttosozialprodukt im
Folgejahr um mehr als fünf Prozent sank,6 als die Arbeitslosigkeit in bis dahin nicht gekanntem
Ausmaß anstieg, wurde offenbar, dass vor allem das nur unzureichend entwickelte System
der sozialen Sicherung Probleme bereitete. Daher war es notwendig, dieses nur rudimentäre,
weil in punkto Ausmaß und Empfängerkreis begrenzte System zu verändern und zu erweitern.
Dies machte sich der in direkter Folge der Krise Ende des Jahres 1997 gewählte Präsident und
ehemaliger Dissident Kim Dae-jung, zu einer seiner politischen Maximen. [...]
1 Aspalter 2001, S. 28
2 Kang 2001, S. 1
3 Ebd.
4 In Südkorea ist ein ökologisches Bewusstsein ist bis heute nur unzureichend entwickelt. Vgl. Cha 1999 und zu
den ökologischen Problemen Chung/Kirkby 2002
5 Vgl. Bello/Rosenfeld 1992; Krugmann 1994
6 Vgl. Köllner 1999, S. 78
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Entwicklungslinien koreanischer Sozialpolitik
- I. Die Zeit bis 1987
- II. Sozialpolitik in der Phase demokratischer Transition
- C. Sozialpolitische Reformen seit der Asienkrise
- I. DJnomics und Produktive Wohlfahrt
- II. Die Reform der Sozialversicherung
- 1. Gesetzliche Rentenversicherung
- 2. Unfall- und Krankenversicherung
- 3. Arbeitslosenversicherung
- III. Die Einführung der National Basic Livelihood Security
- D. Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Veränderungen der sozialpolitischen Ausrichtung in Südkorea seit der Asienkrise 1997 und bewertet deren Erfolg.
- Die Entwicklung der koreanischen Sozialpolitik bis zur Asienkrise
- Die Einführung der "DJnomics" und der "Produktiven Wohlfahrt" als Reaktion auf die Krise
- Die Reform des Sozialversicherungssystems in Südkorea
- Die Einführung der "National Basic Livelihood Security" als Sozialhilfe
- Die Herausforderungen und Perspektiven der sozialen Sicherung in Südkorea
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung
Die Einleitung stellt Südkoreas rasante Industrialisierung und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft vor. Sie hebt die unzureichende soziale Sicherung als eine der Hauptursachen für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten während der Asienkrise hervor. Die Arbeit konzentriert sich auf die Veränderungen der sozialpolitischen Ausrichtung seit 1997 und deren Bewertung.
B. Entwicklungslinien koreanischer Sozialpolitik
I. Die Zeit bis 1987
Bis Ende der 1970er Jahre war eine wirkliche Sozialpolitik in Korea kaum vorhanden. Die staatliche Unterstützung konzentrierte sich auf die Ärmsten der Bevölkerung, während die traditionelle Familienstruktur als Auffangbecken für Bedürftige diente. Erst mit der Industrialisierung ab 1961 wurde die Bedeutung sozialer Sicherung stärker erkannt, was zur Einführung der Unfallversicherung im Jahr 1963 führte.
II. Sozialpolitik in der Phase demokratischer Transition
Die Phase der demokratischen Transition in Südkorea, die mit den Protesten im Juni 1987 begann, war geprägt von einem verstärkten Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte. Diese Entwicklung führte zu einem Ausbau des Sozialversicherungssystems und einer stärkeren Einbindung der Gewerkschaften in die politische Entscheidungsfindung.
C. Sozialpolitische Reformen seit der Asienkrise
I. DJnomics und Produktive Wohlfahrt
Die in Südkorea nach der Asienkrise von 1997 eingeführte DJnomics zielte darauf ab, wirtschaftliche Effizienz und soziale Gerechtigkeit zu vereinen. Der Ansatz der "Produktiven Wohlfahrt" umfasste den Ausbau des Sozialversicherungssystems und die Einführung eines Sozialhilfe-Systems, das auf ein Existenzminimum ausgerichtet war.
II. Die Reform der Sozialversicherung
Die Asienkrise führte zu einem Ausbau der Sozialversicherung in Südkorea. Diese Reform beinhaltete Verbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung, der Unfall- und Krankenversicherung sowie der Arbeitslosenversicherung.
III. Die Einführung der National Basic Livelihood Security
Als Reaktion auf die Asienkrise wurde die "National Basic Livelihood Security" als Sozialhilfe-System eingeführt. Dieses System zielte darauf ab, Personen mit niedrigem Einkommen und andere Bedürftige mit einem Existenzminimum zu versorgen.
Schlüsselwörter
Sozialpolitik, Asienkrise, Südkorea, DJnomics, Produktive Wohlfahrt, Sozialversicherung, Sozialhilfe, National Basic Livelihood Security, Industrialisierung, Demokratie, Familienstruktur, Wirtschaftswachstum
Häufig gestellte Fragen
Wie reagierte Südkorea sozialpolitisch auf die Asienkrise 1997?
Unter Präsident Kim Dae-jung wurden die „DJnomics“ und das Konzept der „Produktiven Wohlfahrt“ eingeführt, um wirtschaftliche Effizienz mit sozialer Sicherung zu verbinden.
Was ist die „National Basic Livelihood Security“?
Dies ist ein 1999 eingeführtes Sozialhilfe-System, das jedem Bürger ein staatlich garantiertes Existenzminimum zusichert, unabhängig von der Arbeitsfähigkeit.
Warum war das Sozialsystem vor 1997 unzureichend?
Südkorea setzte primär auf bedingungsloses Wirtschaftswachstum und verließ sich auf traditionelle Familienstrukturen als soziales Auffangbecken.
Welche Versicherungen wurden nach der Krise reformiert?
Es gab umfassende Reformen in der gesetzlichen Rentenversicherung, der Krankenversicherung sowie den Ausbau der Arbeitslosenversicherung.
Was versteht man unter „Produktiver Wohlfahrt“?
Es ist ein Ansatz, der soziale Sicherheit nicht nur als Almosen sieht, sondern als Investition in das Humankapital, um die wirtschaftliche Teilhabe zu fördern.
- Citar trabajo
- Kai Posmik (Autor), 2004, Die Entwicklung der sozialen Sicherungssysteme in Südkorea seit der Asienkrise 1997, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27718