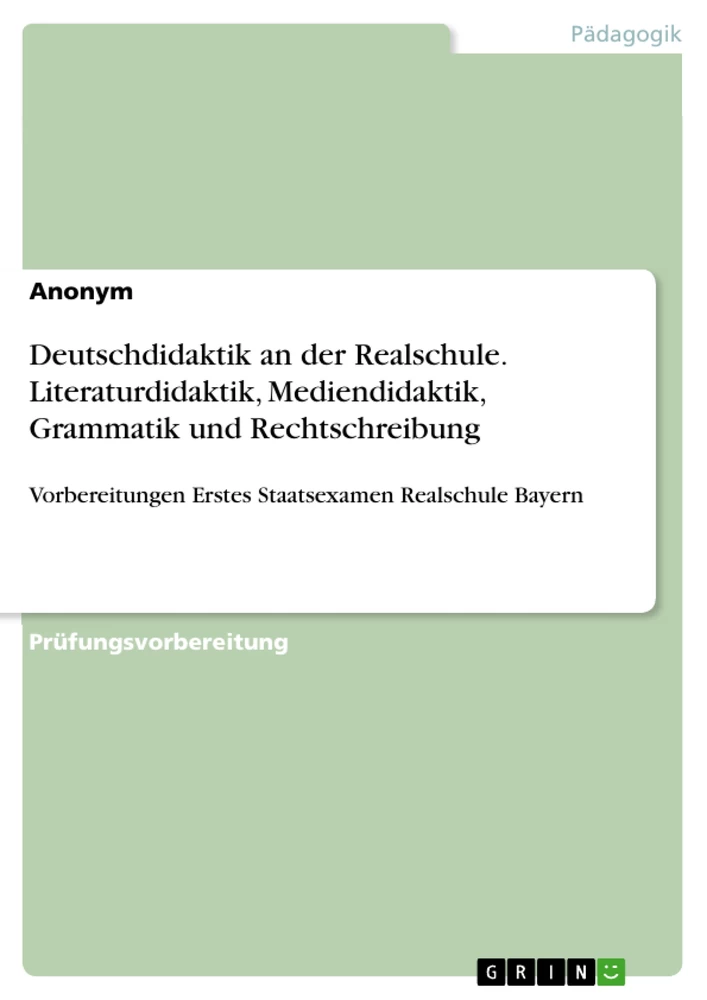Viele, gut strukturierte und relevante Inhalte für das Erste Staatsexamen (Deutschdidaktik): Literaturdidaktik, Mediendidaktik (Medienpädagogik), Grammatik und Rechtschreibung (Sprache untersuchen/Sprachreflexion, u.a. Schriftspracherwerb, ausgewählte Arbeits- udn Übungsformen). Weiterhin: Examensaufgaben 2006-2011, Deutsch als Unterrichtsfach an der Realschule (Lehrplanebenen, Jahrgangsstufen 5-10), Examenstipps (Vorbereitung, Schriftliche Abschlussprüfung) uvm.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitendes
- Examensaufgaben
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- Deutsch als Unterrichtsfach der Realschule
- Schulprofil Realschule (Lehrplanebene 1)
- Ziel und Anspruch der sechsstufigen Realschule
- Bildungs- und Erziehungsschwerpunkte an der sechsstufigen Realschule
- Unterricht und Schulleben und Stundentafel Deutsch
- Fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsaufgaben (Lehrplanebene 2)
- Pädagogische Leitthemen (Lehrplanebene 3)
- Fächerprofil Deutsch (Lehrplanebene 3)
- Lehrplan (Lehrplanebene 3)
- Jahrgangsstufe 5 - Sich in einem neuen Umfeld orientieren
- Jahrgangsstufe 6 – Schulgemeinschaft mitgestalten
- Jahrgangsstufe 7 - Eigene Individualität entdecken
- Jahrgangsstufe 8 – Beziehungen aufbauen und gestalten
- Jahrgangsstufe 9 - Lebensperspektiven entwickeln
- Jahrgangsstufe 10 - An der Gestaltung von Gegenwart und Zukunft mitwirken
- Schulprofil Realschule (Lehrplanebene 1)
- Literaturdidaktik
- Einleitung
- Ziele für den Literaturunterricht nach SPINNER - Hauptziel der Lesekompetenz
- Probleme des Lesens
- Grundlagen
- Literarische Lektüre in hermeneutischer Sicht
- Empirische Leseforschung: Entwicklung von den 1970er Jahren bis heute
- Lesestrategien
- Faktoren der individuellen Entwicklung: Lesegenese
- Geschlechterspezifisches Leseverhalten
- Lesesozialisation: Familien- und peerabhängige Entwicklung des Lesens
- Förderung der Leseflüssigkeit
- Leseförderung, Leseanimation, Lesetraining
- Lesesituationen im Unterricht – „Literarische Geselligkeit“
- Lesesituationen im Unterricht – „Genre- und themenspezifische Orientierung“
- Eröffnung neuer Lesewelten
- Lesen in der (neuen) Medienlandschaft
- Kinder- und Jugendliteratur
- Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft
- Didaktik der Kinder- und Jugendliteratur
- Prosa
- Gebrauchstexte
- Exkurs I: Kanonprobleme
- Allgemeine Methoden für die Literaturdidaktik
- Textnahes Lesen und Rezeptionsdidaktik
- Handlungs- und produktionsorientierte Verfahren
- Ausblick: Lernen durch Literatur
- Exkurs II: Kognitionspsychologisch orientierte Leseforschung
- Mediendidaktik
- Einleitung
- Mediendefinitionen und -klassifizierungen
- Medienepochen und -zäsuren
- „Mediengesellschaft!“
- Medienpädagogik
- Medienkompetenz
- Mediendidaktik: Integrierte Literatur- und Mediendidaktik
- Akustisch-auditive Medien: Hörbücher und auditive Download-Formate
- Grundlegendes & Historisches
- Hörbücher im gesellschaftlichen Kontext – Aktualität von Hörbüchern
- Hörbücher im Deutschunterricht
- Audio-visuelle Medien
- Film, Kurzfilm, Video
- Einleitendes
- Filmanalyse und -rezeption
- Filmproduktion
- Literaturverfilmung/Literaturadaption
- Fernsehserien
- Videoclips
- Film, Kurzfilm, Video
- Neue Medien
- Computer
- Internet
- Hypertext - Webfiction - Das nicht-lineare Lesen
- Computerspiele
- E-Learning
- Blog
- Handy
- Resümee
- Sprache untersuchen/Sprachreflexion - Grammatik
- Einleitung
- Ziele und Begründungen
- Konzepte
- ,,Sprachreflexion" statt „Grammatikunterricht“
- Didaktische Diskussion
- Können und Wissen im Spracherwerb
- Language Awareness - Sprachbewusstheit
- Sprachliches Wissen, sprachliches Können: Perspektiven und Vernetzung
- Grammatische Probleme im Fokus - Zur Terminologie
- Grammatische Probleme im Fokus - Wortarten
- Grammatische Probleme im Fokus - Der Satz
- Grammatische Probleme im Fokus - Der Text
- Sprache untersuchen/Sprachreflexion – Rechtschreibung
- Schriftlichkeit und Rechtschreibung
- Theorie der Orthographie
- Didaktik der Rechtschreibung
- Exkurs I: Phonologisches Bewusstsein/Phonologische Bewusstheit in Bezug auf Rechtschreibung (Ergänzung zu 6.5.2)
- Exkurs II: Schriftspracherwerb
- Der Begriff,,Schriftspracherwerb" in der didaktischen Diskussion
- Was bedeutet Lesen- und Schreibenlernen?
- Lesenlernen
- Schreibenlernen
- Lernvoraussetzungen für den Schriftspracherwerb
- Die Entwicklung von Lese-und Schreibfähigkeiten
- Didaktische Konzepte für den Schriftspracherwerb
- Exkurs III: Ausgewählte Arbeits- und Übungsformen
- Interessenbezogene Methodik des Rechtschreiblernens nach RICHTER
- ,,Mit dem Grundwortschatz arbeiten“ nach ABRAHAM, BEISBART, KOẞ & MARENBACH
- Wörterbücher benutzen nach Abraham, BeisbART, Koß & MARENBACH in fünf Phasen.
- Diktate
- Examenstipps
- Vorbereitung
- Schriftliche Abschlussprüfung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Zusammenfassung dient als Vorbereitung auf das Examen in Deutschdidaktik für die Realschule. Sie beleuchtet die wichtigsten Themenbereiche des Faches, darunter die Didaktik der Literatur, die Mediendidaktik, die Grammatik und die Rechtschreibung. Die Zusammenfassung basiert auf verschiedenen Quellen, darunter Lehrbücher, Fachartikel und Online-Ressourcen.
- Didaktik der Literatur: Die Zusammenfassung behandelt die Förderung der Lesekompetenz, die Auseinandersetzung mit verschiedenen Textformen (z.B. Novellen, Sachbücher) und die Entwicklung von Lesestrategien.
- Mediendidaktik: Die Zusammenfassung beleuchtet den Einsatz von Medien im Deutschunterricht, insbesondere die Bedeutung des Internets, von Hörbüchern und Filmen.
- Grammatik: Die Zusammenfassung fokussiert auf die Bedeutung der Sprachreflexion und die didaktische Diskussion um den Grammatikunterricht.
- Rechtschreibung: Die Zusammenfassung behandelt die Theorie der Orthographie, die Didaktik der Rechtschreibung und den Schriftspracherwerb.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Zusammenfassung beginnt mit einer Einleitung, die die wichtigsten Quellen und den Aufbau der Zusammenfassung erläutert. Anschließend werden die Examensaufgaben der letzten Jahre vorgestellt und analysiert. Die Zusammenfassung behandelt dann die verschiedenen Bereiche des Deutschunterrichts an der Realschule, darunter das Schulprofil, die Fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungsaufgaben, das Fächerprofil Deutsch und den Lehrplan.
Im Bereich der Literaturdidaktik werden die Ziele des Literaturunterrichts, die Probleme des Lesens, die Förderung der Leseflüssigkeit und die Leseförderung im Unterricht behandelt. Außerdem werden die Kinder- und Jugendliteratur, die Methoden der Literaturdidaktik und die kognitionspsychologische Leseforschung beleuchtet.
Die Mediendidaktik behandelt die Bedeutung von Medien im Deutschunterricht, die Mediendefinitionen und -klassifizierungen, die Medienepochen und -zäsuren, die „Mediengesellschaft“ und die Mediendidaktik als integrierte Literatur- und Mediendidaktik. Außerdem werden die akustisch-auditiven Medien, die audio-visuellen Medien und die neuen Medien behandelt.
Der Bereich Sprache untersuchen/Sprachreflexion - Grammatik behandelt die Einleitung, die Ziele und Begründungen, die Konzepte, die didaktische Diskussion und die grammatischen Probleme im Fokus.
Der Bereich Sprache untersuchen/Sprachreflexion – Rechtschreibung behandelt die Schriftlichkeit und Rechtschreibung, die Theorie der Orthographie, die Didaktik der Rechtschreibung, den Schriftspracherwerb und die ausgewählten Arbeits- und Übungsformen.
Die Zusammenfassung endet mit Examenstipps, die die Vorbereitung auf die schriftliche Abschlussprüfung erleichtern sollen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Deutschdidaktik, Realschule, Literaturdidaktik, Mediendidaktik, Grammatik, Rechtschreibung, Lesekompetenz, Schriftspracherwerb, Medienkompetenz, Sprachreflexion, Unterrichtsmethoden, Examensvorbereitung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Schwerpunkte der Deutschdidaktik an der Realschule?
Die Schwerpunkte liegen in der Literaturdidaktik, Mediendidaktik, Grammatik und Rechtschreibung sowie der Förderung der Lesekompetenz.
Was versteht man unter Literaturdidaktik im Deutschunterricht?
Sie umfasst Ziele wie die Förderung der Lesefähigkeit, den Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur sowie handlungs- und produktionsorientierte Verfahren im Unterricht.
Welche Rolle spielt die Mediendidaktik heute?
Sie integriert klassische Medien wie Filme und Hörbücher mit neuen Medien wie dem Internet, Blogs und Hypertexten, um die Medienkompetenz der Schüler zu stärken.
Was ist der Unterschied zwischen Grammatikunterricht und Sprachreflexion?
Sprachreflexion geht über das reine Auswendiglernen von Regeln hinaus und fördert die bewusste Auseinandersetzung mit der Funktion und Wirkung von Sprache.
Wie wird der Schriftspracherwerb in der Realschule thematisiert?
Es werden Konzepte zum Lesen- und Schreibenlernen sowie Übungsformen zur Rechtschreibung (z. B. Arbeit mit dem Grundwortschatz oder Wörterbüchern) behandelt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, Deutschdidaktik an der Realschule. Literaturdidaktik, Mediendidaktik, Grammatik und Rechtschreibung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277738