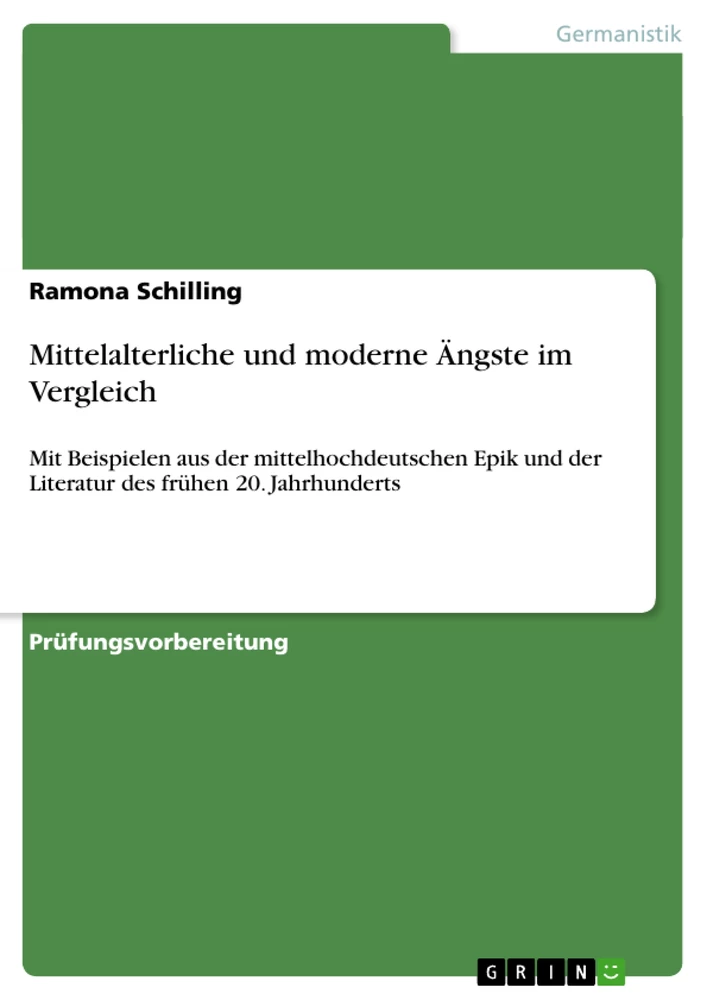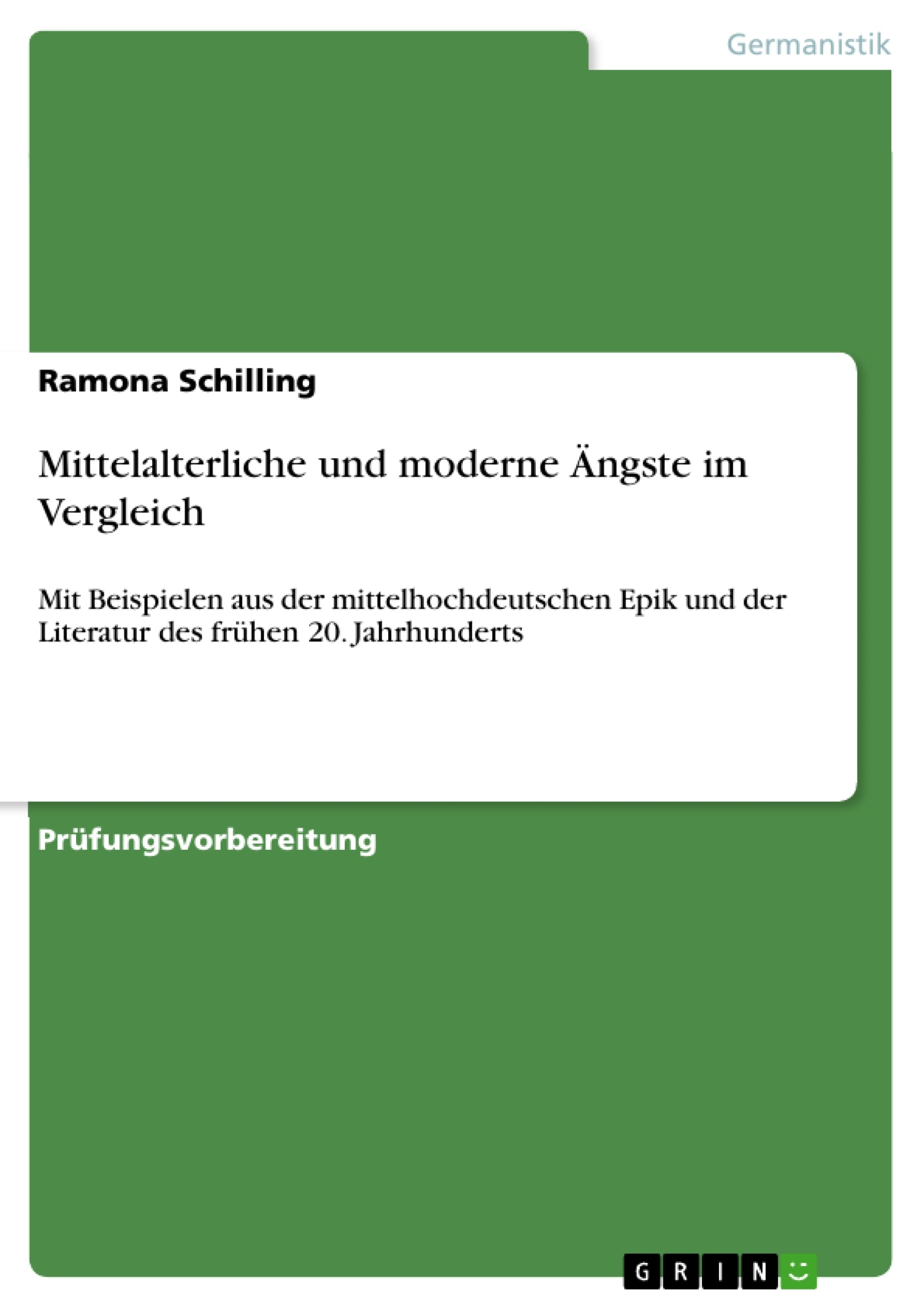Was sind Emotionen? Woher kommen Sie? Wie haben Sie sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt und Verändert?
Diesen Fragen wird mit Beispielen wie "Erec" oder Kafkas "Verwandlung" erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Thema 2: Modul II: Wissenskulturen und Wissensgeschichte
- mittelalterliche und moderne Ängste im Vergleich - mit Beispielen aus der mittelhochdeutschen Epik und der Literatur des frühen 20. Jahrhunderts
- Was sind Emotionen?
- Emotionalität und Rationalität
- Emotion und Rationalität im Mittelalter
- Definition der Angst
- Phänomenologie der Angst
- Biologische und anthropologische Grundlagen
- Funktionen der Angst
- Einzelne Formen des Angsterlebens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Modul II befasst sich mit der Wissensgeschichte und den Wissenskulturen des Mittelalters und der Moderne. Es untersucht die Entwicklung von Angstkonzepten und -erfahrungen in diesen Epochen, indem es Beispiele aus der mittelhochdeutschen Epik und der Literatur des frühen 20. Jahrhunderts heranzieht. Das Modul analysiert die kulturellen und historischen Bedingungen, die die Wahrnehmung und den Ausdruck von Angst prägen, und beleuchtet die Beziehung zwischen Emotion und Rationalität in verschiedenen Epochen.
- Kulturelle und historische Bedingungen von Angst
- Vergleich von mittelalterlichen und modernen Angstkonzepten
- Die Rolle von Literatur und Kunst bei der Gestaltung von Angst
- Die Beziehung zwischen Emotion und Rationalität
- Die Entwicklung von Angstkonzepten in der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel "Was sind Emotionen?" beleuchtet die Debatte um die Universalität von Emotionen und untersucht, ob Emotionen kulturell und historisch bedingte Konstrukte sind. Es werden verschiedene Theorien zur Entstehung und Ausdrucksweise von Emotionen vorgestellt, darunter die Theorie der Basisemotionen und die Rolle von Display Rules. Das Kapitel "Emotionalität und Rationalität" analysiert die historische Entwicklung des Verhältnisses von Emotion und Rationalität, von der Antike über das Mittelalter bis zur Moderne. Es werden verschiedene philosophische und wissenschaftliche Perspektiven auf die Beziehung zwischen Verstand und Gefühl vorgestellt und die Bedeutung der Emotionalität für das menschliche Handeln diskutiert. Das Kapitel "Emotion und Rationalität im Mittelalter" untersucht die Rolle von Emotionen in der mittelalterlichen Gesellschaft und beleuchtet die Entwicklung von Trieb- und Effektkontrolle in traditionellen Gesellschaften. Es werden die Unterschiede zwischen mittelalterlichen und modernen Gesellschaften in Bezug auf die Trennung von privatem und öffentlichem Raum und die Kontrolle von Körperfunktionen aufgezeigt. Das Kapitel "Definition der Angst" definiert den Begriff der Angst und untersucht die verschiedenen Bedeutungen und Ausdrucksformen von Angst. Es werden die charakteristischen Merkmale von Angst, wie Engegefühl und Mangelnde Handlungsfähigkeit, sowie die verschiedenen Intensitäten von Angst, von unterschwelliger Unruhe bis zur Todespanik, beschrieben. Das Kapitel "Phänomenologie der Angst" analysiert die verschiedenen Formen von Angst, von vitaler, leibnaher Angst über objektgerichtete Furcht bis zur diffusen Ängstlichkeit und Bangnis. Es wird die Grundstruktur der Angst, die Entstehung von Bangnis und Grauen sowie die Rolle der Phantasie bei der Entstehung von Angst untersucht. Das Kapitel "Biologische und anthropologische Grundlagen" beleuchtet die biologischen und anthropologischen Grundlagen von Angst und untersucht die Funktionen von Angst für die Selbsterhaltung und die soziale Interaktion. Es werden die verschiedenen Funktionen von Angst, wie die Regulation des Verhaltens in der Gesellschaft und die Fähigkeit der Imagination, vorgestellt. Das Kapitel "Funktionen der Angst" untersucht die verschiedenen Funktionen von Angst, wie die Regulation des Verhaltens in der Gesellschaft, die Fähigkeit der Imagination und die Rolle von Angst als Spielraum der Freiheit. Es werden die verschiedenen Formen von Angst, wie die vitale Angst/Todesangst, die Raumängste und die sozialen Ängste, beschrieben und ihre Ursachen und Auslöser analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Wissenskulturen und Wissensgeschichte des Mittelalters und der Moderne, Angstkonzepte und -erfahrungen, Emotionen, Rationalität, Display Rules, Trieb- und Effektkontrolle, Phänomenologie der Angst, Funktionen der Angst, vitale Angst, Raumängste, soziale Ängste, mittelhochdeutsche Epik, Literatur des frühen 20. Jahrhunderts.
- Citation du texte
- Bachelor Ramona Schilling (Auteur), 2013, Mittelalterliche und moderne Ängste im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278545