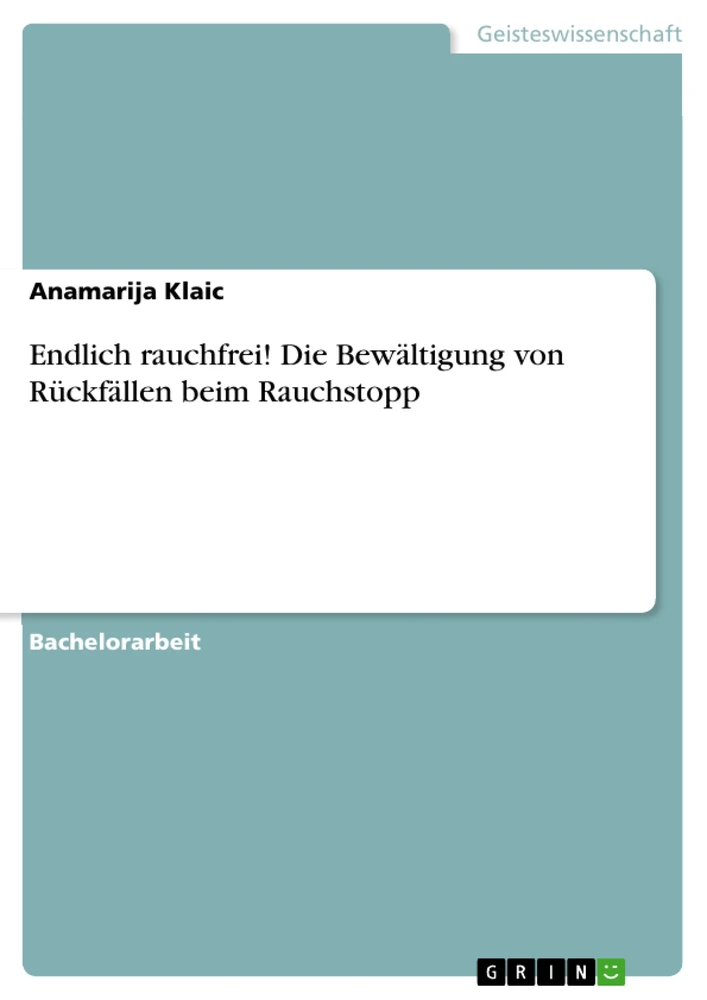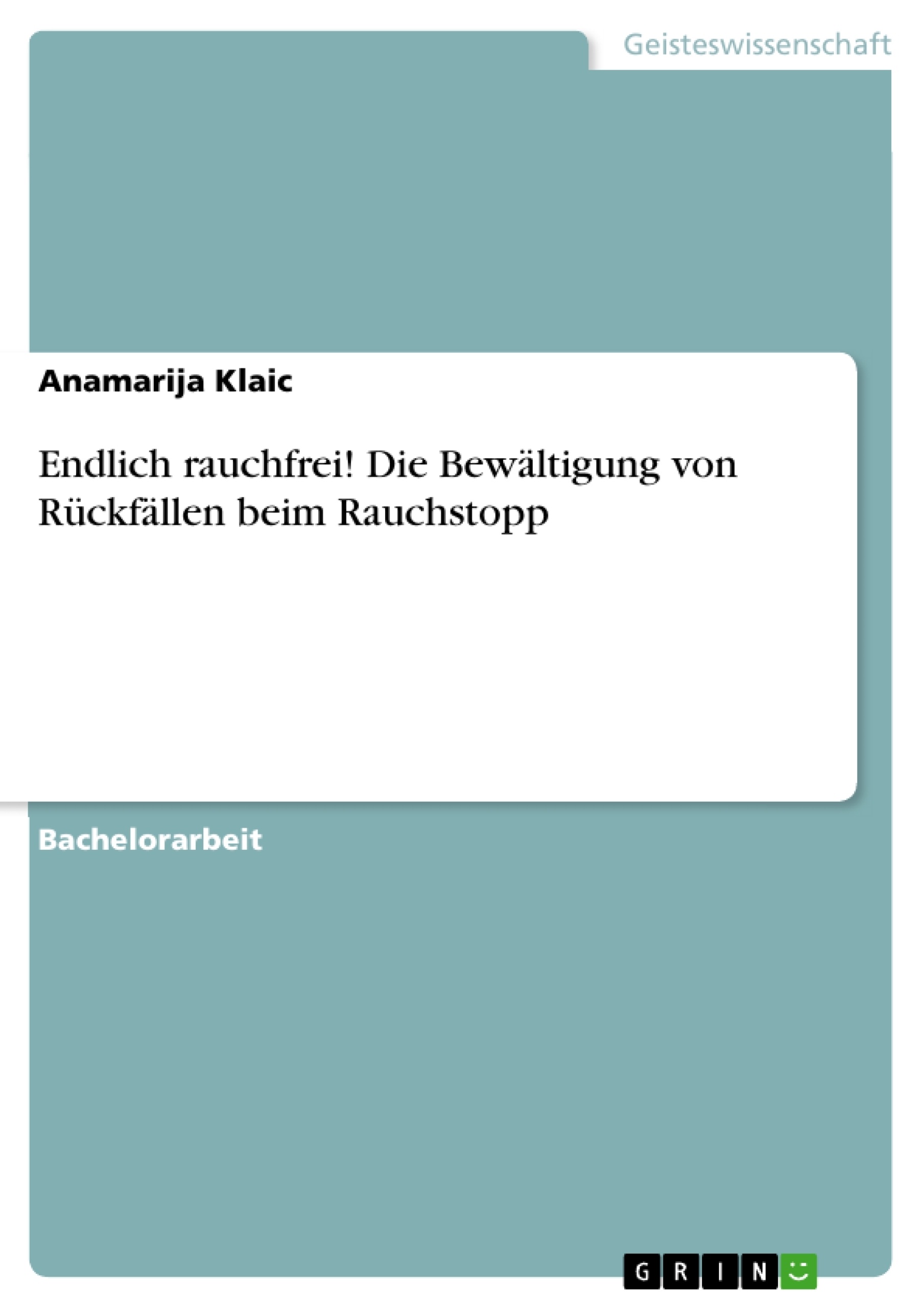Diese Literaturarbeit soll in Form eines Reviews Überblick über die Schwierigkeiten bei einem Rauchstoppvorhaben geben. Es sterben jährlich weltweit sechs Millionen Menschen durch den Konsum von Tabak, da dies ein Risikofaktor für viele gesundheitliche Schädigungen wie Krebserkrankungen ist. Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, wie betroffene Raucher/Innen mit Rückfällen beim Rauchstopp umgehen, wie ein Rauchstopp bewältigt werden kann und welche Variablen bestimmen, wie trotz „Ausrutschern“ der längerfristige Rauchstopp geschafft werden kann. Solche Variablen werden in vier Kategorien unterteilt: demographische, biologische, interpersonelle und intrapersonelle Faktoren. Vor allem wird ein Augenmerk auf die intrapersonellen Faktoren wie die Selbstwirksamkeitserwartung, die Wiederherstellungsselbstwirksamkeitserwartung, negativer Affekt und Weiteres gelegt. Die heute populärsten Modelle zum Rauchstoppverhalten werden vorgestellt: das Relapse Prevention Modell, das Transtheoretische Modell und das I-Change Modell. Dann werden einige proximale und distale Interventionen bei einem Rauchstopp vorgestellt. Zum Schluss werden in der Diskussion einige theoretische Unzulänglichkeiten und methodische Einschränkungen bezüglich der Studien kritisch reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Hauptteil
- Modelle zur Veränderung von Risiko- und Gesundheitsverhalten
- Das Relapse Prevention Modell (Marlatt & Gordon, 1985)
- Das Transtheoretische Modell (Prochaska & Velicer, 1997)
- Das I-Change Modell (De Vries et al., 2003)
- Einflussvariablen bei einem Rauchstopp
- Demographische Faktoren
- Biologische Faktoren
- Interpersonelle Faktoren
- Intrapersonelle Faktoren
- Intervention und Prävention beim Rauchstopp
- Proximale Interventionen
- Distale Interventionen
- Modelle zur Veränderung von Risiko- und Gesundheitsverhalten
- Methoden
- Diskussion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Literaturarbeit setzt sich zum Ziel, einen umfassenden Überblick über die Herausforderungen im Zusammenhang mit Rauchentwöhnungsversuchen zu liefern. Dabei soll insbesondere auf die Bewältigung von Rückfällen beim Rauchstopp fokussiert werden. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Modelle und Theorien, die das Rauchstoppverhalten erklären und zeigt auf, welche Variablen den Erfolg oder Misserfolg eines Rauchstopps beeinflussen können.
- Modelle zur Veränderung von Risiko- und Gesundheitsverhalten
- Einflussfaktoren auf den Rauchstopp
- Strategien zur Intervention und Prävention
- Bewältigung von Rückfällen
- Methodische und theoretische Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problematik des Tabakkonsums und seiner Folgen ein. Sie verdeutlicht die globale Bedeutung des Themas und stellt die Relevanz von Rauchentwöhnungsstrategien heraus.
Im Hauptteil werden zunächst verschiedene Modelle zur Veränderung von Risiko- und Gesundheitsverhalten vorgestellt, darunter das Relapse Prevention Modell, das Transtheoretische Modell und das I-Change Modell. Anschliessend werden die Einflussvariablen auf den Rauchstopp näher beleuchtet, wobei der Fokus auf demographische, biologische, interpersonelle und intrapersonelle Faktoren gelegt wird.
Das Kapitel über Intervention und Prävention beim Rauchstopp befasst sich mit proximalen und distalen Interventionen, die in der Praxis zum Einsatz kommen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Literaturarbeit sind: Rauchentwöhnung, Rückfallprävention, Relapse Prevention Modell, Transtheoretisches Modell, I-Change Modell, Selbstwirksamkeitserwartung, Wiederherstellungsselbstwirksamkeitserwartung, negativer Affekt, Intervention, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist ein Rauchstopp oft mit Rückfällen verbunden?
Rauchen verursacht eine starke Abhängigkeit; Rückfälle werden durch demographische, biologische sowie intra- und interpersonelle Faktoren beeinflusst.
Was ist das Relapse Prevention Modell nach Marlatt & Gordon?
Es ist ein Modell, das Strategien zur Identifizierung von Hochrisikosituationen und zur Bewältigung von Rückfällen bietet, um langfristige Abstinenz zu sichern.
Welche Rolle spielt die Selbstwirksamkeitserwartung beim Aufhören?
Sie beschreibt das Vertrauen einer Person in die eigene Fähigkeit, den Rauchstopp auch in schwierigen Situationen erfolgreich durchzuhalten.
Was ist der Unterschied zwischen proximalen und distalen Interventionen?
Proximale Interventionen setzen direkt am Verhalten an, während distale Interventionen eher Rahmenbedingungen oder längerfristige Präventionsstrategien betreffen.
Was erklärt das Transtheoretische Modell (TTM)?
Das TTM beschreibt die Veränderung von Gesundheitsverhalten als einen Prozess, der verschiedene Stadien von der Absichtslosigkeit bis zur Aufrechterhaltung durchläuft.
Wie beeinflusst negativer Affekt den Rauchstopp?
Negative Emotionen wie Stress oder Trauer sind häufige Auslöser für „Ausrutscher“, da Tabakkonsum oft fälschlicherweise zur Emotionsregulation genutzt wird.
- Arbeit zitieren
- Anamarija Klaic (Autor:in), 2012, Endlich rauchfrei! Die Bewältigung von Rückfällen beim Rauchstopp, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278615