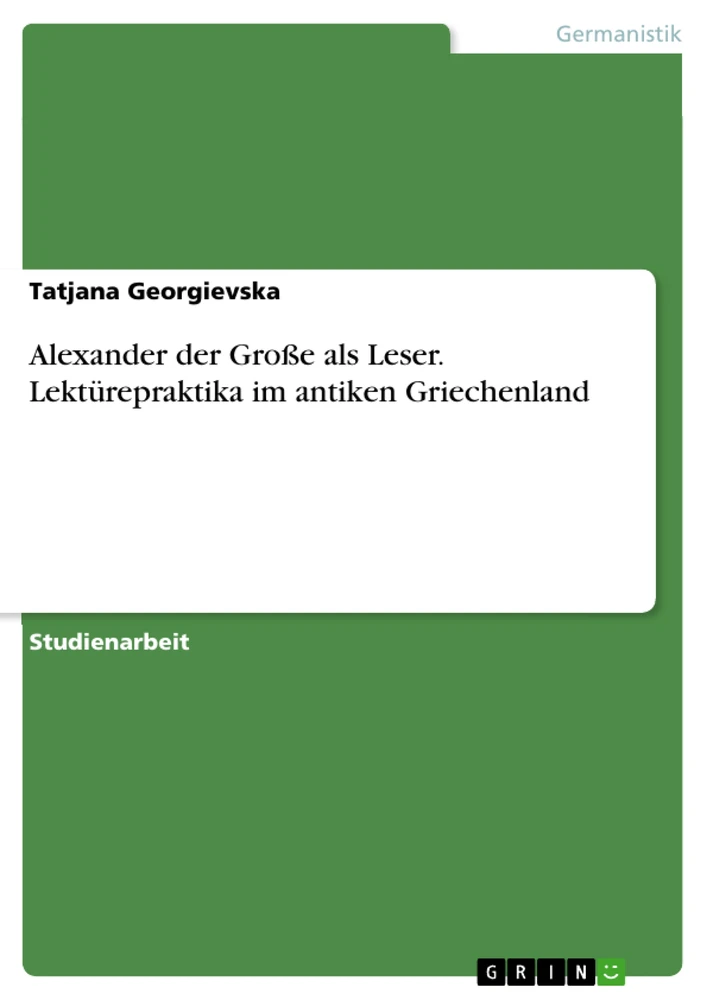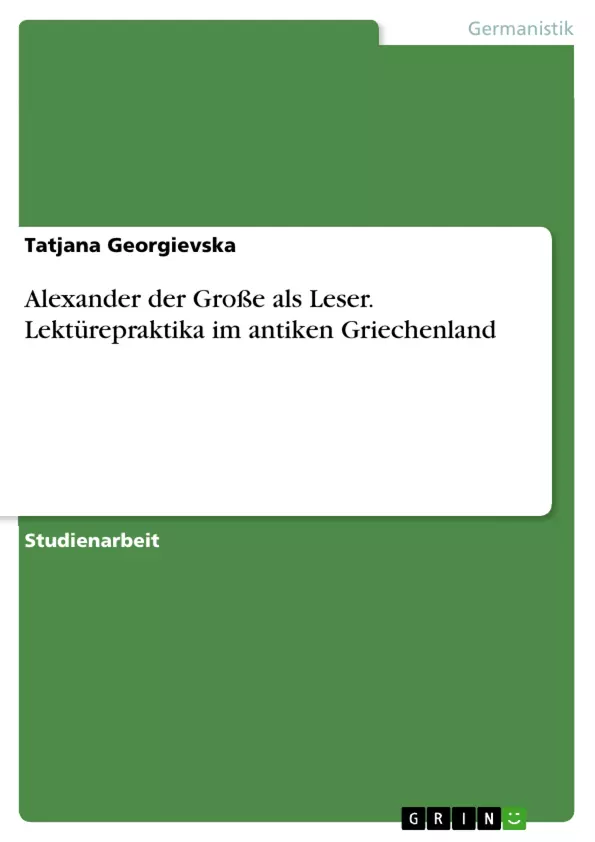Die Forschung, wie die Lektürepraxis in der Antike aussah, ist von großer Bedeutung, aber auch komplex, da es nicht so viele originale Quellen gibt, die Hinweise auf die Leseweise der Werke und deren Rezeption geben können. Deswegen wird derjenige, der seinen Blick auf diesen Forschungsaspekt richtet, auf erhaltene Quellen, die jedoch nur in begrenzter Zahl vorhanden sind, und auf die Literatur, die sich mit der antiken Kultur und Bildung sowie dem Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler beschäftigt, zurückgreifen. Das Bild setzt sich letztlich aus der Vielfalt einzelner Elemente zum Mosaik zusammen. Deswegen gibt es keine einheitliche Methodologie der Forschung. Einerseits geht man den Werken auf den Grund, andererseits rekonstruiert man durch Informationen, die man von der historischen Wissenschaft dieser Zeit, der Philosophie und anderen Disziplinen bekommt, das Bild der Lesewelt und -lektüre, die für die Gestaltung der Persönlichkeit und deren Charakterzüge entscheidend war.
Als Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung wählte ich einen der größten Feldherrn und Eroberer, nämlich Alexander den Großen, um ihn als Leser und Deuter von Homers „Ilias“ vorzustellen. Mein Ausgangspunkt dabei war Plutarchs Biografie Alexanders des Großen, in der erwähnt wird, dass Alexander dieses Werk so außerordentlich schätzte, dass er es mit auf seinen Feldzug nach Osten nahm und es wie einen Schatz hütete und sogar unter sein Kopfkissen legte. [...] In der zeitgenössischen historischen Sekundärliteratur schließlich fand ich die Hauptanhaltspunkte darüber, wie Alexander Homers Werk auffasste, und dadurch begann ich zu verstehen, auf welche Weise Alexander dieses Werk las.
Bei meiner Untersuchung schlug ich mehrere Richtungen ein. Zuerst versuchte ich zu verstehen, auf welche Weise Alexander während seiner Ausbildung sich dem Werk Homers näherte. Deshalb widmete ich der Ausbildung in der Antike, die in Alexanders Jugend vorherrschend war, besondere Aufmerksamkeit. [...]
Zweitens war für mich Aristoteles’ Verständnis der Kunst und der Funktion der Literaturwerke wichtig. Ich versuchte in der vorliegenden Arbeit die Lesesituation darzustellen, d.h., wie Aristoteles bestimmte Auszüge aus der „Ilias“ las und wie Alexander sie deutete. Es ist bekannt, dass Aristoteles stilles Lesen praktizierte und es ist möglich, dass er Alexander in diese Technik einführte.
Inhaltsverzeichnis
- Bildung im antiken Griechenland und in Makedonien
- Die Bedeutung von Homers „Ilias“ in der Antike
- Alexanders Herkunft als ausschlaggebend für den zukünftigen Einfluss der „Ilias“
- Alexanders Ausbildung und Erziehung
- Aristoteles' Erziehung
- Aristoteles und Platon
- Alexander und Achilles
- Andere Lektüren Alexanders
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Lektürepraxis im antiken Griechenland am Beispiel von Alexander dem Großen, insbesondere mit seiner Auseinandersetzung mit Homers „Ilias“. Die Analyse zielt darauf ab, die Bedeutung von Homers Werk für die antike Bildung und seine Rezeption durch Alexander zu beleuchten.
- Die Bedeutung von Homers „Ilias“ in der antiken Bildung
- Alexanders Beziehung zu Homer und seinen Helden
- Die Rolle von Aristoteles als Lehrer und die Bedeutung seiner Interpretation der „Ilias“
- Die Lektürepraxis im antiken Griechenland und Alexanders Lesetechniken
- Der Einfluss von anderen Lektüren auf Alexander
Zusammenfassung der Kapitel
- Bildung im antiken Griechenland und in Makedonien: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung der Schriftkultur im archaischen Griechenland und die Rolle von Bildung in der antiken Gesellschaft.
- Die Bedeutung von Homers „Ilias“ in der Antike: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Homers „Ilias“ als literarisches Werk und als Quelle für die antike Bildung. Es untersucht, wie dieses Werk für die Ausbildung zukünftiger Krieger genutzt wurde und welche Rolle es für Alexanders Erziehung spielte.
- Alexanders Herkunft als ausschlaggebend für den zukünftigen Einfluss der „Ilias“: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss von Alexanders Herkunft auf seine Beziehung zu Homers „Ilias“ und seine spätere Rezeption des Werkes.
- Alexanders Ausbildung und Erziehung: Dieses Kapitel untersucht die Ausbildung von Alexander, die Rolle von Aristoteles als seinem Lehrer und den Einfluss von Aristoteles' Interpretation der „Ilias“ auf Alexanders Weltbild.
- Aristoteles' Erziehung: Dieses Kapitel widmet sich der Erziehung von Aristoteles und dem Einfluss von Platon auf seine philosophischen Ansichten.
- Aristoteles und Platon: Dieses Kapitel beleuchtet die Beziehung zwischen Aristoteles und Platon und den Einfluss Platons auf Aristoteles' philosophische und pädagogische Ansichten.
- Alexander und Achilles: Dieses Kapitel analysiert die Parallelen zwischen Alexander und Achilles, die in antiken Quellen und im Alexanderroman beschrieben werden. Es untersucht, wie sich Alexander mit Achilles identifizierte und wie er die Rolle des Helden in Homers „Ilias“ interpretierte.
- Andere Lektüren Alexanders: Dieses Kapitel befasst sich mit anderen literarischen Werken, die Alexander gelesen hat, und deren Einfluss auf seine Denkweise und sein Handeln. Es werden insbesondere Xenophons und Herodots Geschichtsbücher betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Lektürepraxis, der antiken Bildung, Alexander dem Großen, Homer, „Ilias“, Aristoteles, Platon, Achilles, Lektüretechnik, stille Lesen, Geschichtsbücher, Xenophon, Herodot.
Häufig gestellte Fragen
Warum war Homers „Ilias“ für Alexander den Großen so wichtig?
Alexander sah in der „Ilias“ ein Idealbild des Helden und nutzte das Werk als Schatz und Vorbild für seine eigene Kriegsführung und Persönlichkeitsbildung.
Welchen Einfluss hatte Aristoteles auf Alexanders Lesegewohnheiten?
Aristoteles war Alexanders Lehrer und führte ihn möglicherweise in die Technik des stillen Lesens ein sowie in die Interpretation literarischer Heldenfiguren.
Identifizierte sich Alexander mit Achilles?
Ja, Alexander sah sich in der Nachfolge des Achilles und versuchte, dessen Heldenmut und Ruhm in seinen eigenen Eroberungszügen nachzueifern.
Wie sah die Lektürepraxis im antiken Griechenland aus?
Lektüre diente primär der Bildung und Charakterformung. Während lautes Vorlesen üblich war, verbreitete sich in gelehrten Kreisen zunehmend auch das stille Lesen.
Welche anderen Werke las Alexander der Große?
Neben Homer interessierte er sich für Geschichtsbücher, unter anderem von Herodot und Xenophon, um strategisches Wissen zu erlangen.
- Quote paper
- B.A. Tatjana Georgievska (Author), 2014, Alexander der Große als Leser. Lektürepraktika im antiken Griechenland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278957