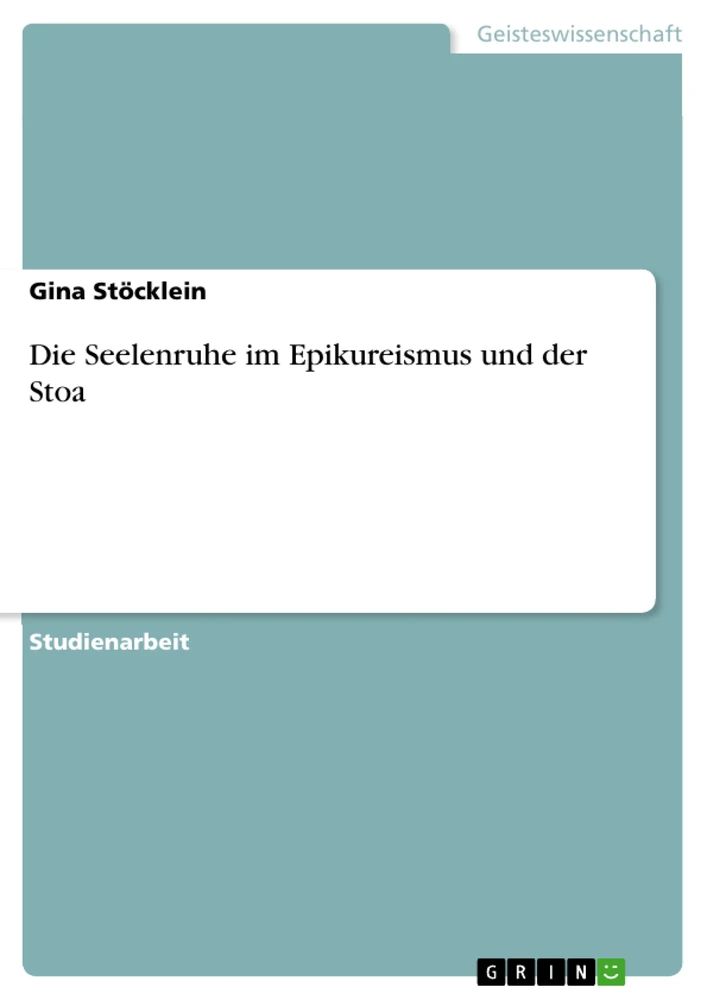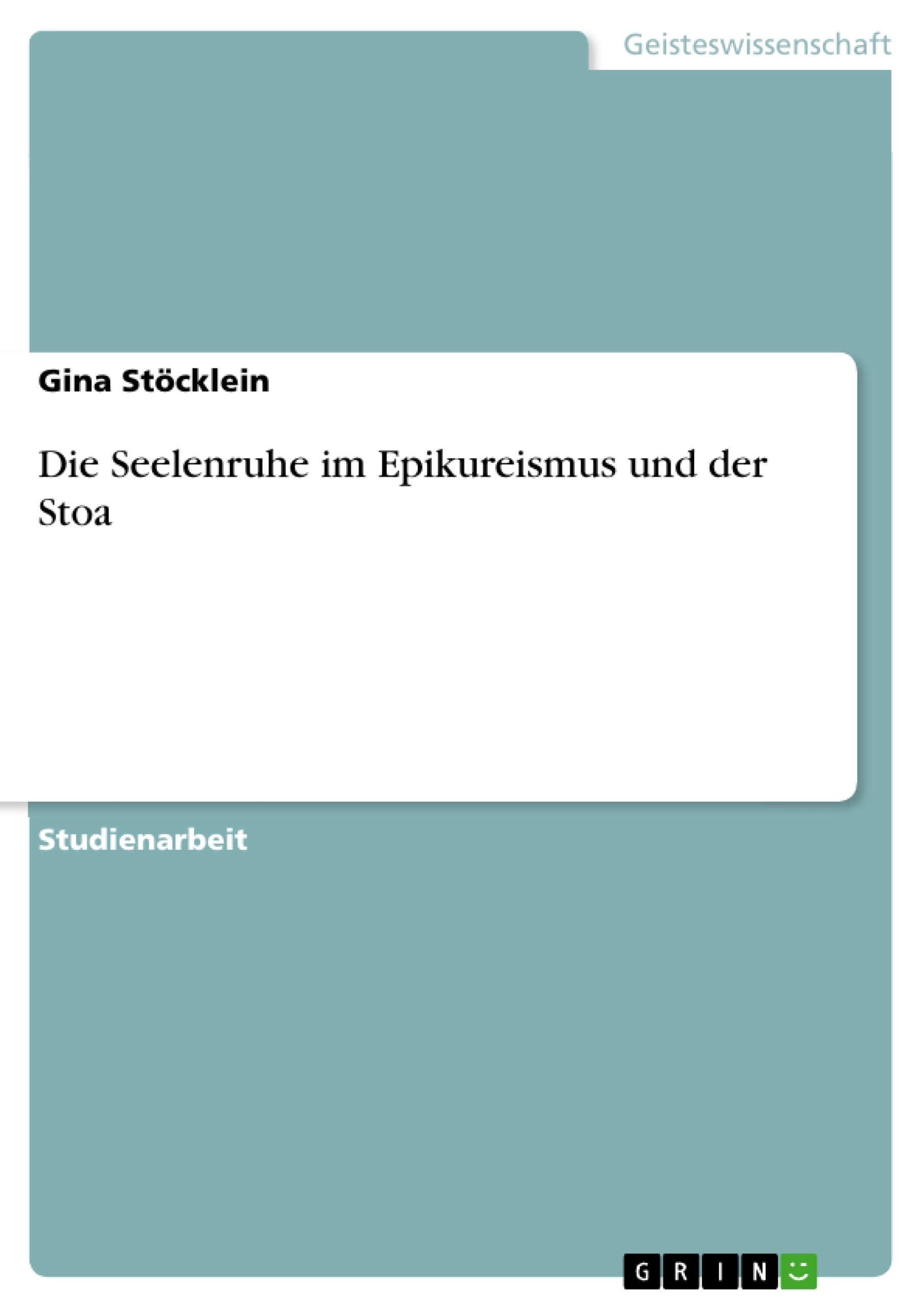Im Mittelpunkt meiner Hausarbeit sollen zwei philosophische Schulen des Hellenismus stehen: Die Stoa und der Epikureismus. Den Ausgangspunkt meiner Überlegungen bildete die Fragestellung, ob der Idealzustand der Seelenruhe in der Stoa und im Epikureismus gleichgesetzt werden kann? Also ob er dasselbe bezeichnet. Beim Erarbeiten der Literatur, bemerkte ich schnell, dass man die Seelenruhe nicht verstehen kann, wenn man den Hintergrund der Epoche und die Philosophie dieser beiden philosophischen Schulen nicht kennt. Aus Zeit und Platzgründen, musste leider auf eine ausführliche Beschreibung des Hellenismus verzichtet werden. Es werden daher lediglich im Textverlauf einige wesentliche Fakten bemerkt. Allgemein wird deshalb nur zu den beiden philosophischen Schulen etwas bemerkt. Danach folgt jeweils die Darlegung ihres Weltverständnisses oder ihrer Philosophie. Wobei die Logik hierbei ausgenommen ist, da sie nicht relevant für das Verständnis der Seelenruhe ist. In den Punkten „Die philosophischen Grundlagen der Stoa“ oder „Die philosophischen Grundlagen im Epikureismus“ geht es daher wesentlich um erkenntnistheoretische, ontologische oder kosmologische Gedanken. Daraus erhoffe ich mir Kenntnisse über ihr Weltbild und über ihre Ethik ableiten zu können. Um einen Vergleich zu gewährleisten, beschreibe ich jede philosophische Richtung in ihrem Gesamtkonzept zuerst einzeln, um dann später den Idealzustand der Seelenruhe vergleichen zu können. Des Weiteren werden die Emotionstheorien erläutert. Dies erscheint sinnvoll, weil es erstens erheblich zum Verständnis der Seelenruhe beiträgt und zweitens somit ein Bezug zum Seminarthema erfolgt. Nachdem das Verständnis der Seelenruhe jeweils erläutert ist, folgt im letzten Punkt ein Vergleich der beiden Seelenruhen. Im Fazit erscheint keine Zusammenfassung der Theorien, weil dies schon durch den Vergleich gewährleistet ist. Lediglich ein paar eigene Gedanken werden hier geäußert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Stoa - allgemeiner Hintergrund
- 1.1 Die philosophischen Grundlagen der Stoa
- 1.2 Emotionen und Affekte in der Stoa
- 1.3 Seelenruhe - die Begriffe ataraxia und apatheia in der Stoa und die Glückseligkeit
- 2. Epikureismus - allgemeiner Hintergrund
- 2.1 Die philosophischen Grundlagen im Epikureismus
- 2.2 Emotionen und Begierden im Epikureismus
- 2.3 Die Seelenruhe im Epikureismus- Lust als Glück
- 3. Ein Vergleich der Seelenruhe in der Stoa und im Epikureismus
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Idealzustand der Seelenruhe in der Stoa und im Epikureismus und vergleicht beide Konzepte miteinander. Die Arbeit analysiert, ob die Seelenruhe in beiden philosophischen Schulen gleichgesetzt werden kann. Dazu werden die philosophischen Grundlagen, die Konzepte von Emotionen und Affekten/Begierden sowie die jeweiligen Vorstellungen von Glückseligkeit beleuchtet.
- Vergleich der Konzepte von Seelenruhe in der Stoa und im Epikureismus
- Analyse der philosophischen Grundlagen der Stoa und des Epikureismus
- Untersuchung der stoischen und epikureischen Emotionstheorien
- Bedeutung des Logos in der stoischen Philosophie
- Das Konzept der Glückseligkeit in beiden Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Gleichsetzung des Idealzustands der Seelenruhe in der Stoa und im Epikureismus. Sie begründet die Notwendigkeit, den historischen Kontext und die philosophischen Grundlagen beider Schulen zu berücksichtigen, um die Seelenruhe angemessen zu verstehen. Aufgrund von Zeit- und Platzmangel wird auf eine ausführliche Beschreibung des Hellenismus verzichtet; der Fokus liegt auf den beiden ausgewählten philosophischen Schulen, deren Weltverständnis und Philosophie (ohne Logik) dargestellt werden. Der methodische Ansatz beinhaltet die Einzelbeschreibung jeder philosophischen Richtung, gefolgt von einem Vergleich der Konzepte der Seelenruhe und deren Emotionstheorien. Das Fazit enthält keine Zusammenfassung, sondern persönliche Gedanken.
1. Die Stoa – allgemeiner Hintergrund: Dieses Kapitel beschreibt den Entstehungskontext der Stoa im Kontext der politischen Unruhen nach Alexanders Tod und der Entstehung neuer Königreiche. Es wird die Etablierung der Stoa als praktische Philosophie in Zeiten der Krise und Orientierungslosigkeit hervorgehoben. Die Einteilung der Stoa in drei Phasen (Alte, Mittlere, Späte Stoa) wird vorgestellt, wobei die Schwierigkeit, aufgrund begrenzter Quellen, Informationen über die ältere und mittlere Stoa zu erhalten, erwähnt wird. Das Kapitel betont das Ideal eines Lebens im Einklang mit der Natur, Unabhängigkeit von Begierden, tugendhaftes Leben und Leidenschaftslosigkeit sowie die stoische Vorstellung von der Gleichberechtigung aller Menschen als Teilhaber am Logos und der Pflicht zur gesellschaftlichen Teilhabe.
1.1 Die philosophischen Grundlagen der Stoa: Dieses Kapitel untersucht die philosophischen Grundlagen der Stoa, insbesondere den Begriff des Logos, der als allumfassendes Weltgesetz verstanden wird, welches alles schafft, ordnet und vorherbestimmt. Der Begriff des Logos wird in seiner erkenntnistheoretischen und ontologischen Bedeutung erläutert, die Einheit von Gott und Natur als Grundlage des stoischen Weltbildes hervorgehoben und die Materialität der Stoa (Stoff und Geist als Prinzipien der Welt) dargelegt. Die Rolle des Pneuma als verbindendes Element aller Dinge und seine Bedeutung für die Kommunikation und das Mitgefühl wird erklärt. Die Zitate von Marc Aurel und Cicero unterstreichen die stoische Auffassung vom Kosmos als lebendigem Organismus, beseelt vom Logos.
Schlüsselwörter
Stoa, Epikureismus, Seelenruhe, Ataraxia, Apatheia, Logos, Pneuma, Emotionen, Affekte, Begierden, Glückseligkeit, Hellenismus, Ethik, Philosophie, Natur, Vernunft.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Stoa vs. Epikureismus - Seelenruhe im Vergleich
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht und vergleicht die Konzepte der Seelenruhe (ataraxia und apatheia) in der stoischen und epikureischen Philosophie. Sie analysiert, ob die Seelenruhe in beiden Schulen gleichgesetzt werden kann und beleuchtet dazu die philosophischen Grundlagen, Emotionstheorien und Vorstellungen von Glückseligkeit.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die philosophischen Grundlagen der Stoa und des Epikureismus, die Konzepte von Emotionen und Affekten/Begierden in beiden Schulen, die Bedeutung des Logos in der stoischen Philosophie, das Konzept der Glückseligkeit (als Lust im Epikureismus, als tugendhaftes Leben in der Stoa) und einen detaillierten Vergleich der Konzepte von Seelenruhe.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage formuliert und den methodischen Ansatz erläutert. Es folgen Kapitel zur Stoa (inkl. Unterkapitel zu philosophischen Grundlagen und Emotionstheorien) und zum Epikureismus (ebenfalls mit Unterkapiteln zu Grundlagen und Emotionstheorien). Ein separates Kapitel vergleicht die Konzepte der Seelenruhe. Die Arbeit schließt mit einem Fazit ab (ohne Zusammenfassung, mit persönlichen Gedanken).
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in jedem einzelnen?
Die Arbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung (Formulierung der Forschungsfrage, methodischer Ansatz), Die Stoa – allgemeiner Hintergrund (Entstehungskontext, Einteilung in Phasen, Ideale), Die philosophischen Grundlagen der Stoa (Logos, Pneuma, Weltbild), Epikureismus – allgemeiner Hintergrund (Entstehung und Ideale), Emotionen und Begierden im Epikureismus (Grundlagen und Emotionstheorie), Vergleich der Seelenruhe in der Stoa und im Epikureismus (direkter Vergleich der Konzepte), Fazit (persönliche Reflexion).
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Stoa, Epikureismus, Seelenruhe, Ataraxia, Apatheia, Logos, Pneuma, Emotionen, Affekte, Begierden, Glückseligkeit, Hellenismus, Ethik, Philosophie, Natur, Vernunft.
Welche Quellen werden verwendet (implizit)?
Die Hausarbeit bezieht sich implizit auf die Schriften wichtiger stoischer und epikureischer Philosophen wie Marc Aurel und Cicero (Stoa), sowie auf die Schriften Epikurs und seiner Nachfolger (Epikureismus). Die genauen Quellen sind nicht explizit in der vorliegenden HTML-Struktur benannt.
Welche Einschränkungen gibt es?
Aufgrund von Zeit- und Platzmangel wird auf eine ausführliche Beschreibung des Hellenismus verzichtet. Der Fokus liegt ausschließlich auf der Stoa und dem Epikureismus. Die Logik beider Philosophien wird ebenfalls nicht detailliert behandelt.
Was ist das Fazit der Arbeit (in Kurzfassung)?
Das Fazit beinhaltet keine Zusammenfassung der Ergebnisse, sondern persönliche Gedanken des Autors/der Autorin zum Vergleich der Seelenruhe in der Stoa und im Epikureismus.
- Citar trabajo
- Gina Stöcklein (Autor), 2011, Die Seelenruhe im Epikureismus und der Stoa, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279171