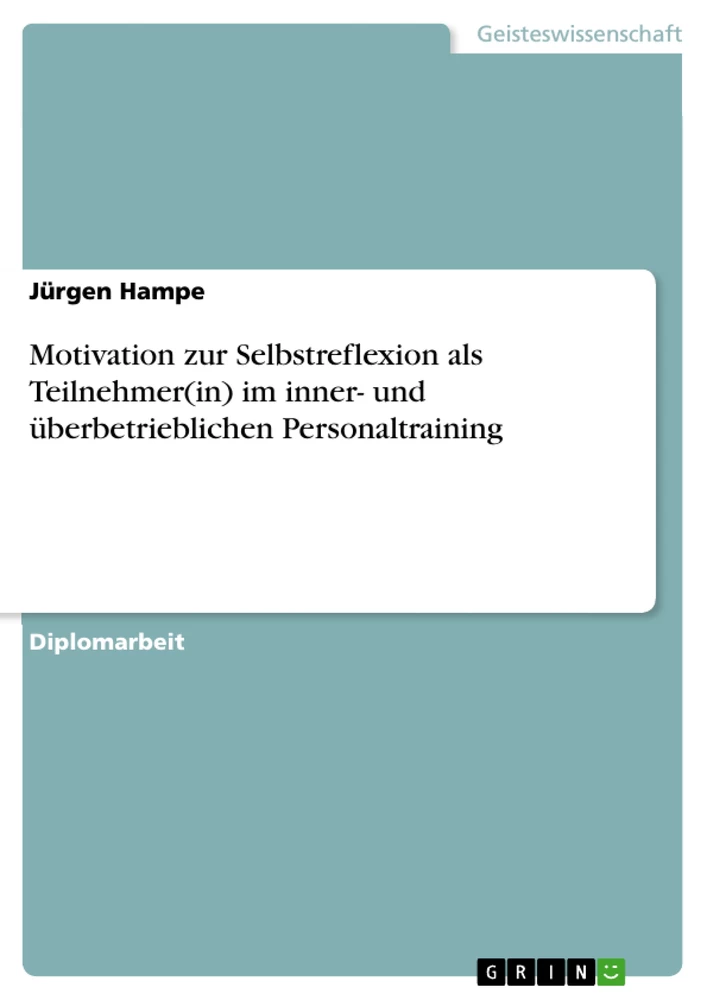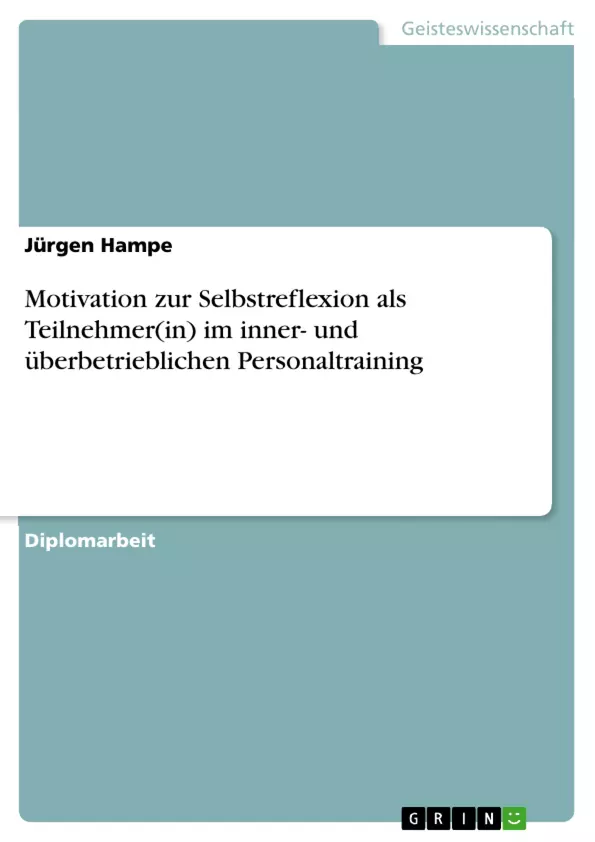Im Rahmen dieser Diplomarbeit habe ich mein berufliches Umfeld zum Gegenstand der wissenschaftlichen Erforschung von relevanten theoretischen Begründungszusammenhängen gemacht. Das Forschungsfeld entsteht aus meiner langjährigen beruflichen Tätigkeit als Leiter verschiedener inner- und überbetrieblicher Personaltrainings.
Meine Seminarteilnehmer(-innen) äußern häufig bereits zu Beginn eines Trainings den Wunsch nach allgemeingültigen Ratschlägen, Verhaltensrezepten, Tipps oder Tricks zum jeweiligen Seminarthema. Besonders ausgeprägt erlebe ich diese anfängliche Erwartungshaltung in Zeitmanagement-Seminaren.
Das Ziel dieser Arbeit ist nicht der empirische Nachweis der Wirkung des Seminars. Mein Erkenntnisinteresse in dieser Literaturarbeit gilt den theoretischen Zusammenhängen bezüglich der Motivation zur Selbstreflexion im Seminarkontext. Die Forschungsfrage, der ich bei der Betrachtung des Zeitmanagement-Seminars nachgehen werde, lautet:
Wie erklärt sich die Motivation von Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmern zur Selbstreflexion im dargestellten Fallbeispiel?
Ich möchte Faktoren identifizieren, die die Selbstreflexion im Seminar fördern können. Im Fokus der Untersuchung stehen der Seminaraufbau, die Seminarme-thodik und das Verhalten der Trainer. Bei der Literaturauswahl berücksichtige ich die Erkenntnisse von Arbeits- und Organisationspsychologen, die in Theorie und Praxis dieses Feld untersucht haben und prüfe, inwieweit sich ihre Ergebnisse auf die Fallvignette beziehen lassen. Weiterhin bilden Erkenntnisse der Kognitionspsychologie, der Therapieforschung, der Erwachsenenbildung, der Sozialpsychologie und der Systemtheorie den literarischen Schwerpunkt dieser Arbeit. Die Betrachtung von Gruppenprozessen spielt hier eine untergeordnete Rolle, da die selbstreflexiven Seminarmodule zumeist in Partnerarbeit organisiert sind.
Die Erkenntnisse dieser Arbeit sind meines Erachtens relevant für Weiterbildungsverantwortliche in Unternehmen und für Trainer(-innen), denen es darum geht, bei der Konzeption von Personaltrainings die Selbstreflexion zum Wohle von Seminarteilnehmer(-innen) erfolgreich für die Entwicklung authentischer Lösungswege zu berücksichtigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungsmethodik
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Fallvignette
- 2.1 Vorbereitung auf die Selbstreflexion (Bausteine: „Vorbereitung 1-7“)
- 2.1.1 Vorbereitung 1: Einleitung mit humorvoller Grafik
- 2.1.2 Vorbereitung 2: Hinführung zum Seminarthema und Seminarziel
- 2.1.3 Vorbereitung 3: „Goldene“ Regeln des Zeitmanagements
- 2.1.4 Vorbereitung 4: Zeitdiebe sammeln und den wichtigsten persönlichen Zeitdieb auswählen
- 2.1.5 Vorbereitung 5/Reflexionsschritt 1: Vision und Ziele schriftlich ausarbeiten
- 2.1.6 Vorbereitung 6: Übersicht und Zustimmung zum Reflexionsprozess
- 2.1.7 Vorbereitung 7: Kurze Vorstellung des persönlichen Zeitdiebs in der Gruppe
- 2.2 Beschreibung der selbstreflexiven Arbeit im Seminar
- 2.2.1 Reflexionsschritt 2: Partnerinterview „Dem Zeitdieb auf die Spur kommen“
- 2.2.2 Reflexionsschritt 3: Brainstorming zu Lösungsmöglichkeiten
- 2.2.3 Reflexionsschritt 4: Wahl des persönlichen Lösungsweges
- 2.2.4 Exkurs: Veränderung und persönliche Einstellungen
- 2.2.5 Reflexionsschritt 5: Präzisierung und Konkretisierung der Lösungsschritte
- 2.2.6 Reflexionsschritt 6: „Ökocheck“
- 2.3 Zusammenfassung
- 2.1 Vorbereitung auf die Selbstreflexion (Bausteine: „Vorbereitung 1-7“)
- 3. Verortung des Begriffs „Selbstreflexion“ im Seminarkontext
- 3.1 Selbstreflexion in Bezug auf das Selbstkonzept
- 3.2 Begriffliche Einordnung: „Reflexion“ und „Selbstreflexion“
- 3.3 Selbstreflexion im Kontext von Problemlöseprozessen
- 3.4 Arbeitsdefinition des Begriffs „Selbstreflexion“ für den Seminarkontext
- 3.5 Zusammenfassung
- 4. Hemmende und förderliche Faktoren der Selbstreflexion
- 4.1 Vermeidungstendenzen bezüglich Selbstreflexion
- 4.2 Theorie der Selbstaufmerksamkeit und Selbstreflexion nach Greif (2008)
- 4.3 Die Ökonomie-Tendenz
- 4.4 Soziale Aspekte der Selbstreflexion
- 4.4.1 Private und öffentliche Selbstaufmerksamkeit
- 4.4.2 Funktionen der Gruppe
- 4.5 Affektzustand und Selbstreflexion
- 4.6 Zusammenfassung
- 5. Selbstreflexion im Coaching
- 5.1 Coaching vs. Training
- 5.2 Ergebnisorientiertes Coaching nach Greif
- 5.2.1 Methodische Empfehlungen
- 5.2.1.1 Problemlösekreis-Schritt: „Analyse“
- 5.2.1.2 Problemlösekreis-Schritt: „Zieldefinition“
- 5.2.1.3 Zusammenfassung
- 5.2.2 Unterstützung der Affektkontrolle
- 5.2.1 Methodische Empfehlungen
- 5.3 Systemisches Coaching
- 5.3.1 Systemische Haltung des Coaches
- 5.3.2 Funktion der Fragetechniken
- 5.3.2.1 Reflexionsschritt 2 „Analyse“
- 5.3.2.2 Reflexionsschritt 5 „Konkrete Schritte“
- 5.3.2.3 Reflexionsschritt 6 „Ökocheck“
- 5.4 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Motivation zur Selbstreflexion von Teilnehmern in inner- und überbetrieblichen Personaltrainings. Ziel ist es, die förderlichen und hemmenden Faktoren für Selbstreflexionsprozesse im Kontext von Zeitmanagement-Seminaren zu identifizieren und zu analysieren.
- Förderliche und hemmende Faktoren der Selbstreflexion
- Selbstreflexion im Kontext von Problemlöseprozessen
- Vergleich von Coaching und Training hinsichtlich Selbstreflexion
- Die Rolle von Selbstaufmerksamkeit und Affekt bei der Selbstreflexion
- Methodische Ansätze zur Förderung der Selbstreflexion im Training
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein, beschreibt die Forschungsmethodik und skizziert den methodischen Ablauf der Untersuchung zur Motivation von Teilnehmern in Personaltrainings zur Selbstreflexion. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Faktoren, welche die Selbstreflexion beeinflussen.
2. Fallvignette: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Beschreibung eines Zeitmanagement-Seminars als Fallbeispiel. Es wird der Ablauf des Seminars, die verwendeten Methoden und die einzelnen Schritte des Selbstreflexionsprozesses für die Teilnehmer detailliert dargestellt. Dies dient als Grundlage für die spätere Analyse der förderlichen und hemmenden Faktoren der Selbstreflexion.
3. Verortung des Begriffs „Selbstreflexion“ im Seminarkontext: Dieses Kapitel befasst sich mit der theoretischen Einordnung des Begriffs „Selbstreflexion“. Es werden verschiedene Definitionen und Perspektiven auf Selbstreflexion diskutiert, insbesondere im Zusammenhang mit dem Selbstkonzept und Problemlöseprozessen. Das Kapitel mündet in einer Arbeitsdefinition von Selbstreflexion, spezifisch für den Kontext des untersuchten Seminars.
4. Hemmende und förderliche Faktoren der Selbstreflexion: In diesem Kapitel werden die Faktoren untersucht, die die Selbstreflexion positiv oder negativ beeinflussen. Es werden Vermeidungstendenzen analysiert und theoretische Modelle wie die Theorie der Selbstaufmerksamkeit herangezogen, um die komplexen Zusammenhänge zwischen Selbstreflexion, sozialen Aspekten und dem Affektzustand zu beleuchten.
5. Selbstreflexion im Coaching: Dieses Kapitel vergleicht die Ansätze von Coaching und Training im Hinblick auf Selbstreflexion. Es werden verschiedene Coaching-Methoden vorgestellt, und deren Eignung zur Förderung der Selbstreflexion wird diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die im Seminar angewendeten Reflexionsschritte. Der Fokus liegt auf ergebnisorientiertem und systemischem Coaching.
Schlüsselwörter
Selbstreflexion, Personaltraining, Zeitmanagement, Coaching, Problemlöseprozess, Selbstaufmerksamkeit, Affekt, förderliche Faktoren, hemmende Faktoren, Vermeidungstendenzen, methodische Ansätze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Selbstreflexion im Zeitmanagement-Seminar
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Motivation zur Selbstreflexion von Teilnehmern in inner- und überbetrieblichen Personaltrainings, speziell im Kontext von Zeitmanagement-Seminaren. Sie analysiert die förderlichen und hemmenden Faktoren für Selbstreflexionsprozesse in diesem Bereich.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die förderlichen und hemmenden Faktoren für Selbstreflexionsprozesse in Zeitmanagement-Seminaren zu identifizieren und zu analysieren. Sie untersucht den Einfluss von Selbstaufmerksamkeit, Affekt und sozialen Aspekten auf die Selbstreflexion.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Förderliche und hemmende Faktoren der Selbstreflexion, Selbstreflexion im Kontext von Problemlöseprozessen, Vergleich von Coaching und Training hinsichtlich Selbstreflexion, die Rolle von Selbstaufmerksamkeit und Affekt bei der Selbstreflexion und methodische Ansätze zur Förderung der Selbstreflexion im Training.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Eine Einleitung, eine Fallvignette (detaillierte Beschreibung eines Zeitmanagement-Seminars), ein Kapitel zur theoretischen Verortung des Begriffs „Selbstreflexion“, ein Kapitel zu hemmenden und förderlichen Faktoren der Selbstreflexion und ein Kapitel zum Vergleich von Selbstreflexion im Coaching und Training.
Was wird in der Fallvignette beschrieben?
Die Fallvignette präsentiert einen detaillierten Ablauf eines Zeitmanagement-Seminars als Fallbeispiel. Sie beschreibt die verwendeten Methoden und die einzelnen Schritte des Selbstreflexionsprozesses, um die spätere Analyse der förderlichen und hemmenden Faktoren zu ermöglichen.
Wie wird der Begriff „Selbstreflexion“ definiert?
Das Kapitel 3 befasst sich mit der theoretischen Einordnung des Begriffs „Selbstreflexion“. Es werden verschiedene Definitionen und Perspektiven diskutiert und es wird eine spezifische Arbeitsdefinition für den Kontext des untersuchten Seminars entwickelt.
Welche Faktoren beeinflussen die Selbstreflexion?
Kapitel 4 analysiert sowohl förderliche als auch hemmende Faktoren der Selbstreflexion. Es werden Vermeidungstendenzen, die Theorie der Selbstaufmerksamkeit und die Rolle von sozialen Aspekten und Affekten untersucht.
Wie unterscheidet sich Selbstreflexion im Coaching und Training?
Kapitel 5 vergleicht Coaching- und Trainingsansätze hinsichtlich der Selbstreflexion. Es werden verschiedene Coaching-Methoden (ergebnisorientiertes und systemisches Coaching) vorgestellt und ihre Eignung zur Förderung der Selbstreflexion diskutiert.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Einleitung beschreibt die genaue Forschungsmethodik und den methodischen Ablauf der Untersuchung zur Motivation von Teilnehmern in Personaltrainings zur Selbstreflexion.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstreflexion, Personaltraining, Zeitmanagement, Coaching, Problemlöseprozess, Selbstaufmerksamkeit, Affekt, förderliche Faktoren, hemmende Faktoren, Vermeidungstendenzen, methodische Ansätze.
- Citation du texte
- Diplom-Psychologe Jürgen Hampe (Auteur), 2009, Motivation zur Selbstreflexion als Teilnehmer(in) im inner- und überbetrieblichen Personaltraining, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280020