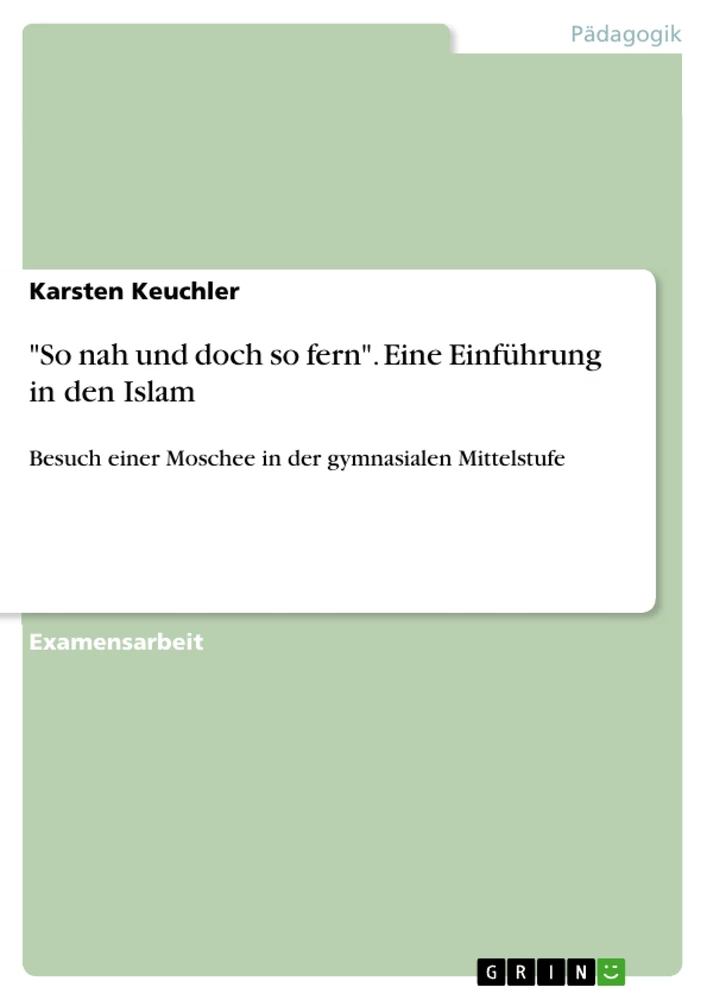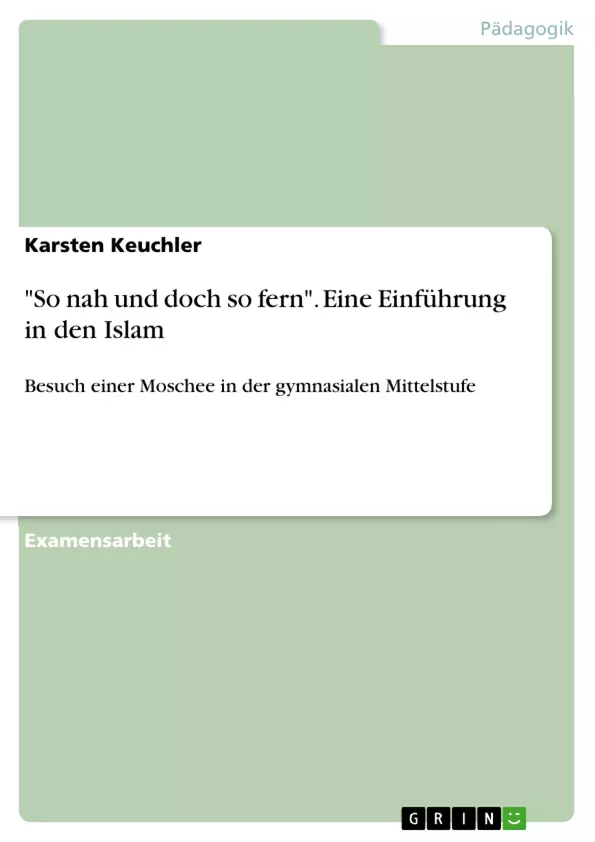"Was ist das eigentlich genau, dieser Islam?" Die Antwort auf diese Frage wurde an manchem Stammtisch schnell gefunden: Demnach sei es etwa eine blutrünstige, unkultivierte Religion dieser unzivilisierten Völker östlicher Schurkenstaaten, gegen die sich der westliche Kulturverbund, angeführt vom amerikanischen Militär, bis heute im Kriegszustand befindet, obgleich im Englischen längst eine Unterscheidung zum traditionellen Krieg zwischen Staaten geschaffen wurde, indem in diesem konkreten Fall des Terrors aus dem Inneren vom public enemy die Rede ist.
Leider ist es bis zum heutigen Tage eben genau diese unaufgeklärte, pauschale Verurteilung des Islam als Kriegerreligion, die sich in manch einem Kopf festgesetzt hat und unter Umständen derart unreflektiert an die eigenen Kinder weitervermittelt wird. "So nah und doch so fern": Muslimische Mitmenschen bereichern die deutsche Bevölkerung nun bereits seit etwa fünfzig Jahren, doch scheinen sich die Fronten zwischen jenen ohne Migrationshintergrund und solchen, die muslimisch geprägten Ländern entstammen, eher zu verhärten denn aufzuweichen, und das ironischerweise in einer Zeit schwindender religiöser und konfessioneller Gebundenheit und zunehmender Privatisierung und Individualisierung des Glaubens.
Hier kann, soll und muss die Schule einsetzen. In die Verantwortung muss sich dabei in besonderem Maße der Religionsunterricht nehmen, wenngleich nicht erst seit den Anschlägen ohnehin eine wie auch immer geartete Islamkunde auf dem Programm steht. Doch dem Suchen des interreligiösen Dialogs muss ein breiterer Raum geboten werden, als es vielleicht früher der Fall war. Die Materie ist schlichtweg sensibler geworden. Speziell im Hochsauerlandkreis, der einen deutlich geringeren Anteil muslimischer Mitbürger und Einwanderer aufweist, als dies in den Ballungsgebieten des Bundeslands Nordrhein-Westfalen der Fall ist, ist die Lehrperson gefordert, Vorurteilen, die gegenüber dem Fremden erfahrungsgemäß zwangsläufig bei einigen entstehen, angemessen zu begegnen. Denn ob es tatsächlich in Anspielung auf den Landtagswahlkampf 2010 "pro NRW" ist, Minarette u.ä. zu verbieten, muss auch von einem Schüler oder einer Schülerin der siebten Klasse kritisch hinterfragt werden können. Die Schule muss es vorleben, auf andere zuzugehen, offen zu fragen, zu erkunden und zu erleben. Dabei kann eine Erfahrung mit allen Sinnen, die im Rahmen einer Exkursion in eine Moschee gemacht wird, nachhaltige Ergebnisse erzielen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Wahl des außerschulischen Lernorts
- II.1. Der performative Ansatz und außerschulische Lernorte allgemein
- II.2. Zur Bedeutung von Kulträumen
- II.3. Die Moschee Fatih Camii in Meschede
- III. Vorüberlegungen zur Organisation
- III.1. Organisatorische Notwendigkeiten und rechtliche Grundlagen
- III.2. Regeln für den Besuch der Moschee
- IV. Einbindung in den Lernprozess
- IV.1. Das Unterrichtsthema in den Richtlinien und Lehrplänen
- IV.2. Zielperspektive und mögliche Inhalte der Unterrichtsreihe
- IV.3. Zielperspektive des Besuchs der Moschee
- V. Methodische Überlegungen: Eine Erkundung in 5 Phasen
- VI. Reflexion
- VII. Bezug der Arbeit zu Lehrerfunktionen
- VIII. Quellenverzeichnis
- IX. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Planung und Durchführung einer Exkursion in eine Moschee im Rahmen einer Unterrichtsreihe über den Islam. Ziel ist es, ein praktikables Angebot für Religionslehrerinnen im Hochsauerlandkreis zu schaffen, um die Mescheder Moschee mit einer siebten Klasse zu erkunden. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung außerschulischer Lernorte im Religionsunterricht, insbesondere im Kontext des performativen Ansatzes, und untersucht die Relevanz von Kulträumen für das Verständnis religiöser Lebenswelten.
- Der performative Ansatz im Religionsunterricht
- Die Bedeutung von Kulträumen für das Verständnis religiöser Lebenswelten
- Die Moschee als außerschulischer Lernort
- Rechtliche Rahmenbedingungen für den Besuch einer Moschee
- Methodische Überlegungen zur Gestaltung einer Exkursion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den aktuellen Diskurs über den Islam in Deutschland dar und argumentiert für die Notwendigkeit eines interreligiösen Dialogs, der durch außerschulische Lernorte wie Moscheebesuche gefördert werden kann. Das zweite Kapitel beleuchtet den performativen Ansatz im Religionsunterricht und die Bedeutung von Kulträumen für das Verständnis religiöser Lebenswelten. Es wird die Moschee Fatih Camii in Meschede als außerschulischer Lernort vorgestellt. Das dritte Kapitel befasst sich mit den organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für den Besuch der Moschee. Das vierte Kapitel erläutert die Einbindung des Themas in den Lernprozess, die Zielperspektive und mögliche Inhalte der Unterrichtsreihe. Das fünfte Kapitel beschreibt methodische Überlegungen zur Gestaltung der Exkursion in fünf Phasen. Die Reflexion im sechsten Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und beleuchtet den Bezug der Arbeit zu Lehrerfunktionen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den performativen Ansatz im Religionsunterricht, außerschulische Lernorte, Kulträume, Moscheebesuche, interreligiösen Dialog, Islamkunde, Rechtliche Rahmenbedingungen, methodische Überlegungen, Unterrichtsreihe, Zielperspektive, Lehrerfunktionen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Besuch einer Moschee im Religionsunterricht sinnvoll?
Ein Moscheebesuch ermöglicht eine Erfahrung mit allen Sinnen. Er fördert den interreligiösen Dialog und hilft Schülern, Vorurteile durch direkte Begegnung und Erkundung abzubauen.
Was bedeutet der "performative Ansatz" in der Religionspädagogik?
Dieser Ansatz betont das Erleben und Handeln. Es geht nicht nur um theoretisches Wissen über Religion, sondern um das Eintauchen in religiöse Räume und Praktiken.
Welche Moschee wird in dieser Arbeit als Lernort vorgestellt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Moschee Fatih Camii in Meschede (Hochsauerlandkreis) als praktisches Beispiel für eine Exkursion.
Welche Regeln müssen beim Besuch einer Moschee beachtet werden?
Wichtige Regeln sind das Ausziehen der Schuhe, angemessene Kleidung und respektvolles Verhalten im Gebetsraum. Diese sollten im Unterricht vorab geklärt werden.
In welcher Klassenstufe wird das Thema Islam laut Lehrplan behandelt?
Die Unterrichtsreihe und die Exkursion sind in diesem Entwurf speziell für eine siebte Klasse an einem Gymnasium konzipiert.
- Arbeit zitieren
- Karsten Keuchler (Autor:in), 2011, "So nah und doch so fern". Eine Einführung in den Islam, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280138