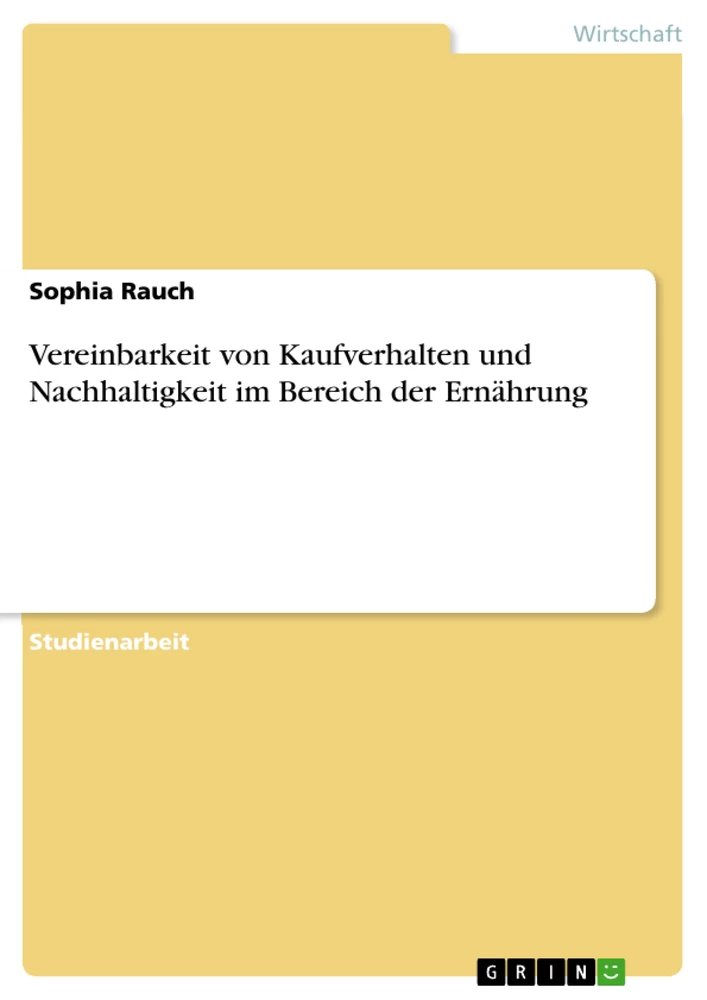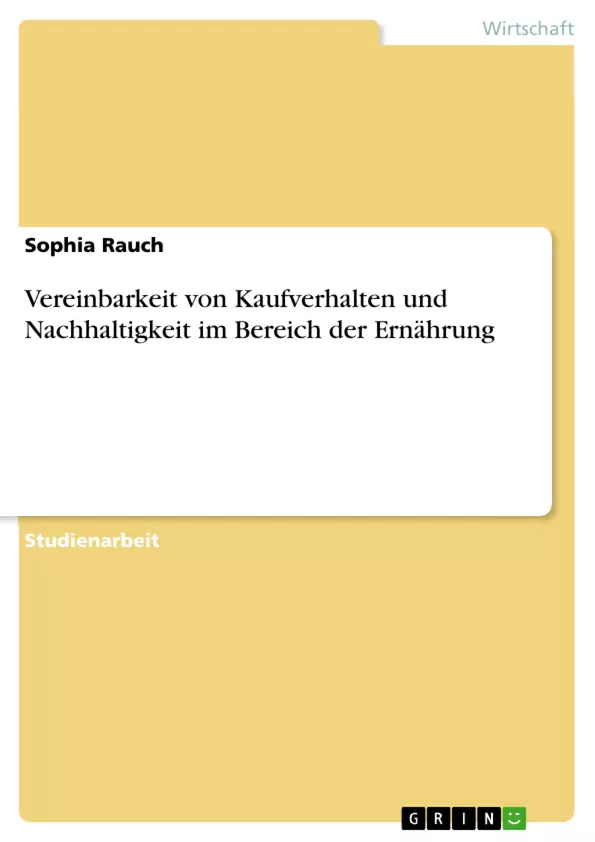Täglich wird in den Medien über die Zerstörung der Umwelt, den Klimawandel sowie deren Ursachen und Folgen berichtet. Der Mensch ist hierbei nicht unschuldig, die-ses Wissen ist seit vielen Jahren kein Geheimnis mehr. Dass der Mensch durch die Befriedigung von unendlichen Bedürfnissen die Umwelt schädigt, ist den meisten klar. Welche exakten Auswirkungen dieses unbewusste Konsumieren hat, wird bis-her jedoch kaum beachtet. Dabei könnten schon kleine Maßnahmen im alltäglichen Leben die Umwelt schonen. Nachhaltiges Konsumieren bzw. bedachter Konsum sind gefragt. Doch was genau ist das überhaupt? Welche Auswirkungen hat das Kaufverhalten in Bezug auf die Umwelt und ist eine Umstellung dessen überhaupt notwendig? Unwissenheit auf der einen und Ignoranz auf der anderen Seite sind große Problemfelder, deren Vorhandensein auf Kosten der Natur gehen. Die Zahl derer, die über das Wissen der theoretischen Grundlagen nachhaltigen Konsums verfügen, ist aktuell leider noch beträchtlich höher, als die Anzahl derjenigen, die ihr Wissen konkret in die Tat umsetzen. Fakt ist, dass jeder Einzelne zum Erhalt und zur Verbesserung der Umwelt beitragen kann, wenn er von seinem bisherigen Kon-summuster abweicht. Es stellt sich somit die Frage: Inwiefern ist umweltbewusstes Denken und Handeln in den Köpfen der Menschen bereits verankert, welche Bedeu-tung hat es und wie orientiert sich ihr Kaufverhalten am Prinzip der Nachhaltigkeit? Durch die immer stärker werdende mediale Präsenz des Klimawandels zeigt sich bereits der Trend in Richtung nachhaltiger Lebensstile. Folglich haben mehr Men-schen die Problematik zur Kenntnis genommen, welche durch ihre Aktualität und Brisanz zu einem zentralen Thema der Gesellschaft geworden ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Leitbild der Nachhaltigkeit
- Definition Nachhaltigkeit
- Historischer Hintergrund des Begriffs „Nachhaltigkeit“
- Aktuelle Bedeutung von Nachhaltigkeit
- Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit
- Indikatoren der Nachhaltigkeit
- Definition Nachhaltigkeit
- Kaufverhalten von Konsumenten
- Definition und Bedeutung von Konsum
- Einflussfaktoren beim Konsum hinsichtlich Nachhaltigkeit
- Low-Cost-Hypothese
- Sozio-ökologisches Lebensstilkonzept
- Vereinbarkeit von Kaufverhalten und Nachhaltigkeit im Bereich der Ernährung
- Bedeutung und Maßnahmen nachhaltigen Konsums
- Umfrage: „Wie nachhaltig wird in unserer Region eingekauft und welche Beweggründe spielen bei Konsumenten eine Rolle?"
- Methodik
- Auswertung und Analyse der Ergebnisse
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Buchquellen
- Internetquellen
- Abbildungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Kaufverhalten von Konsumenten und dessen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit. Ziel ist es, die Bedeutung des nachhaltigen Konsums zu beleuchten und die Faktoren zu analysieren, die das Kaufverhalten von Konsumenten beeinflussen. Dabei wird insbesondere der Bereich der Ernährung betrachtet.
- Definition und Bedeutung von Nachhaltigkeit
- Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie, Soziales)
- Einflussfaktoren auf das Kaufverhalten von Konsumenten hinsichtlich Nachhaltigkeit
- Bedeutung und Maßnahmen nachhaltigen Konsums im Bereich der Ernährung
- Analyse der Ergebnisse einer Umfrage zum nachhaltigen Konsumverhalten in der Region
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Problematik des unbewussten Konsums und dessen Auswirkungen auf die Umwelt. Sie stellt die Frage nach der Bedeutung von nachhaltigem Konsum und der Notwendigkeit einer Umstellung des Kaufverhaltens.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit. Es definiert den Begriff „Nachhaltigkeit“ und beleuchtet seinen historischen Hintergrund. Die aktuelle Bedeutung von Nachhaltigkeit wird im Kontext der Brundtland-Kommission erläutert. Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie, Soziales) werden vorgestellt und anhand eines Schnittmengenmodells veranschaulicht.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Kaufverhalten von Konsumenten. Es definiert den Begriff „Konsum“ und erläutert dessen Bedeutung. Die Einflussfaktoren beim Konsum hinsichtlich Nachhaltigkeit werden analysiert, wobei die Low-Cost-Hypothese und das sozio-ökologische Lebensstilkonzept im Fokus stehen.
Das vierte Kapitel untersucht die Vereinbarkeit von Kaufverhalten und Nachhaltigkeit im Bereich der Ernährung. Es beleuchtet die Bedeutung und Maßnahmen nachhaltigen Konsums in diesem Bereich. Die Ergebnisse einer Umfrage zum nachhaltigen Konsumverhalten in der Region werden vorgestellt und analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Nachhaltigkeit, Konsumverhalten, Kaufverhalten, Umwelt, Ökologie, Ökonomie, Soziales, Ernährung, nachhaltiger Konsum, Low-Cost-Hypothese, sozio-ökologisches Lebensstilkonzept, Umfrage, Region.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Nachhaltigkeit im Bereich der Ernährung?
Nachhaltige Ernährung bedeutet, Lebensmittel so auszuwählen und zu konsumieren, dass ökologische, ökonomische und soziale Dimensionen im Gleichgewicht stehen und die Umwelt geschont wird.
Warum klafft eine Lücke zwischen Wissen und Handeln?
Die Zahl derer, die über theoretisches Wissen verfügen, ist hoch, doch Unwissenheit über exakte Auswirkungen und Ignoranz verhindern oft die praktische Umsetzung im Alltag.
Was besagt die Low-Cost-Hypothese beim Konsum?
Die Hypothese besagt, dass Menschen eher bereit sind, nachhaltig zu handeln, wenn die persönlichen Kosten oder der Aufwand dafür gering sind.
Welche Rolle spielen Medien beim nachhaltigen Konsum?
Durch die starke mediale Präsenz des Klimawandels rücken nachhaltige Lebensstile stärker in das Bewusstsein der Gesellschaft und fördern den Trend zu bedachterem Kaufverhalten.
Was sind die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit basiert auf den drei Säulen Ökologie (Umweltschutz), Ökonomie (Wirtschaftlichkeit) und Soziales (Gerechtigkeit).
- Quote paper
- Sophia Rauch (Author), 2013, Vereinbarkeit von Kaufverhalten und Nachhaltigkeit im Bereich der Ernährung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280332