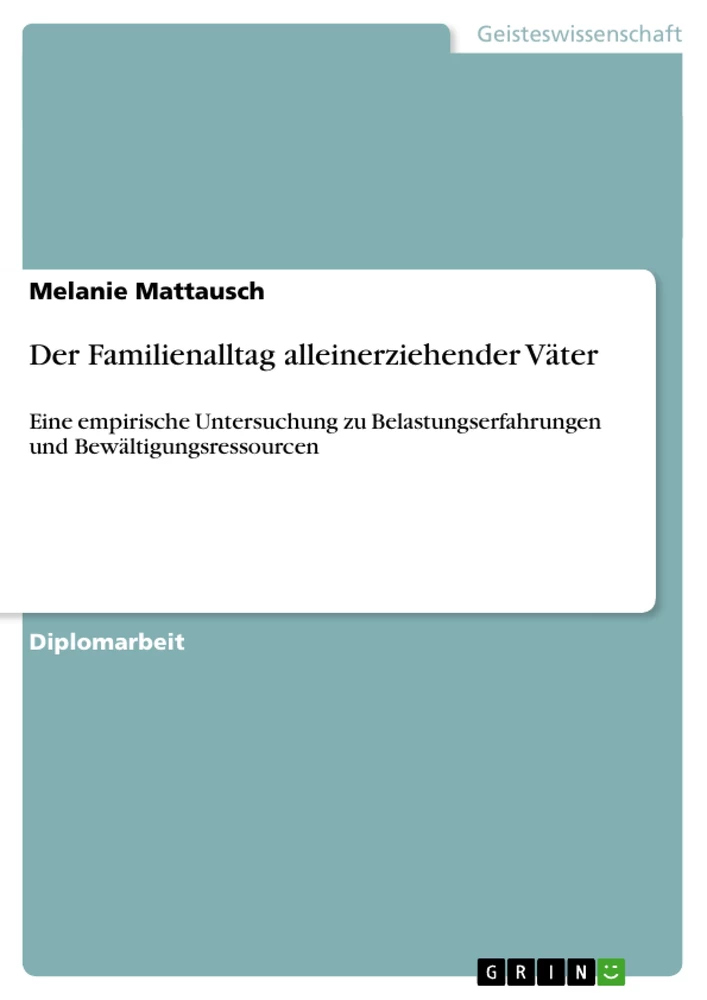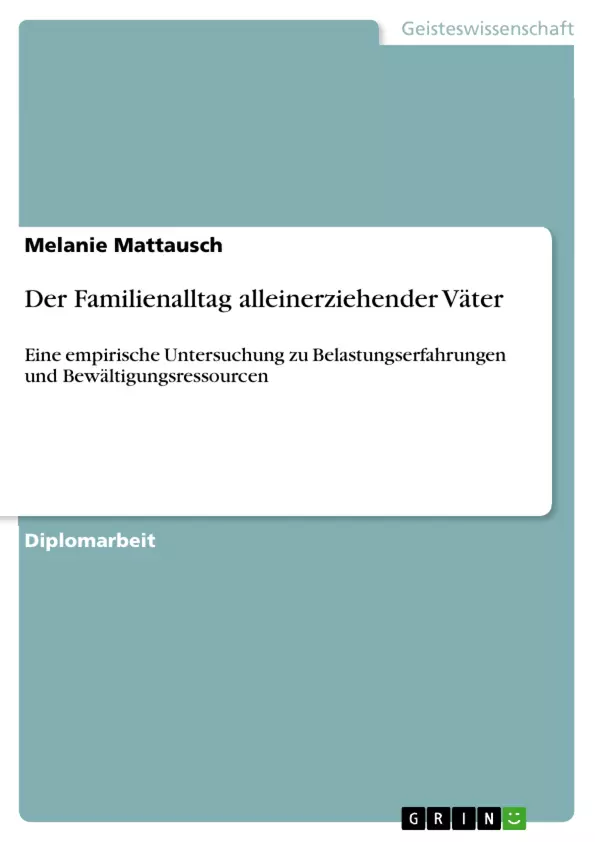Vaterlose Gesellschaft? Fehlen unserer Gesellschaft die Väter? Diese polemischen Fragen aus der Sicht mancher weiblicher Beobachter provozieren eine genauere Betrachtung der tatsächlichen Verhältnisse.
Während einst die Familienarbeit den Müttern allein überlassen war, beginnt sich allmählich ein Rollenwandel zu vollziehen. Empirischen Untersuchungen zufolge möchte ein immer größer werdender Teil der Väter aktiv Verantwortung für seine Kinder übernehmen und an deren Erziehung und Entwicklung teilhaben. Sie wollen nicht nur Zahl- bzw. Wochenendväter sein.
Nicht zuletzt infolge zunehmender Scheidungszahlen ist, neben einer sich mit den verändernden gesellschaftlichen Bedingungen und Einstellungen ergebenden Vielfalt von Familienformen, auch die Existenz diverser Vatertypen festzustellen: neue Väter, Stiefväter, Adoptivväter, Pflegeväter
und nicht zuletzt alleinerziehende Väter u. a. So gibt es immer mehr Väter, die nach Trennung und Scheidung mehr oder weniger aktiv die Familienform der Vaterfamilie suchen. Mit ihrer statistischen Anzahl von 386.000 im Jahr 2004 sind sie in Deutschland keine Ausnahmeerscheinung mehr, sondern eine beachtliche Größe – gar die schnellstwachsende Familienform. Dennoch sind die alleinerziehenden Väter mit ihrem überaus hohen Engagement, ihren Bewältigungsstrategien, aber auch mit ihren alltäglichen Belastungserfahrungen eine bislang in der Wissenschaft und Praxis weitgehend unentdeckte Gruppe, was es mir zum Anlass machte, mich näher mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
Alleinerziehende Väter kämpfen mit teilweise ähnlichen Problemen wie alleinerziehende Mütter: Sie müssen Erwerbstätigkeit, Kindererziehung und Haushalt vereinbaren. Die Verunsicherung durch den Verlust der Partnerin sowie andauernde Konflikte im Rahmen der Trennung/Scheidung belasten. Hinzu kommen finanzielle Einbußen und Engpässe sowie Zeitnöte. Aber nicht zu vergessen ist die neue, geschlechtsfremde Rolle und die Übernahme fremder, bislang weitgehend der Partnerin überlassener Aufgaben – eine
Herausforderung, die für alleinerziehende Mütter häufig nicht so gravierend ist. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Teil I: Theoretische Grundlagen
- 1. Die Ein-Eltern-Familie als alternative Lebensform
- 1.1 Die Familie im Wandel
- 1.2 Begriffsbestimmung
- 2. Die Ein-Eltern-Familie im Spiegel der amtlichen Statistik
- 2.1 Ein-Eltern-Familien – eine Lebensform mit quantitativer Bedeutung
- 2.2 Ein-Eltern-Familien – eine Frauendomäne
- 2.3 Ein-Eltern-Familien – die Folge zunehmender Scheidungszahlen
- 2.4 Ein-Eltern-Familien – mehrheitlich Ein-Kind-Familien
- 2.5 Die wirtschaftliche Lage Alleinerziehender (Väter)
- 2.5.1 Erwerbsbeteiligung
- 2.5.2 Überwiegender Lebensunterhalt
- 3. Rechte und Pflichten alleinerziehender Väter – die Kindschaftsrechtsreform
- 3.1 Die Regelung der elterlichen Sorge
- 3.2 Das Mitentscheidungsrecht der Mutter
- 3.3 Das Umgangsrecht der Mutter
- 3.4 Die Auskunftspflicht des Vaters
- 3.5 Unterhaltsansprüche
- 3.5.1 Kindesunterhalt
- 3.5.2 Der Anspruch des Vaters auf Unterhalt wegen Betreuung eines Kindes
- 3.5.3 Der Anspruch des Vaters auf Unterhaltsvorschussleistungen
- 4. Forschungsstand und Problemhintergrund
- 4.1 Ein Überblick über die Forschungssituation
- 4.2 Die neuen Väter
- 4.3 Die Lebenssituation alleinerziehender Väter
- Teil II: Der Familienalltag alleinerziehender Väter. Eine empirische Untersuchung zu Belastungserfahrungen und Bewältigungsressourcen – Forschungsergebnisse
- 5. Methodik
- 5.1 Wahl der Methode
- 5.2 Das Forschungsinteresse
- 5.3 Konstruktion des Interviewleitfadens
- 5.4 Auswahl der Stichprobe
- 5.5 Zugang zum Feld
- 5.6 Vorbereitung des Interviews
- 5.7 Durchführung der Datenerhebung
- 5.8 Schwierigkeiten bei der Datenerhebung
- 5.9 Resümee des Forschungsverlaufs
- 5.10 Die Stichprobe
- 5.10.1 Beschreibung der Stichprobe – Einzelvorstellung
- 5.10.2 Statistische Auswertung
- 5.11 Auswertungsverfahren
- 5.12 Schwierigkeiten bei der Auswertung
- 6. Schlüsselkonzept 1: Der Familienalltag nach der Geburt des Kindes/der Kinder vor der Trennung und/oder Scheidung der Partner
- 6.1 Das Arrangement des Alltags
- 6.1.1 Die Berufstätigkeit
- 6.1.2 Die familiäre Aufgabenteilung
- 6.1.3 Erziehung durch den Vater
- 6.2 Die Vater-Kind-Beziehung
- 6.3 Die Bedeutung des Vaterseins
- 6.4 Zusammenfassung
- 7. Schlüsselkonzept 2: Die Zeit der Trennung und der Entscheidungsprozess zur Übernahme der Rolle des alleinerziehenden Vaters
- 7.1 Die Zeit der Trennung
- 7.1.1 Initiative zur Trennung
- 7.1.2 Gedanken über die Nachtrennungs- bzw. Nachscheidungssituation
- 7.1.3 Die Entscheidung zum Alleinerziehen – Motive und entstandene Konflikte
- 7.2 Der Übergang zum Alleinerziehen
- 7.2.1 Herausforderungen und Veränderungen beim Übergang zur Ein-Elternschaft
- 7.2.2 Reaktionen des sozialen Umfelds
- 7.2.3 Hilfen beim Übergang zur Ein-Elternschaft
- 7.3 Zusammenfassung
- 8. Schlüsselkonzept 3: Die Neuorganisation der Familie und damit verbundene Belastungen
- 8.1 Die Ebene der eigenen Person
- 8.1.1 Gesundheit – physisches und psychisches Wohlbefinden
- 8.1.2 Vereinbarung von Beruf und Familie
- 8.1.3 Finanzielle Belastungen
- 8.1.4 Die Wohnsituation alleinerziehender Väter
- 8.1.5 Soziales Eingebundensein und Freizeitaktivitäten
- 8.1.6 Veränderung der Belastungen
- 8.2 Konfliktebene Vater – Mutter
- 8.2.1 Die Beziehung zur ehemaligen Partnerin
- 8.2.2 Auswirkungen der elterlichen Beziehungsqualität auf die Kinder
- 8.3 Die Ebene der Vater-Kind-Beziehung
- 8.3.1 Belastungen innerhalb der Vater-Kind-Beziehung
- 8.3.2 Beziehung zum bei der ehemaligen Partnerin verbliebenen Kind
- 8.3.3 Der väterliche Erziehungsstil
- 8.3.4 Überforderungssituationen bei der Erfüllung kindlicher Belange
- 8.4 Sonstige Belastungen
- 8.5 Zusammenfassung
- 9. Schlüsselkonzept 4: Eigene Stärken und Bewältigungshilfen im Alltag
- 9.1 Personale Ressourcen
- 9.2 Soziale Ressourcen
- 9.2.1 Private (informale) Unterstützung
- 9.2.1.1 Unterstützung durch die ehemalige Partnerin
- 9.2.1.2 Unterstützung durch die eigenen Kinder
- 9.2.1.3 Unterstützung durch das Familiensystem
- 9.2.1.4 Unterstützung durch Freunde
- 9.2.1.5 Unterstützung durch Nachbarn
- 9.2.1.6 Unterstützung am Arbeitsplatz
- 9.2.2 Institutionelle (formale) Unterstützung
- 9.2.2.1 Inanspruchnahme
- 9.2.2.2 Positive Erfahrungen besonders mit freien Trägern
- 9.2.2.3 Negative Erfahrungen mit kommunalen bzw. staatlichen Trägern
- 9.2.2.4 Wünsche und Anforderungen
- 9.2.3 Neue Unterstützungssysteme
- 9.2.4 Bewusste Nichtinanspruchnahme von Hilfe
- 9.3 Zusammenfassung
- 10. Schlüsselkonzept 5: Kritische Bilanz der Lebenssituation und Ausblick in die Zukunft
- 10.1 Bilanz
- 10.1.1 Mit der Lebenssituation einhergehende Verluste und Gewinne
- 10.1.2 Veränderte Ansichten bezüglich des Erziehungsverhaltens
- 10.1.3 Veränderung der Vater-Kind-Beziehung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Familienalltag alleinerziehender Väter, ihre Belastungserfahrungen und Bewältigungsressourcen. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Lebenssituation dieser Väter zu zeichnen und potentielle Herausforderungen und Stärken aufzuzeigen.
- Der Familienalltag vor und nach der Trennung
- Belastungsfaktoren im Alltag alleinerziehender Väter
- Bewältigungsstrategien und soziale Unterstützungssysteme
- Die Vater-Kind-Beziehung und deren Entwicklung
- Rechtliche Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I: Theoretische Grundlagen: Dieser Teil legt die theoretischen Grundlagen für die empirische Untersuchung. Er beleuchtet die Ein-Eltern-Familie als alternative Lebensform, analysiert deren Darstellung in amtlicher Statistik, beschreibt die rechtlichen Rahmenbedingungen für alleinerziehende Väter und gibt einen Überblick über den Forschungsstand zum Thema. Besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung der Familie als Institution, der quantitativen und qualitativen Bedeutung alleinerziehender Väter und der Herausforderungen des Umgangsrechts und Unterhaltsansprüchen.
Kapitel 6: Schlüsselkonzept 1: Der Familienalltag nach der Geburt des Kindes/der Kinder vor der Trennung und/oder Scheidung der Partner: Dieses Kapitel beschreibt den Alltag der Familien *vor* der Trennung. Es analysiert die Arbeitsteilung, die Rolle des Vaters in der Erziehung und die Vater-Kind-Beziehung in intakten Familien, um einen Vergleichsmaßstab für die Situation nach der Trennung zu schaffen. Die Berufstätigkeit und die Herausforderungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden genauso beleuchtet wie die Bedeutung des Vaterseins in dieser Phase.
Kapitel 7: Schlüsselkonzept 2: Die Zeit der Trennung und der Entscheidungsprozess zur Übernahme der Rolle des alleinerziehenden Vaters: Hier wird der Prozess der Trennung und die Entscheidung des Vaters, die alleinige Verantwortung für die Kinder zu übernehmen, detailliert untersucht. Die Kapitel analysiert die Motive hinter dieser Entscheidung, die Herausforderungen der Übergangsphase und die Reaktionen des sozialen Umfelds. Konflikte während der Trennung und die damit verbundenen emotionalen und praktischen Schwierigkeiten werden ebenso erörtert wie die Unterstützung, die die Väter in dieser Phase erhalten.
Kapitel 8: Schlüsselkonzept 3: Die Neuorganisation der Familie und damit verbundene Belastungen: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Belastungen, die mit der Neuorganisation des Familienalltags nach der Trennung einhergehen. Es betrachtet die Belastungen auf persönlicher Ebene (Gesundheit, Finanzen, Wohnsituation), die Konflikte mit der ehemaligen Partnerin und deren Auswirkungen auf die Kinder, sowie die Herausforderungen in der Vater-Kind-Beziehung. Die Kapitel beleuchtet verschiedene Belastungssituationen, wie z.B. finanzielle Engpässe oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Kapitel 9: Schlüsselkonzept 4: Eigene Stärken und Bewältigungshilfen im Alltag: Dieser Abschnitt widmet sich den Bewältigungsstrategien und Ressourcen alleinerziehender Väter. Es werden sowohl persönliche Stärken als auch soziale Unterstützungssysteme (formale und informelle Hilfe) untersucht. Die Kapitel beleuchtet die Rolle der ehemaligen Partnerin, des Familiensystems, von Freunden und institutioneller Unterstützung. Es analysiert positive und negative Erfahrungen mit verschiedenen Unterstützungssystemen und die bewusste Nichtinanspruchnahme von Hilfe.
Schlüsselwörter
Alleinerziehende Väter, Familienalltag, Belastung, Bewältigung, Ressourcen, Trennung, Scheidung, Vater-Kind-Beziehung, Erziehung, Kindschaftsrecht, soziale Unterstützung, Beruf, Familie, ökonomische Situation, empirische Untersuchung, qualitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Der Familienalltag alleinerziehender Väter
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Familienalltag alleinerziehender Väter, ihre Belastungserfahrungen und die Bewältigungsressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen. Ziel ist es, ein umfassendes Bild ihrer Lebenssituation zu zeichnen und Herausforderungen sowie Stärken aufzuzeigen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Familienalltag vor und nach der Trennung, Belastungsfaktoren im Alltag alleinerziehender Väter, Bewältigungsstrategien und soziale Unterstützungssysteme, die Vater-Kind-Beziehung und deren Entwicklung sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische, qualitative Forschungsmethode. Genaueres zur Methodik (z.B. Auswahl der Stichprobe, Interviewleitfaden, Auswertungsverfahren) findet sich in Kapitel 5.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert: Teil I befasst sich mit den theoretischen Grundlagen, inklusive der Ein-Eltern-Familie als Lebensform, amtlicher Statistik, Rechten und Pflichten alleinerziehender Väter und dem Forschungsstand. Teil II präsentiert die empirischen Ergebnisse der Untersuchung zum Familienalltag alleinerziehender Väter, gegliedert in Schlüsselkonzepte, die verschiedene Aspekte der Lebenssituation beleuchten (z.B. Familienalltag vor der Trennung, Trennungsprozess, Neuorganisation der Familie, Bewältigungshilfen, Bilanz und Ausblick).
Welche Schlüsselkonzepte werden in der empirischen Untersuchung behandelt?
Die empirische Untersuchung analysiert fünf Schlüsselkonzepte: 1. Der Familienalltag vor der Trennung; 2. Der Trennungsprozess und die Entscheidung zum Alleinerziehen; 3. Die Neuorganisation der Familie und damit verbundene Belastungen; 4. Eigene Stärken und Bewältigungsressourcen; 5. Kritische Bilanz der Lebenssituation und Ausblick in die Zukunft. Jedes Konzept wird in einem eigenen Kapitel ausführlich behandelt.
Welche Belastungen erfahren alleinerziehende Väter?
Die Arbeit identifiziert verschiedene Belastungsfaktoren, darunter finanzielle Engpässe, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Konflikte mit der ehemaligen Partnerin, Herausforderungen in der Vater-Kind-Beziehung und das fehlende soziale Umfeld. Die genauen Belastungen werden in Kapitel 8 detailliert beschrieben.
Welche Bewältigungsstrategien und Ressourcen nutzen alleinerziehende Väter?
Die Väter nutzen sowohl persönliche Stärken als auch soziale Unterstützungssysteme, um die Belastungen zu bewältigen. Hierzu gehören informelle Hilfen (z.B. durch Familie, Freunde) und formale Hilfen (z.B. staatliche und nichtstaatliche Institutionen). Kapitel 9 beschreibt diese Ressourcen ausführlich.
Welche Rolle spielt die Vater-Kind-Beziehung?
Die Vater-Kind-Beziehung ist ein zentraler Aspekt der Arbeit. Es wird untersucht, wie sich die Beziehung vor, während und nach der Trennung entwickelt und welche Herausforderungen und Stärken diese Beziehung prägen.
Welche rechtlichen Aspekte werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die rechtlichen Rahmenbedingungen für alleinerziehende Väter, insbesondere im Hinblick auf das Kindschaftsrecht, das Umgangsrecht und Unterhaltsansprüche. Dies wird im ersten Teil der Arbeit, besonders in Kapitel 3, erläutert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit liefert ein detailliertes Bild des Familienalltags alleinerziehender Väter, ihrer Belastungen und Ressourcen. Die Schlussfolgerungen werden in Kapitel 10 zusammengefasst und geben einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alleinerziehende Väter, Familienalltag, Belastung, Bewältigung, Ressourcen, Trennung, Scheidung, Vater-Kind-Beziehung, Erziehung, Kindschaftsrecht, soziale Unterstützung, Beruf, Familie, ökonomische Situation, empirische Untersuchung, qualitative Forschung.
- Quote paper
- Melanie Mattausch (Author), 2006, Der Familienalltag alleinerziehender Väter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280657