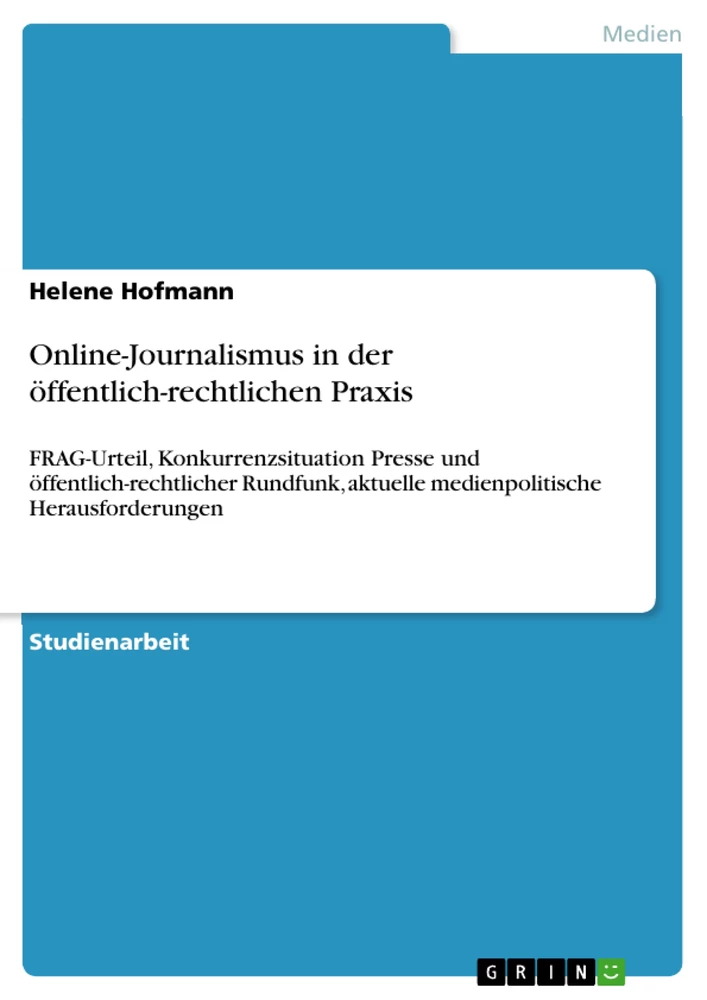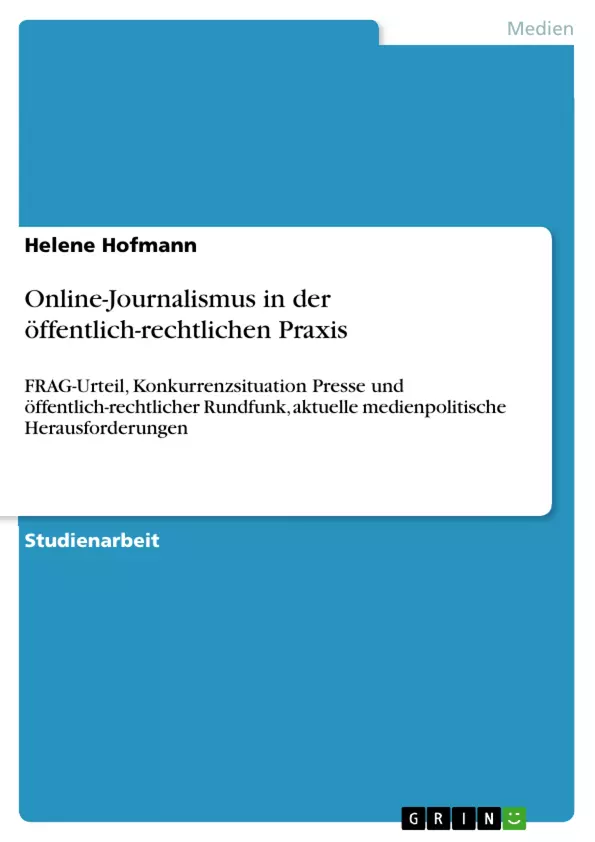Drei Abhandlungen zu historischen und aktuellen medienpolititsch relevanten Ereignissen und Entwicklungen. Betrachtet werden:
- Das FRAG-Urteil vor dem Hintergrund der Entwicklung des öffentlich- rechtlichen Rundfunks in der Bundesrepublik seit 1945: Rundfunksystem im Nachkriegsdeutschland. Bestrebungen zur Einführung des privaten Rundfunk seit 1945. Das FRAG-Urteil des Bundesverfassungsgerichts (1981). Folgen des Urteils.
- Konkurrenzsituationen zwischen Presse und öffentlich-rechtlichem Rundfunk: Situation in den 60er Jahren. Einsatz der Michel-Kommission. Situation in den 80er Jahren. Aktuelle Situation und Ausblick.
- Medienpolitische Herausforderungen zwischen 2002 und 2012 und kommunikationspolitische Standpunkte verschiedener Parteien: Das EU-rechtliche Beihilfeverfahren. Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunkfinanzierungsmodells. Medienpolitische Positionen verschiedener Parteien an zwei Beispielen (Urheberrecht im Internet, Rundfunkgebührenreform).
Inhaltsverzeichnis
- Das FRAG-Urteil vor dem Hintergrund der Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Bundesrepublik seit 1945
- Rundfunksystem im Nachkriegsdeutschland
- Bestrebungen zur Einführung des privaten Rundfunk seit 1945
- Das FRAG-Urteil des Bundesverfassungsgerichts (1981)
- Folgen des Urteils
- Konkurrenzsituationen zwischen Presse und öffentlich-rechtlichem Rundfunk
- Situation in den 60er Jahren
- Einsatz der Michel-Kommission
- Situation in den 80er Jahren
- Aktuelle Situation und Ausblick
- Medienpolitische Herausforderungen zwischen 2002 und 2012 und kommunikationspolitische Standpunkte verschiedener Parteien
- Das EU-rechtliche Beihilfeverfahren
- Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunkfinanzierungsmodells
- Medienpolitische Positionen verschiedener Parteien an zwei Beispielen
- Urheberrecht im Internet
- Rundfunkgebührenreform
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das „FRAG-Urteil“ des Bundesverfassungsgerichts von 1981 im Kontext der Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Bundesrepublik Deutschland seit 1945. Sie beleuchtet die historischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die zur Einführung des privaten Rundfunks führten, und untersucht die Folgen des Urteils für die Medienlandschaft.
- Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems in Deutschland
- Bestrebungen zur Einführung des privaten Rundfunks
- Das FRAG-Urteil und seine Bedeutung für die Medienfreiheit
- Konkurrenzsituationen zwischen Presse und Rundfunk
- Medienpolitische Herausforderungen und Standpunkte verschiedener Parteien
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Rundfunksystems in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Es beschreibt die Entscheidung der Alliierten für ein öffentlich-rechtliches Modell und die Herausforderungen, die mit der Einführung des privaten Rundfunks verbunden waren. Das Kapitel analysiert die verschiedenen Versuche, privaten Rundfunk in Deutschland zu etablieren, und die rechtlichen Rahmenbedingungen, die diese Versuche prägten.
Das zweite Kapitel untersucht die Konkurrenzsituationen zwischen Presse und öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Es analysiert die Debatte um das „Verlegerfernsehen“ in den 60er Jahren und die Rolle der Michel-Kommission. Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Medienlandschaft in den 80er Jahren und die aktuellen Herausforderungen, denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegenübersteht.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den medienpolitischen Herausforderungen zwischen 2002 und 2012. Es analysiert das EU-rechtliche Beihilfeverfahren und die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunkfinanzierungsmodells. Das Kapitel untersucht die medienpolitischen Positionen verschiedener Parteien zu Themen wie Urheberrecht im Internet und Rundfunkgebührenreform.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das FRAG-Urteil, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den privaten Rundfunk, die Medienfreiheit, die Meinungsvielfalt, die Rundfunkgebühren, die Medienpolitik und die Entwicklung der Medienlandschaft in Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was war das FRAG-Urteil von 1981?
Ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die rechtlichen Weichen für die Einführung des privaten Rundfunks in Deutschland stellte.
Warum gab es Konflikte zwischen der Presse und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Die Zeitungsverleger befürchteten durch die Expansion des Rundfunks (insbesondere online) eine Gefährdung ihres Geschäftsmodells und forderten Wettbewerbsgleichheit.
Was ist die Michel-Kommission?
Eine Kommission in den 60er Jahren, die eingesetzt wurde, um die Wettbewerbssituation zwischen Presse und Rundfunk zu untersuchen.
Wie hat sich das Rundfunkfinanzierungsmodell verändert?
Die Arbeit beleuchtet die Reform der Rundfunkgebühren hin zu einem haushaltsbezogenen Beitrag und die damit verbundenen politischen Debatten.
Welche Rolle spielt das EU-Beihilfeverfahren?
Es thematisiert die Vereinbarkeit der staatlichen Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit dem europäischen Wettbewerbsrecht.
- Quote paper
- B. A. Helene Hofmann (Author), 2012, Online-Journalismus in der öffentlich-rechtlichen Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281342