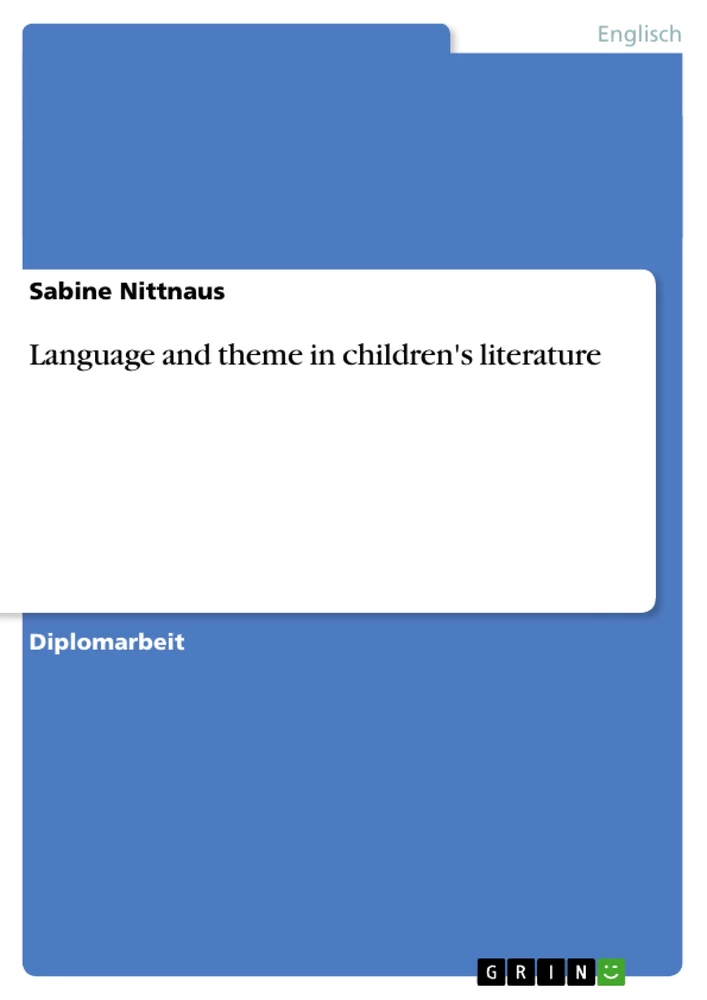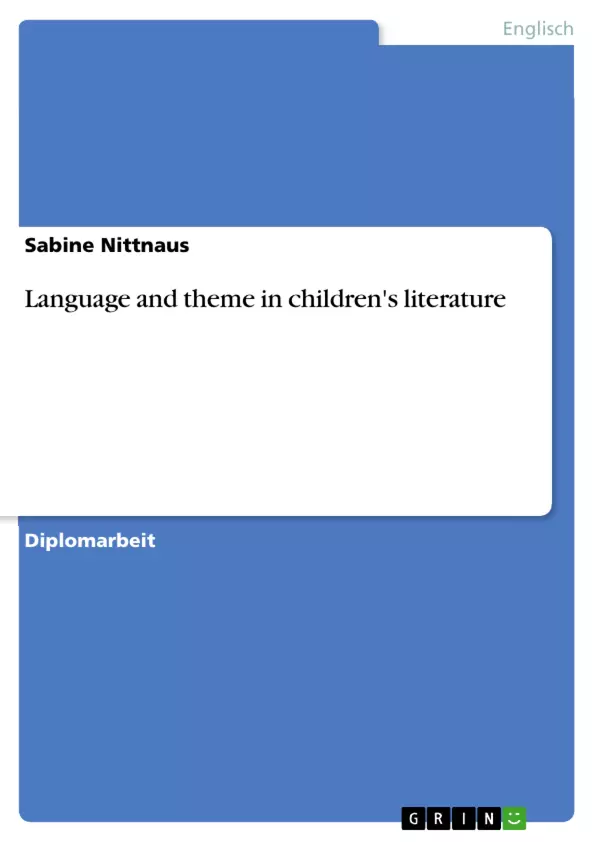I have never stopped loving children’s literature, and I have been interested in it as a field of research ever since I took a course on the history of children’s literature at the University of Toronto. When I started out on this paper I had little idea what it would be about, only that the focus would be on language. I knew I was fascinated by the subject so I started exploring the issue in general terms, reading more or less randomly about children’s literature, and reading children’s literature, before I decided on the structure of the paper and the texts I would use for it. My fascination for children’s literature is grounded in its potential for change and for development which is one of its major aspects. The fierce attempts to control children’s readings, adults’ prescriptions of what is good for them and what is not, have to do with this aspect of children’s literature which has always been considered dangerous by some adults, because there is nothing more powerful than the potency of the literary imagination. Fairy tales, which were viewed as suspicious for a long time, as the history of children’s literature shows, are a good example of this perceived threat.
The question of what children should read, how much freedom they should have to choose, which ultimately comes down to the question if they should be allowed to have an imagination or not, has had to do with changing notions of childhood, on which the emergence of imaginative literature for children depended, but to which it has contributed a lot in turn. The question really is if children’s natural liveliness, curiosity, and open-mindedness should be suppressed, if children should be frightened, and kept in their place, taught to accept everything unquestioningly, or be offered what they need to develop and grow at their own pace, and develop into critical, self-confident, open-minded adults. This issue goes beyond the scope of this paper, and the subject of children’s literature, but it more than touches on the debate and is reflected in it, as well as explaining the passion with which the question on what children should read or rather should not read has always been discussed. A good example of how these issues interrelate is the zeal of some American parents when it comes to banning books like ‘Huckleberry Finn’, which I will talk about in chapter 6.
Inhaltsverzeichnis
- 1 INTRODUCTION
- PART ONE
- 1 WHAT IS CHILDREN'S LITERATURE?
- 2 THE HISTORY OF CHILDREN'S LITERATURE: FROM ‘INSTRUCTION' TO 'DELIGHT'
- 3 THE SITUATION OF CHILDREN'S LITERATURE TODAY: ECONOMIC FACTORS AND SOCIAL CHANGES
- 4 CHILDREN'S LITERATURE AND MODERN MEDIA
- 5 THE EDUCATIONAL VALUE OF CHILDREN'S BOOKS: WHAT'S THE USE?
- 6 THE POLITICALLY CORRECT(ED) BOOK
- 7 WHAT SHOULD CHILDREN READ? WHAT SHOULD THEY NOT READ? QUESTIONS OF CENSORSHIP
- 8 IDEOLOGY
- 9 LANGUAGE AND IDEOLOGY: THE STUDY OF STYLE
- 10 SCHEMA THEORY
- 11 THE CHILD READER
- PART TWO
- 1 INTRODUCTION
- 2 'CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY'
- 3 'KELPIE': CHILDHOOD EXPERIENCE AS CHILDREN'S LITERATURE
- 4 COMPARISON
- 5 IN CONCLUSION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die komplexe Beziehung zwischen Sprache und Thema in der Kinderliteratur. Ziel ist es, den Einfluss sozialer und literarischer Kontexte auf die Produktion und Rezeption von Kinderbüchern zu beleuchten. Dabei wird die Schema-Theorie herangezogen, um die kognitiven Auswirkungen von Literatur auf junge Leser zu analysieren.
- Definition und Entwicklung der Kinderliteratur
- Der Einfluss von Ideologie und Zensur auf Kinderliteratur
- Die Rolle der Sprache und des Stils in der Kinderliteratur
- Anwendung der Schema-Theorie auf die Analyse von Kinderbüchern
- Empirische Untersuchung anhand ausgewählter Kinderbücher
Zusammenfassung der Kapitel
1 Introduction: Die Einleitung beschreibt die Faszination der Autorin für Kinderliteratur und deren Potential für Veränderung und Entwicklung. Sie thematisiert die kontroverse Debatte um die Auswahl geeigneter Lektüre für Kinder und den Einfluss der Vorstellungskraft. Die Autorin skizziert den Aufbau der Arbeit: einen theoretischen Teil, der sich mit dem sozialen und literarischen Kontext auseinandersetzt, und einen praktischen Teil mit der empirischen Analyse ausgewählter Texte im Hinblick auf Schema-Theorie und Ideologie.
1 What is children's literature?: Dieses Kapitel befasst sich mit der schwierigen Definition von "Kinderliteratur". Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, die sich auf die Zielgruppe (Autorenintention versus Leser), den Publikationskontext und die Art der Texte beziehen. Die Grenzen zwischen Kinder- und Erwachsenenliteratur werden als fließend dargestellt, und die Rolle des Verlagswesens bei der Klassifizierung wird hervorgehoben. Beispiele wie "Robinson Crusoe" und die "Harry Potter"-Bücher illustrieren die komplexen Aspekte der Kategorisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Analyse der Kinderliteratur
Was ist der allgemeine Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die komplexe Beziehung zwischen Sprache und Thema in der Kinderliteratur. Sie untersucht den Einfluss sozialer und literarischer Kontexte auf die Produktion und Rezeption von Kinderbüchern und nutzt die Schema-Theorie, um die kognitiven Auswirkungen von Literatur auf junge Leser zu analysieren.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Entwicklung der Kinderliteratur, den Einfluss von Ideologie und Zensur, die Rolle von Sprache und Stil, die Anwendung der Schema-Theorie auf die Analyse von Kinderbüchern und eine empirische Untersuchung anhand ausgewählter Kinderbücher (u.a. "Charlie und die Schokoladenfabrik" und "Kelpie").
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Teil eins behandelt theoretische Grundlagen wie die Definition von Kinderliteratur, deren Geschichte, den Einfluss moderner Medien, pädagogische Aspekte, Fragen der Zensur, Ideologie, Sprache, Stil und die Schema-Theorie. Teil zwei analysiert exemplarisch die Bücher "Charlie und die Schokoladenfabrik" und "Kelpie", vergleicht diese und zieht abschließende Schlussfolgerungen.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen (kurz)?
Die Arbeit enthält zahlreiche Kapitel, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der Kinderliteratur befassen. Kapitel 1 (Einführung) beschreibt die Motivation der Autorin und den Aufbau der Arbeit. Kapitel zu "Was ist Kinderliteratur?" diskutiert die Definitionsprobleme. Weitere Kapitel befassen sich mit der Geschichte der Kinderliteratur, ihrem heutigen Zustand, dem Einfluss der Medien, dem pädagogischen Wert, Zensur, Ideologie, Sprache und der Schema-Theorie. Teil zwei beinhaltet Kapitel zur Analyse von "Charlie und die Schokoladenfabrik", "Kelpie", einem Vergleich der beiden Werke und einer abschließenden Zusammenfassung.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Ansätze (z.B. Schema-Theorie) mit empirischer Analyse. Ausgewählte Kinderbücher werden im Hinblick auf ihre sprachliche Gestaltung, ihre Thematik und ihre Wirkung auf den jungen Leser untersucht.
Welche Bücher werden im empirischen Teil analysiert?
Im empirischen Teil werden "Charlie und die Schokoladenfabrik" und "Kelpie" analysiert und verglichen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, den Einfluss sozialer und literarischer Kontexte auf die Produktion und Rezeption von Kinderbüchern zu beleuchten und die kognitiven Auswirkungen von Literatur auf junge Leser mithilfe der Schema-Theorie zu analysieren.
- Citation du texte
- Sabine Nittnaus (Auteur), 2002, Language and theme in children's literature, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281480