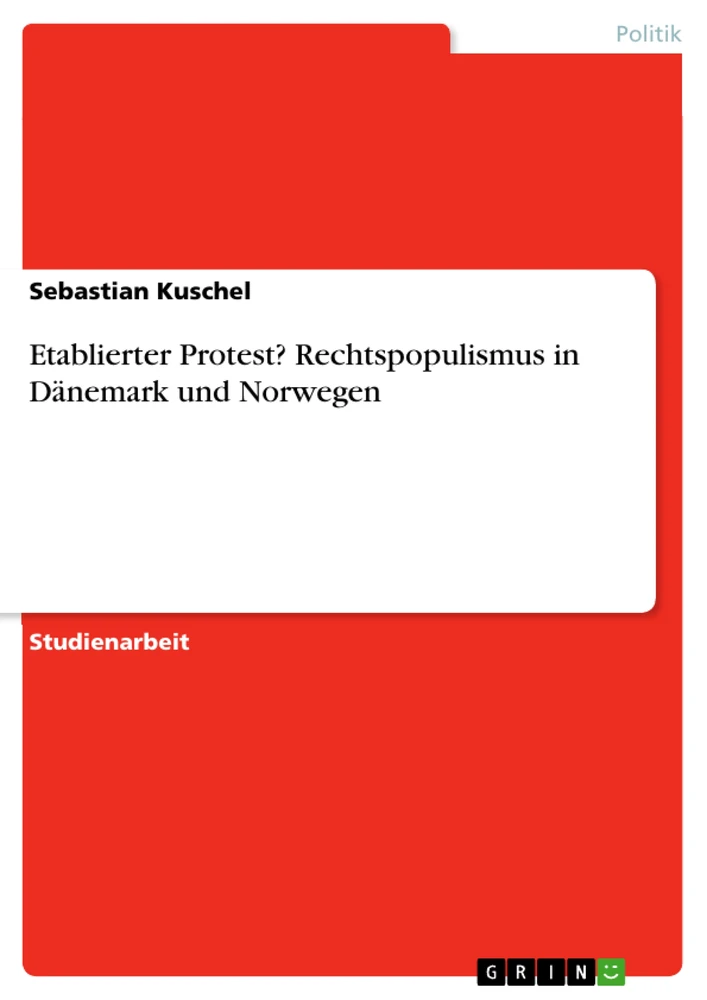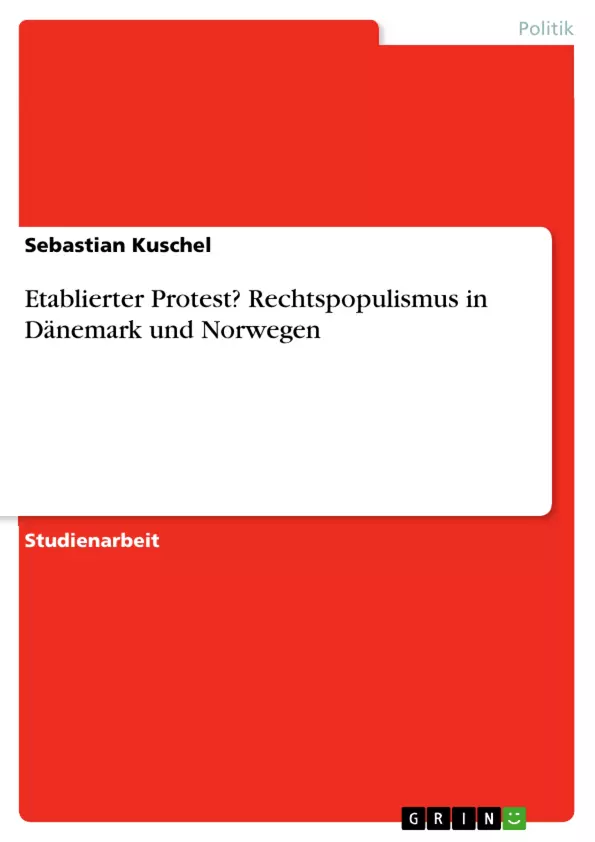Der Begriff des Populismus wird mittlerweile vor allem in der journalistischen Berichterstattung inflationär gebraucht, ohne dass es eine allgemeingültige Definition gäbe. In Europa und insbesondere in Deutschland, ist der Begriff vor allem negativ behaftet und wird oft auch als Kampfbegriff zur Delegitimierung politischer Gegner verwendet (vgl. Unger 2008: 77). Aber auch etablierten Parteien, bzw. einigen ihrer Politiker, wird immer häufiger der Vorwurf gemacht, dass sie populistisch agieren würden. In den USA und Russland ist ‚populism‘ eher positiv konnotiert und stand als ‚rural populism‘ (ländlich; bäuerlich) für eine Politik für Menschen in ländlichen Gegenden, die zumeist in der Landwirtschaft arbeiteten und sich gegen einen starken zentralen Staat und Industriekapitalisten wehren wollten (Unger 2008: 57ff; Hennessy 1969: 28ff).
Unterschiedlichste sozialwissenschaftliche Definitionen gibt es nur allzu reichlich und haben je nach Forschungsvorhaben sicherlich ihre Berechtigung. Die Grenzen zwischen populistischer Strategie, Form, Inhalt, Ideologie, Zielen, Diskursen, etc. und auch zwischen Rechtsextremismus bzw. Rechtspopulismus sind nur sehr schwer zu ziehen und bedürfen im folgenden Teil der Arbeit einer kurzen Analyse. Dabei sollen nicht die Schwächen unterschiedlicher Populismusbegriffe herausgearbeitet, sondern ein gemeinsamer Kern in den Vordergrund gestellt werden, der explizit auch zu den hier zu besprechenden Fällen in Norwegen und Dänemark passt. Als unstrittig soll dabei zunächst einmal gelten, dass beide Parteien - trotz möglicherweise anderer zu Grunde genommener Populismusbegriffe und theoretischer Analyse-Werkzeuge - in sozialwissenschaftlichen Arbeiten allgemein als „populistisch“ gelten; es wird also davon ausgegangen, dass der Begriff operabel ist und eine Daseinsberichtigung in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung besitzt.
Die Fälle der dänischen DVP und der norwegischen FP werden zunächst getrennt analysiert, um dann sowohl die augenscheinlichen Ähnlichkeiten als auch ihre Differenzen herauszuarbeiten, die sich auch aus den jeweiligen Kontexten ergeben. Ein kurzer Ausblick auf aktuelle und mögliche zukünftige Entwicklungen in Skandinavien soll die Arbeit beschließen und, wenn möglich, den vorgegebenen theoretischen Rahmen erweitern.
Inhaltsverzeichnis
- A Vom Protest zur Etablierung: Populisten in Skandinavien
- I. (Rechts-) Populismus: Annäherung an einen umstrittenen Begriff
- B Populismus in Skandinavien am Beispiel Dänemarks und Norwegens
- I. Die Dänische Volkspartei
- I.1 Die Geschichte der DVP
- I.2 Die politischen Kernforderungen der DVP
- I.3 Die Wählerschaft der DVP und ihr Einfluss auf das politische System
- I. 4 Zwischenfazit
- II. Die norwegische Fortschrittpspartei
- II.1 Die Geschichte der FP
- II.2 Die politischen Kernforderungen der FP
- II.3 Die FP in der Regierungsverantwortung
- II.4 Vom Populismus zum Establishment
- III. Die DVP und die FP: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- C Populismus in Skandinavien und Europa – Ein Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung rechtspopulistischer Parteien in Dänemark und Norwegen. Sie beleuchtet, wie diese Parteien aus Protestbewegungen entstanden sind und sich in der politischen Landschaft etablieren konnten. Dabei wird der Begriff des Populismus analysiert und im Kontext der skandinavischen Gesellschaften untersucht.
- Der Aufstieg rechtspopulistischer Parteien in Skandinavien.
- Die Rolle des Populismus in der skandinavischen Politik.
- Die Bedeutung von Kulturrassismus und Islamophobie in den Programmen der rechtspopulistischen Parteien.
- Der Einfluss der rechtspopulistischen Parteien auf das politische System.
- Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Dänischen Volkspartei und der norwegischen Fortschrittspartei.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Definition des Populismus und analysiert die vielfältigen Interpretationsansätze innerhalb der wissenschaftlichen Literatur. Es werden die zentralen Merkmale des Populismus herausgearbeitet und die Verbindung zu rechtspopulistischen Strömungen hergestellt.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Dänischen Volkspartei (DVP) und der norwegischen Fortschrittspartei (FP). Es wird die Geschichte beider Parteien beleuchtet und ihre zentralen Forderungen und Themenbereiche dargestellt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Aspekten von Kulturrassismus, Islamophobie und Euroskeptizismus. Die Rolle der Parteien in den jeweiligen politischen Systemen wird beleuchtet und der Einfluss auf die Wählerschaft und den Diskurs analysiert.
Im dritten Kapitel werden die DVP und die FP miteinander verglichen. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Parteien herausgearbeitet und die Ursachen für ihre jeweilige Entwicklung analysiert.
Das vierte Kapitel diskutiert den Einfluss des Rechtspopulismus auf die skandinavische Politik und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung. Es wird die Frage aufgeworfen, ob rechtspopulistische Parteien in Zukunft an Einfluss gewinnen oder sich im etablierten System integrieren werden.
Schlüsselwörter
Rechtspopulismus, Populismus, Kulturrassismus, Islamophobie, Xenophobie, Euroskeptizismus, Dänische Volkspartei (DVP), Fortschrittspartei (FP), Skandinavien, Dänemark, Norwegen, Wahlsystem, Parteiensystem, Medien, Politik, Demokratie, Wohlfahrtsstaat, Integration, Einwanderung, Identitätspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet den Rechtspopulismus in Skandinavien?
Er zeichnet sich durch Themen wie Euroskeptizismus, Kulturrassismus, Islamophobie und die Verteidigung des Wohlfahrtsstaates für die eigene Bevölkerung aus.
Was ist die Dänische Volkspartei (DVP)?
Die DVP ist eine rechtspopulistische Partei in Dänemark, die aus Protestbewegungen entstand und einen großen Einfluss auf die dänische Einwanderungspolitik hat.
Wie unterscheidet sich die norwegische Fortschrittspartei (FP)?
Die FP in Norwegen hat eine Entwicklung vom reinen Populismus hin zur Regierungsverantwortung und Etablierung im politischen System durchlaufen.
Was bedeutet „Kulturrassismus“ in diesem Kontext?
Es beschreibt die Ausgrenzung von Menschen aufgrund vermeintlich unüberbrückbarer kultureller Unterschiede, insbesondere im Hinblick auf den Islam.
Ist der Begriff Populismus wissenschaftlich eindeutig?
Nein, es gibt viele Definitionen. Die Arbeit fokussiert auf einen gemeinsamen Kern, der die Strategien und Inhalte der Parteien in Dänemark und Norwegen beschreibt.
- Citar trabajo
- Sebastian Kuschel (Autor), 2014, Etablierter Protest? Rechtspopulismus in Dänemark und Norwegen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281951