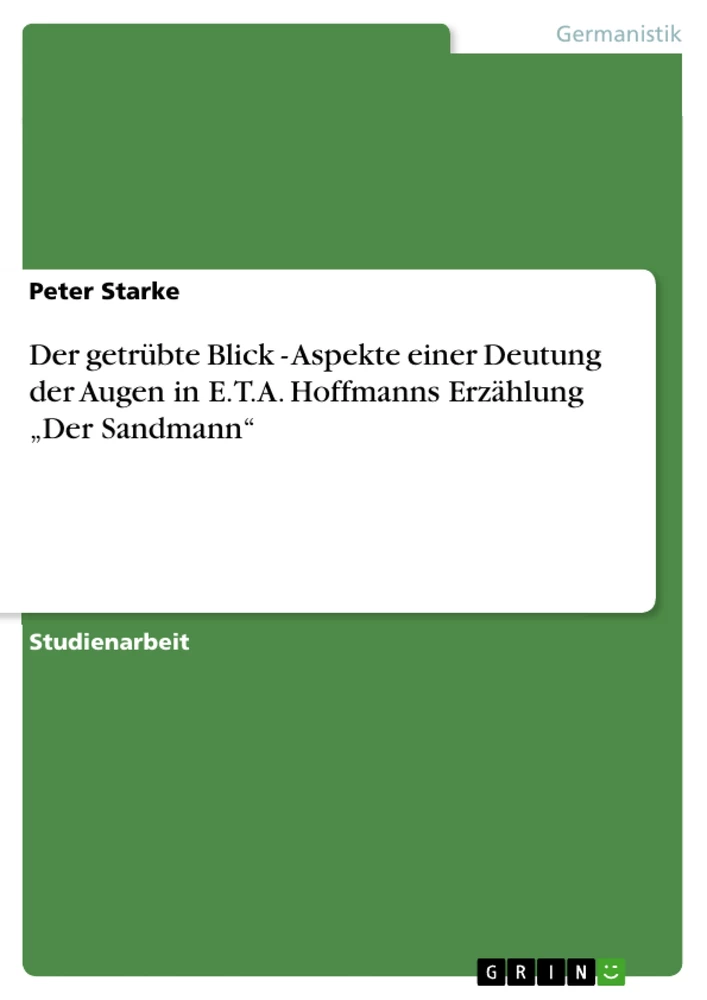Die Augen bilden das Leitmotiv von E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“ und werden „unter den Händen des Ich-Erzählers […] zum eigentlichen Subjekt der Erzählung, das für jede Handlungssequenz die Regie übernimmt.“ Mit ihnen spannt sich die Erzählung auf; von den „hellen Augen“ Claras bis zu Nathanaels „rollenden“ wird die Sandmann-Erzählung durch alltägliche und verfremdete Blicke, durch Perspektive und Brillen und durch projizierte Illusionen auf ihren Grundkonflikt gebracht, in dem das „ambivalente Verhältnis von imaginativ-phantastischer und alltäglicher Welt“ steht. Die Augen sind „Spiegel der inneren Welt“, ihr Verlust bedeutet Identitätsverlust, ihre Erhaltung Selbsterhaltung. In diesem Spannungsfeld bewegt sich Nathanael, dessen „verzweifelter Kampf um Selbstbestimmung“ auch immer ein Kampf um sein Augenpaar ist.
Diese Hausarbeit spannt folgenden Untersuchungsbereich auf: Das Motiv der Augen soll in seiner Vielschichtigkeit gedeutet werden, um zu erkennen, welchen äußeren Zwängen, inneren Fiktionen und Trugbildern Nathanael während seiner Kindheit und der Olimpia-Episode unterlag. Als zentrale Aspekte werden dabei (a) das Ammenmärchen und die Transformation des Sandmanns als Ursache für seine Verlustangst der Augen, (b) das Perspektiv als Medium einer projektiven Welt-Konstruktion und (c) die daraus resultierende „Verzauberung“ Nathanaels durch den Automaten Olimpia zu analysieren sein, um abschließend aufzeigen zu können, dass die Vernichtung Olimpias sowohl die Prognose des Ammenmärchens erfüllt, als auch die Vernichtung Nathanaels darstellt und gleichzeitig die Figurentransformation des Sandmanns abschließt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zwischen dem Sandmann und Coppelius: Der Angriff auf die Augen
- Das Ammenmärchen – Grundlage der Verlustangst
- Die Transformation des Sandmanns
- Der Angriff auf die Augen – Die Mechanisierung Nathanaels
- Zwischen Mensch und Maschine: Das Perspektiv
- Das Perspektiv – Ein Instrument der Vernunft?
- Der Aufbau einer Illusion: Nathanaels „Verzauberung“
- Ursachenforschung: Gründe für Nathanaels Unmündigkeit …
- Die Zerstörung einer Illusion: Die Vernichtung Olimpias.…........
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Bedeutung des Motivs der Augen in E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“. Sie untersucht, wie die Augen als Spiegel der inneren Welt Nathanaels fungieren und wie deren Verlust mit Identitätsverlust und deren Erhaltung mit Selbsterhaltung verbunden sind. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Ursachen für Nathanaels Unmündigkeit und seine „Verzauberung“ durch den Automaten Olimpia zu erforschen, indem sie die Rolle des Ammenmärchens, die Transformation des Sandmanns und die Funktion des Perspektivs analysiert.
- Das Ammenmärchen als Grundlage für Nathanaels Verlustangst der Augen
- Die Transformation des Sandmanns von einer phantastischen Figur zu einem realen und rationalen Über-Ich
- Das Perspektiv als Medium einer projektiven Welt-Konstruktion
- Die „Verzauberung“ Nathanaels durch den Automaten Olimpia
- Die Vernichtung Olimpias als Erfüllung der Prognose des Ammenmärchens und als Symbol für die Vernichtung Nathanaels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die zentrale These vor: Die Augen sind das Leitmotiv der Erzählung und stehen für Nathanaels Kampf um Selbstbestimmung. Die Arbeit untersucht die Vielschichtigkeit des Motivs der Augen, um zu verstehen, welchen äußeren Zwängen, inneren Fiktionen und Trugbildern Nathanael während seiner Kindheit und der Olimpia-Episode unterlag.
Das erste Kapitel analysiert das Ammenmärchen als Ausgangspunkt für Nathanaels Verlustangst der Augen. Das Märchen dient als Metapher für die gesellschaftliche Konvention, der Nathanael sich beugen muss, um „moralisch und sozial geheißen werden zu können“. Der Sandmann wird als Personifikation des Strafvollzugs und als Über-Ich dargestellt, das Nathanael zur Aufgabe seiner Triebsphäre zwingt.
Das zweite Kapitel untersucht die Transformation des Sandmanns von einer fremden, phantastischen Figur zu dem bekannten, realen und rationalen Advokaten Coppelius. Coppelius verkörpert das Über-Ich, das Nathanael nicht nur die Lust verbietet, sondern auch durch seine körperliche Präsenz die Einhaltung des Verbots erzwingt.
Das dritte Kapitel analysiert das Perspektiv als Medium einer projektiven Welt-Konstruktion. Nathanael konstruiert seine eigene Welt durch seine Brille und seine Perspektive, die ihm eine „Verzauberung“ durch den Automaten Olimpia ermöglicht. Die „Verzauberung“ ist jedoch eine Illusion, die durch die Vernichtung Olimpias zerstört wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen E.T.A. Hoffmann, „Der Sandmann“, Augen, Verlustangst, Ammenmärchen, Sandmann, Coppelius, Perspektiv, Illusion, Verzauberung, Olimpia, Über-Ich, Triebsphäre, Selbstbestimmung, Unmündigkeit, Vernichtung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat das Motiv der Augen in E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann"?
Die Augen fungieren als Leitmotiv und Spiegel der inneren Welt. Ihr Verlust symbolisiert Identitätsverlust, während ihre Erhaltung für Selbsterhaltung steht.
Wie beeinflusst das Ammenmärchen die Hauptfigur Nathanael?
Das Ammenmärchen bildet die Grundlage für Nathanaels tiefsitzende Verlustangst der Augen und prägt sein Trauma gegenüber der Figur des Sandmanns.
Was symbolisiert die Figur des Advokaten Coppelius?
Coppelius wird als Personifikation eines strafenden Über-Ichs gedeutet, das Nathanael zur Aufgabe seiner Triebsphäre und zur Unterwerfung unter gesellschaftliche Konventionen zwingt.
Welche Rolle spielt das "Perspektiv" in der Erzählung?
Das Perspektiv dient als Medium einer projektiven Welt-Konstruktion, durch die Nathanael seine Umwelt verzerrt wahrnimmt und sich in den Automaten Olimpia verliebt.
Was bedeutet die Vernichtung Olimpias für Nathanael?
Die Zerstörung Olimpias erfüllt die Prognose des Ammenmärchens und symbolisiert Nathanaels endgültigen psychischen Zusammenbruch und seine Vernichtung.
- Quote paper
- Peter Starke (Author), 2014, Der getrübte Blick - Aspekte einer Deutung der Augen in E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282392