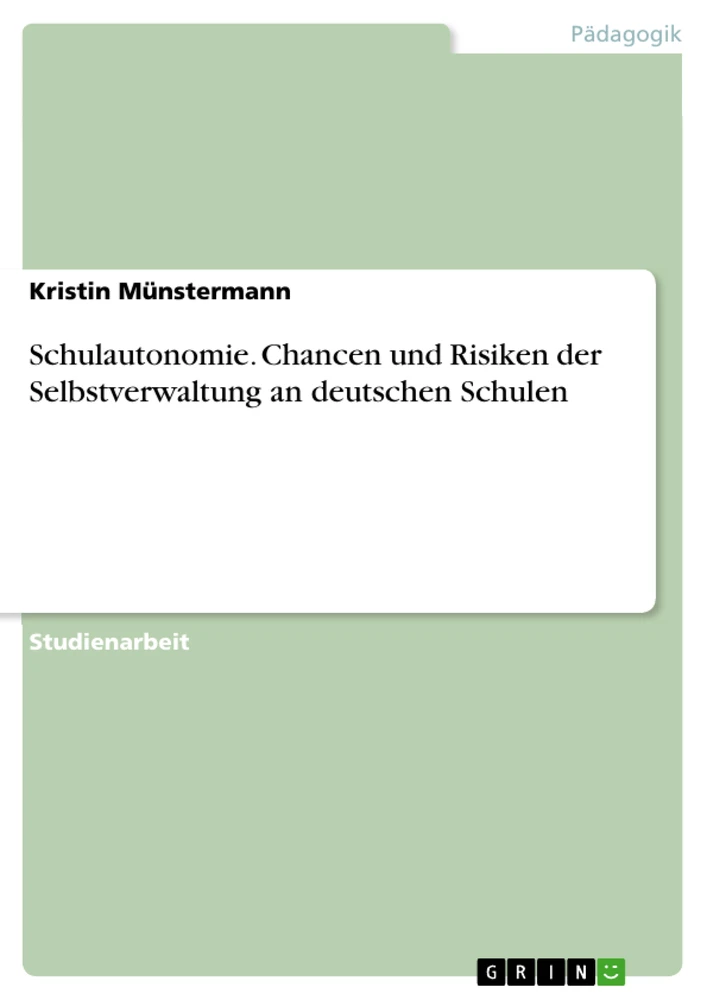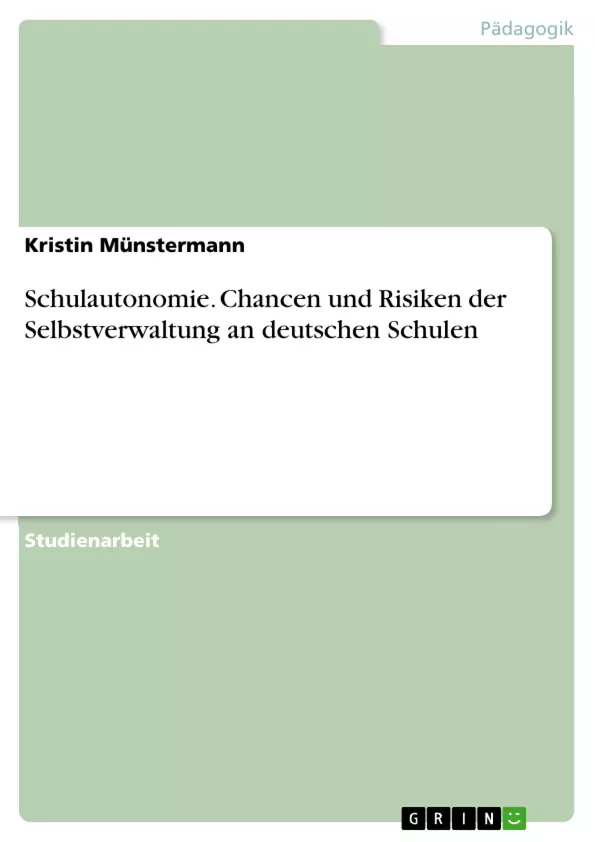Die Frage nach der Qualität von Schule und Unterricht ist ein Thema öffentlicher und wissenschaftlicher Diskussionen. In der bildungspolitischen Auseinandersetzung der 90er Jahre heißt eines der Stichworte „Schulautonomie“. Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse großer internationaler Leistungsvergleichs-Untersuchungen wurden in Deutschland wiederum bildungspolitische sowie bildungswissenschaftliche Kontroversen und Reformbemühungen angestoßen. Im Zuge dieser Diskussion haben auch Forderungen nach erweiterter Autonomie der Schulen erneut an öffentlicher Aufmerk-samkeit gewonnen. Schlagworte wie mehr Eigenständigkeit, Selbstständigkeit oder Selbstverantwortung im Hinblick auf die Einzelschule sind Ausdruck dieser Auseinan-dersetzungen. Zudem wurden in fast allen Bundesländern Schulversuche z.T. mit umfangreicher wissenschaftlicher Begleitforschung initiiert und durchgeführt. Sowohl im öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs wird Konzepten von Schulautonomie eine Relevanz für die Verbesserung der Qualität von Schule und Unterricht zugemessen. Im Rahmen dieser Hausarbeit soll danach gefragt werden, was unter Schulautonomie zu verstehen ist, und inwiefern Schulautonomie zur Verbesserung schulischer Qualität beitragen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schulautonomie und Schulentwicklung
- Zum Begriff der Schulautonomie
- Schulentwicklung als Entwicklung von Einzelschulen
- Die Autonomiedebatte
- Schulpädagogische Begründung
- Organisationspädagogische Begründung
- Problematisierungen
- Exkurs: Ganztagsschuldiskussion und Autonomiedebatte
- Konzepte und Praxis von Schulautonomie in Deutschland
- Modelle schulischer Selbstverwaltung in Europa
- Schulische Selbstverwaltung in den Niederlanden
- Schulische Selbstverwaltung in Schweden
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Konzept der Schulautonomie und untersucht dessen Relevanz für die Verbesserung der Qualität von Schule und Unterricht. Im Mittelpunkt steht die Frage, was unter Schulautonomie zu verstehen ist und inwieweit sie zur Verbesserung der Schulqualität beitragen kann.
- Der Begriff der Schulautonomie und seine verschiedenen Bedeutungen
- Die Rolle der Schulautonomie im Kontext der Schulentwicklung
- Schulpädagogische und organisationspädagogische Begründungen für Schulautonomie
- Probleme und Risiken, die mit einer erweiterten Autonomie von Schulen verbunden sind
- Konzepte und Praxis von Schulautonomie in Deutschland und Europa
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einleitung in die Thematik der Schulautonomie und stellt die zentralen Forschungsfragen der Hausarbeit vor. Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Schulautonomie geklärt und die Bedeutung von Schulautonomie im Kontext von Schulentwicklung herausgestellt. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Autonomiedebatte und beleuchtet sowohl die schulpädagogischen und organisationspädagogischen Begründungen für Schulautonomie als auch die damit verbundenen Probleme und Risiken. Ein kurzer Exkurs thematisiert die Beziehung zwischen der Autonomiedebatte und der Ganztagsschuldiskussion. Das vierte Kapitel gibt einen Überblick über Konzepte und Praxis von Schulautonomie in Deutschland. Schließlich werden im fünften Kapitel exemplarisch Modelle schulischer Selbstverwaltung in Europa vorgestellt, darunter das niederländische Schulsystem und das schwedische System.
Schlüsselwörter
Schulautonomie, Schulentwicklung, Schulqualität, Selbstverwaltung, Selbständigkeit, Schulprogrammarbeit, Schulprofil, Pädagogische Organisation, Personalmanagement, Ganztagsschule, Niederländisches Schulsystem, Schwedisches Schulsystem.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Schulautonomie?
Schulautonomie bezeichnet die erweiterte Eigenständigkeit und Selbstverantwortung der Einzelschule in pädagogischen, organisatorischen und personellen Fragen.
Kann Schulautonomie die Unterrichtsqualität verbessern?
Konzepten der Schulautonomie wird zugeschrieben, dass sie durch passgenaue Schulentwicklung vor Ort die Qualität von Lehre und Lernen steigern können.
Welche Risiken birgt die Selbstverwaltung von Schulen?
Risiken bestehen in einer möglichen Überlastung der Lehrkräfte, einer Entsolidarisierung zwischen Schulen und einer Zunahme bürokratischen Aufwands.
Wie handhaben andere europäische Länder die Schulautonomie?
In den Niederlanden und Schweden gibt es bereits weit fortgeschrittene Modelle der schulischen Selbstverwaltung, die als Vergleich dienen.
Welche Rolle spielt die Personalverwaltung in autonomen Schulen?
Autonome Schulen haben oft mehr Mitspracherecht bei der Auswahl ihres Personals, um ein spezifisches Schulprofil besser umzusetzen.
- Citar trabajo
- Kristin Münstermann (Autor), 2010, Schulautonomie. Chancen und Risiken der Selbstverwaltung an deutschen Schulen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282533