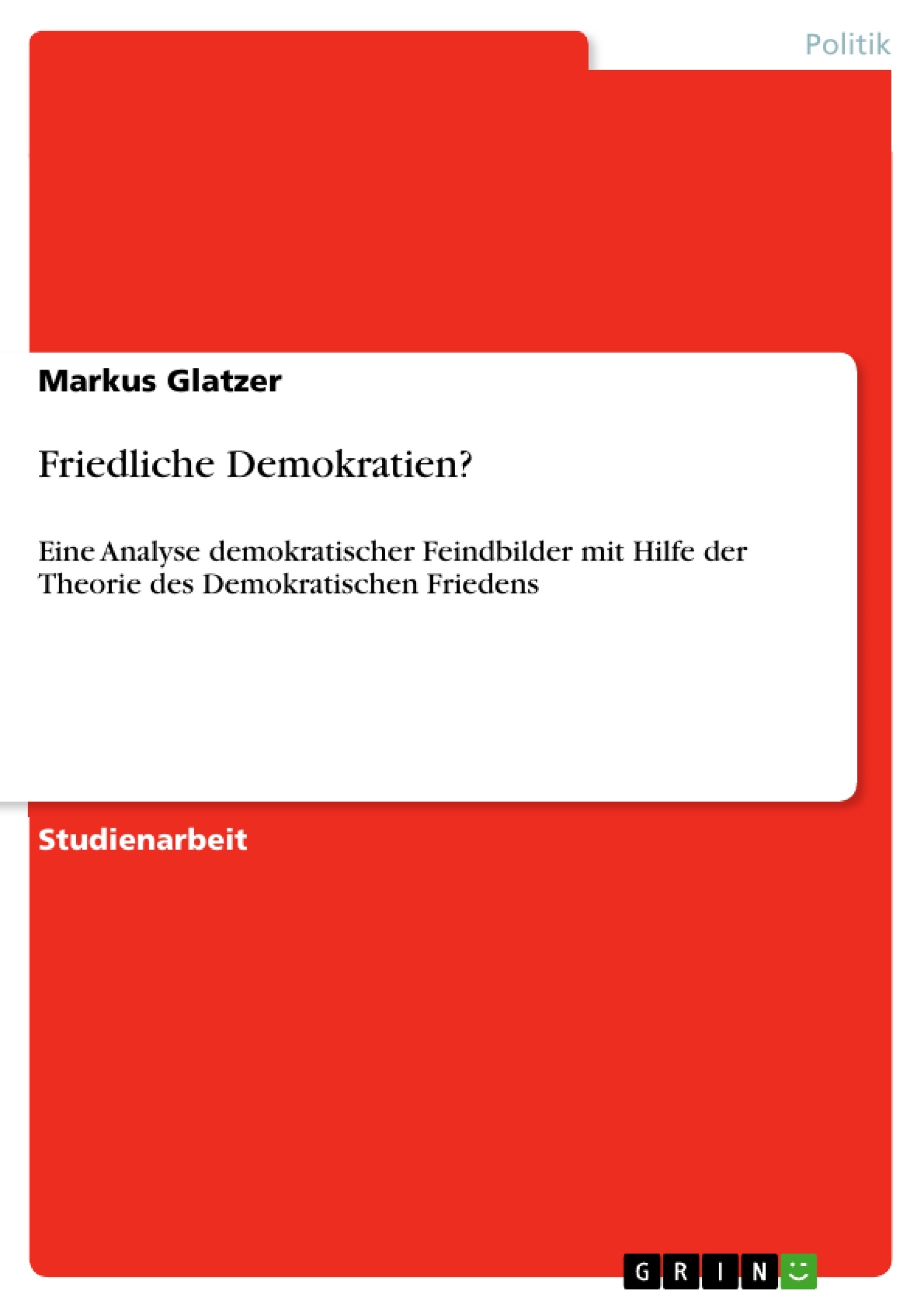“Jede uns bekannte moderne Gesellschaft trägt ein signifikantes Maß an Gewaltpotential in sich, auch die Demokratie“. Dieser Annahme folgend, scheint die Theorie des Demokratischen Friedens erst einmal fraglich. Deshalb ist es innerhalb der Theorie zu einer Differenzierung gekommen, in dem sich zwei Stränge herausgebildet haben. Zu hinterfragen ist an dieser Stelle, wie es dazu kommt, dass Demokratien eine nicht friedliche Außenpolitik gegenüber anderen Staaten etablieren können. Denn in einer grundbereitenden Schrift der Theorie des Demokratischen Friedens, Immanuel Kants „Zum ewigen Frieden“ finden sich, auf den ersten Blick, scheinbar gegensätzliche Annahmen. Er schreibt dort: Sind die Bürger einer Republik in der Lage über „die Drangsale des Krieges“ selbst zu entscheiden, so werden sie „sich sehr bedenken (...), ein so schlimmes Spiel anzufangen (...)“. Und dies aus zum großen Teil ökonomischen Gründen (Kosten des Krieges aus eigener Habe, Verwüstung und die Bedrohung durch immer neu entfachende Kriege...). Daraus würde folgen, dass ein demokratischer Staat, indem die Bürger durch freie Wahlen über Ihre Repräsentanten und damit auch über die Grundeinstellung zu kriegerischen Auseinandersetzungen entscheiden können tendenziell eher zu friedlichem Verhalten, als zu kriegerischen Auseinandersetzungen neigen müsste. Diese normativen Argumente lassen sich empirisch jedoch nicht ohne Weiteres erkennen. Eher scheint das Gegenteil der Fall zu sein, indem Demokratien zahlreiche militärische Konflikte auch auf der Ebene von Kriegen austragen.
In Anlehnung an Kant muss also ein demokratisch organisierter Staat, besonders in einem heutigen wirtschaftlich wie politisch interdependenten und verrechtlichten internationalen System, eine nicht friedliche Außenpolitik mit besonderem Aufwand begründen und gegenüber „seinem“ Staatsvolk erklären, warum diese notwendig sein soll. Theoretisch hat Harald Müller (unter Anderen) versucht, dieses Phänomen zu erklären. Er prägte dafür die Begrifflichkeit der „Antinomie des Demokratischen Friedens“. Er will damit auf den Umstand verweisen, dass der demokratische Frieden nur in Verbindung mit dem demokratischen Krieg umfassend zur Erklärung des internationalen Systems beitragen kann. (...)
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG UND VORÜBERLEGUNG
- 2. DIE THEORIE DES DEMOKRATISCHEN FRIEDENS
- 3. DIE FRIEDFERTIGKEIT VON DEMOKRATIEN
- 3.1 Pluralität und größtmögliche Mitbestimmung
- 3.2 Höchste Interdependenz auf internationaler Ebene
- 3.3 Pazifistische Einstellung
- 4. DIE AGGRESSIVITÄT VON NICHT-DEMOKRATIEN: DER IRAK VOR DER INVASION
- 4.1 Engstirnige Diktatur ohne aufgeklärte Bürger
- 4.2 Internationale Isolation und Unterstützung Terrorismus
- 4.3 Kriegsaffirmative Einstellung
- 5. SCHLUSSBEMERKUNGEN: „SCHURKENSTAAT“ VS. IDEALE DEMOKRATIE?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Theorie des Demokratischen Friedens im Kontext des Irakkrieges 2003. Ziel ist es, zu untersuchen, wie demokratische Staaten nicht-friedliche Außenpolitik gegenüber anderen Staaten begründen können, insbesondere angesichts der vermeintlichen Friedfertigkeit von Demokratien. Der Fokus liegt dabei auf der Konstruktion von Feindbildern und deren Rolle bei der Rechtfertigung von kriegerischem Handeln.
- Die Theorie des Demokratischen Friedens: Der dyadische und monadische Ansatz
- Die Friedfertigkeit von Demokratien: Pluralismus, Interdependenz und pazifistische Einstellung
- Die Aggressivität von Nicht-Demokratien: Engstirnige Diktaturen, internationale Isolation und Kriegsbefürwortung
- Feindbilder und die Rechtfertigung von demokratischen Kriegen
- Der Irakkrieg als Fallbeispiel: Die Rhetorik der US-Regierung und die Konstruktion des "Schurkenstaates" Irak
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die theoretische Grundlage der Arbeit dar und beleuchtet die Problematik des Demokratischen Friedens. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Theorie des Demokratischen Friedens und deren zwei Hauptströmungen: dem dyadischen und dem monadischen Ansatz. Kapitel 3 analysiert die Friedfertigkeit von Demokratien, indem es auf die drei wichtigsten Faktoren - Pluralismus, Interdependenz und pazifistische Einstellung - eingeht. Kapitel 4 hingegen befasst sich mit der Aggressivität von Nicht-Demokratien am Beispiel des Irak vor der Invasion. Dabei werden die Faktoren Engstirnigkeit, internationale Isolation und Kriegsbefürwortung untersucht.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Demokratischer Frieden, dyadischer Ansatz, monadischer Ansatz, Feindbild, "Schurkenstaat", Irak, Irakkrieg, US-Außenpolitik, Friedfertigkeit, Aggressivität, Interdependenz, Pluralismus, Kriegsbefürwortung.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Theorie des Demokratischen Friedens?
Sie geht davon aus, dass Demokratien untereinander keine Kriege führen. Umstritten bleibt jedoch, ob Demokratien generell friedlicher sind (monadischer Ansatz) oder nur im Umgang mit anderen Demokratien (dyadischer Ansatz).
Was meint Harald Müller mit der „Antinomie des Demokratischen Friedens“?
Er verweist darauf, dass Demokratien zwar untereinander friedlich sind, aber gleichzeitig sehr aggressiv gegenüber Nicht-Demokratien auftreten können, oft begründet durch die Verteidigung demokratischer Werte.
Wie wurde der Irakkrieg 2003 im Kontext dieser Theorie begründet?
Die US-Regierung nutzte die Konstruktion eines „Feindbildes“ (Schurkenstaat), um die Invasion als notwendigen Akt zur Beseitigung einer Gefahr für den Frieden und zur Demokratisierung darzustellen.
Welche Rolle spielt Immanuel Kant für diese Theorie?
In seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ argumentierte Kant, dass Bürger in einer Republik gegen Kriege stimmen würden, da sie die Kosten und Lasten selbst tragen müssten.
Warum führen Demokratien dennoch Kriege?
Die Arbeit zeigt auf, dass Demokratien Kriege oft durch die Abwertung des Gegners als „nicht-demokratisch“ oder „aggressiv“ gegenüber dem eigenen Volk rechtfertigen müssen.
- Citation du texte
- Markus Glatzer (Auteur), 2014, Friedliche Demokratien?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282743