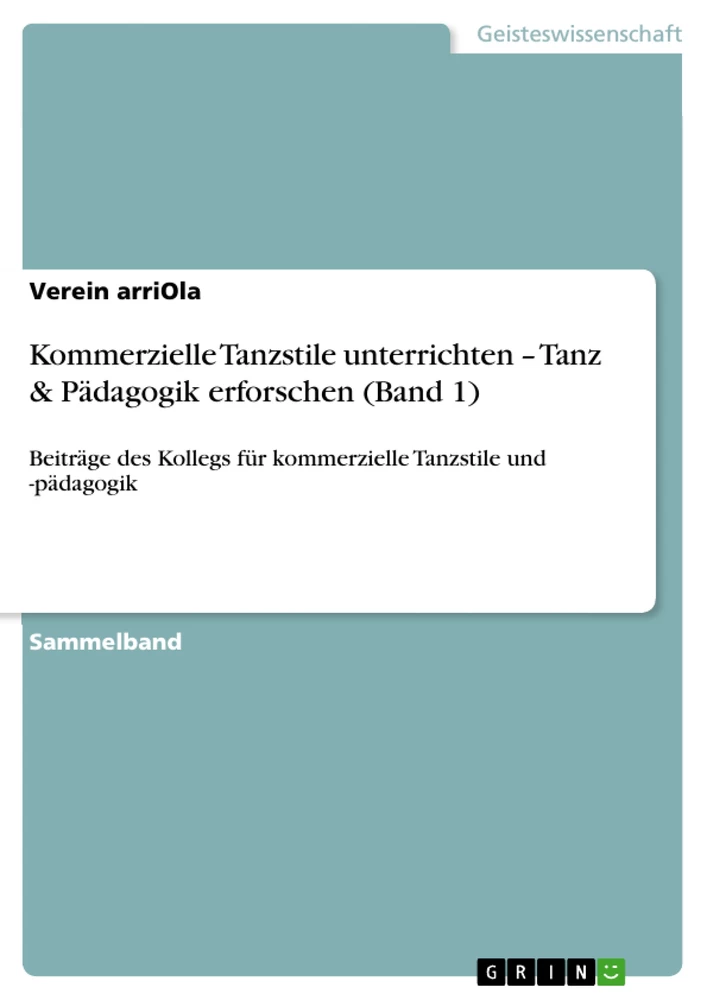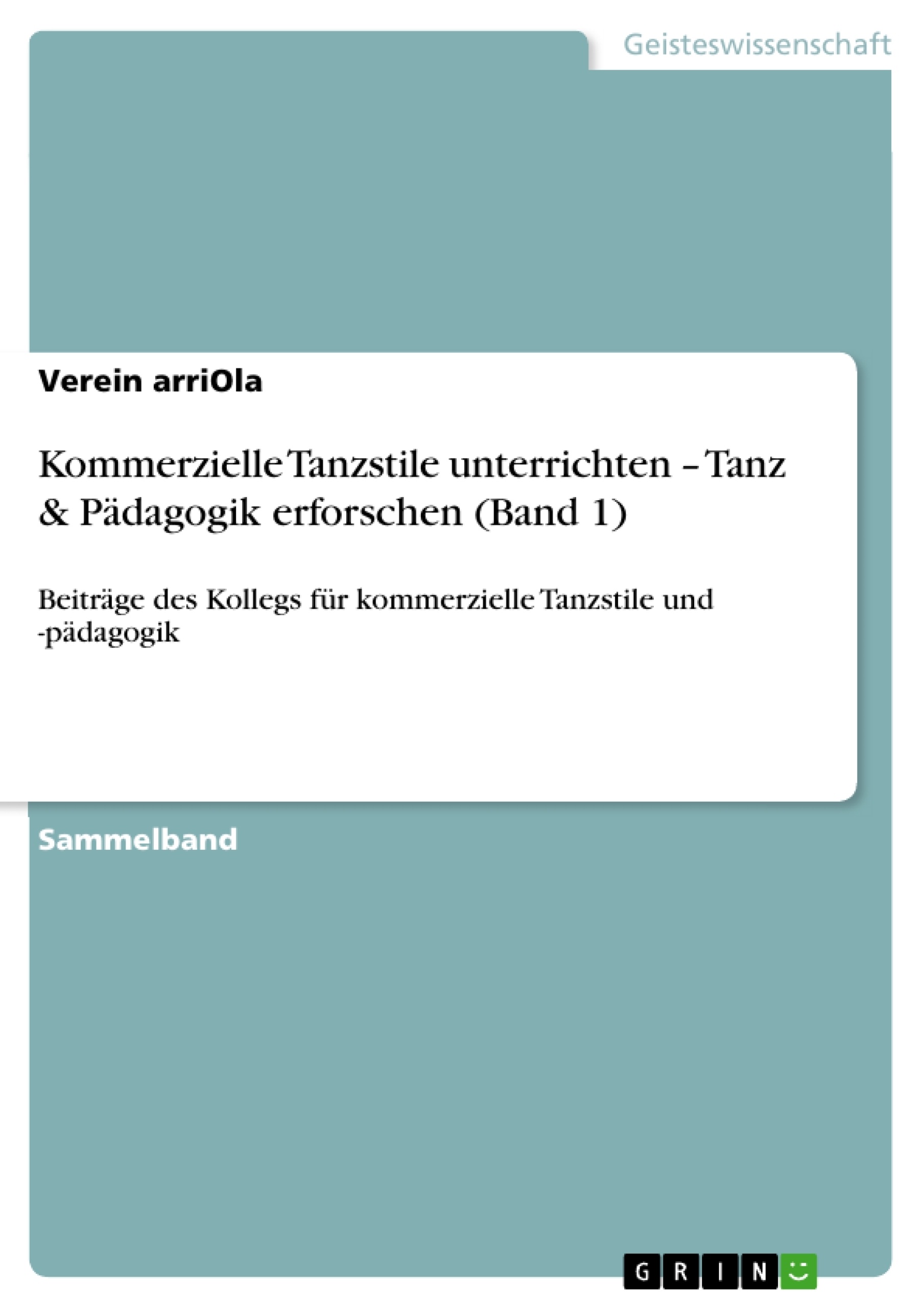Lange galten kommerzielle Tanzstile als „Stiefkind“ in der Tanzwelt: Als Kunstform wurden sie nicht ernst genommen, für die pädagogische Arbeit waren sie nicht wertvoll genug, fundierte Studien oder Literatur waren schwer zu finden.
Trotz all dieser Umstände konnten sich Hip-Hop, Jazzdance, Videoclip Dance, Streetdance und Co. in der tanzpädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahrzehnten rasant etablieren und die Nachfrage nach diesen Stilen hat im Freizeitbereich längst die klassischen und zeitgenössischen Stile überholt.
Die Gründe für diesen Vormarsch sind vielseitig.
Einer davon könnten etwa die Freiräume sein, die kommerzielle Stile bieten. Denn im Vergleich zur klassischen Tanztechnik sind die (noch viel jüngeren) kommerziellen Stile keine in sich geschlossenen Techniken, sondern lassen nach wie vor Weiterentwicklungen zu.
Anders ausgedrückt: Im klassischen Ballett können Menschen, die nicht jahrelang dafür ausgebildet wurden, wohl kaum einfach eine Choreographie „erfinden“ – im Videoclip Dancing schon. Ganz im Gegenteil. Aus körperlichen und tänzerischen Unvollkommenheiten oder Voraussetzungen, die nicht der tänzerischen Norm entsprechen, ergeben sich gar oft spezielle Trends wie etwa „Tutting“ oder „Krumping“.
Dadurch ermöglichen kommerzielle Tanzstile auch „Nicht-Tänzer/innen“ bald Erfolgserlebnisse und Möglichkeiten sich auszudrücken und eignen sich damit ideal für die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Hinzu kommt, dass gerade die rhythmische und sehr übersichtlich strukturierte kommerzielle Musik (im Vergleich zu klassischen oder zeitgenössischen Kompositionen) jungen Menschen mehr Sicherheit bietet, um sich Bewegungen hinzugeben.
Der Vorteil, der durch die Aktualität dieser Stile geboten wird, ist jedoch auch eine große Herausforderung für Menschen, die sich nicht (mehr) ständig mit den tänzerischen Entwicklungen beschäftigen. Denn während sich urbane Tanzstile langsam von der Jugendsubkultur zu Hochkultur „mausern“ konnten und ihren Einzug in Theaterhäuser feiern, ist Literatur über ihre Hintergründe und Möglichkeiten der Aufbereitung nach wie vor nur mangelhaft vorhanden.
Die in diesem Sammelband veröffentlichten Arbeiten stammen alle von Absolventen des Kolleg-Abschlussjahrgangs 2014. Die Vielfältigkeit der Arbeiten spiegelt die breit gefächerten Interessen und Schwerpunkte der Absolventen wider.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort des Vereins arriOla
- CHARLOTTE AICHHORN
- Tanz dich Schlau! Tanz im interdisziplinären Kontext mit Neurowissenschaft und anderen Bildungsbereichen
- Einleitung
- Der Tanz
- Was ist Tanz?
- Kreativer Kindertanz
- Die Bedeutung des Tanzens in verschiedenen Bildungsbereichen
- Tanz, Kreativität und Emotionen
- Musik und Rhythmus
- Musik aus lernpsychologischer Sicht
- Hören, musizieren und erleben im neuronalen Netzwerk
- Tanzpädagogik – erfolgreich lernen und lehren
- Bewegung fördert Lernprozesse im Gehirn
- Tanz als kognitive Tätigkeit
- Gedächtnisformen
- Das Kurz- und Langzeitgedächtnis
- Explizites und implizites Gedächtnis
- Motorisches und vorstellendes Gedächtnis
- Das menschliche Gehirn
- Neuroplastizität
- Aufbau
- Der Hirnstamm
- Das Großhirn
- Das Kleinhirn
- Das limbische System
- Das Zentralnervensystem
- Neuronen und Synapsen
- Motoneuronen
- Motorische Kontrollsysteme
- Lernen durch Spiegelneuronen
- Die Integration der Sinne und das Gehirn
- Lernen mit allen Sinnen
- Die Wahrnehmung
- Taktile Wahrnehmung
- Kinästhetische Wahrnehmung
- Vestibuläre Wahrnehmung
- Visuelle und auditive Wahrnehmung
- Gustatorische und olfaktorische Wahrnehmung
- Raumvorstellung
- Neuronale Entwicklungsprozesse durch sensorische Erfahrung
- Sinnesschulung durch Tanz
- Schlusswort
- ISABELL SCHIFFER
- Bewegungserziehung im Kindergarten
- Einleitung
- Was ist Bewegung?
- Definition/Begriffserklärung
- Die unterschiedlichen Bereiche innerhalb der Motorik
- Die motorische Entwicklung und die Entwicklung von Bewegungsabläufen von 0-6jährigen Kindern
- Die motorische Verhaltensentwicklung des Fötus
- Die motorische Verhaltensentwicklung des Neugeborenen
- Angeborene Reflexe
- Zufällige, ungerichtete Bewegungen (Strampeln)
- Zielstrebige, gerichtete Bewegungen
- Die motorische Entwicklung im ersten Lebensjahr
- Die motorische Entwicklung im Kleinkindalter – ein bis drei Jahre
- Die motorische Entwicklung vom vierten bis zum sechsten Lebensjahr
- Der Bildungsbereich „Bewegung“
- Bewegung als ein zentraler Bildungsbereich
- Begründung des Bildungsbereich „Bewegung“ im Rahmen frühkindlicher Bildungsprozesse
- Wie Kinder lernen
- Die Welt durch Bewegung erfahren
- Lernen mit allen Sinnen
- Lernen braucht Bewegung
- Die Bedeutung der Bewegung für die kindliche Entwicklung
- Bewegung als Erfahrung der dinglichen Umwelt
- Bewegung als Erfahrung des Selbst
- Bewegung als Erfahrung der sozialen Umwelt
- Die Funktionen der Bewegung für Kinder
- Bewegungsmangel
- Reizüberflutung und Bewegungsarmut
- Die Folgen von Bewegungsmangel
- Bewegungserziehung im Kindergarten
- Die Ziele der Bewegungserziehung
- Die Inhalte der Bewegungserziehung
- Vermittlungsmethoden
- Bewegung im Kindergarten
- Aufgaben der/des Pädagogin
- Kindern Raum für Bewegung im Kindergarten geben
- Beispiele für eine Bewegungseinheit
- Schlusswort
- LISA MARIELLE NEUNER
- Selbstachtung durch Tanz. Kreativer Kindertanz, dessen Methoden und deren positive Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung
- Einleitung
- Kreativer Kindertanz
- Stärkung der Selbstwahrnehmung und Selbstwertschätzung durch Tanz
- Emotions in motion – Tanz als Medium zum Ausdruck innerster Empfindungen
- Tanz als Möglichkeit eines individuellen und normfreien Kennenlernens des eigenen Körpers
- Selbstachtung durch Tanz. Kreativer Kindertanz, dessen Methoden und deren positive Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Sammelband „Beiträge des Kollegs für kommerzielle Tanzstile und -pädagogik“ präsentiert Abschlussarbeiten aus dem Jahr 2014 und bietet Einblicke in die vielseitigen Facetten des Tanzes und seiner pädagogischen Anwendung.
- Interdisziplinäre Verknüpfung von Tanz mit Neurowissenschaften und anderen Bildungsbereichen
- Die Bedeutung von Bewegung und Tanz für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Kreativer Kindertanz als Mittel zur Förderung von Selbstwahrnehmung, Selbstwertschätzung und emotionaler Intelligenz
- Der Einfluss von Musik und Rhythmus auf Lernprozesse und neuronale Entwicklung
- Bewegungserziehung im Kindergarten und die Bedeutung von Bewegung für die kindliche Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Beitrag von Charlotte Aichhorn untersucht die Verbindung zwischen Tanz, Neurowissenschaften und anderen Bildungsbereichen. Die Autorin beleuchtet die Bedeutung von Tanz für die kognitive Entwicklung und die Förderung von Kreativität, Emotionen und Lernprozessen. Sie betrachtet die Rolle von Musik und Rhythmus im neuronalen Netzwerk und analysiert verschiedene Gedächtnisformen im Kontext von Tanz.
Im zweiten Beitrag befasst sich Isabell Schiffer mit Bewegungserziehung im Kindergarten. Sie beleuchtet die motorische Entwicklung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren und die Bedeutung von Bewegung für die kindliche Entwicklung. Schiffer unterstreicht die Notwendigkeit von Bewegungserziehung im Kindergarten und erläutert die Ziele, Inhalte und Vermittlungsmethoden.
Lisa Marielle Neuner widmet sich im dritten Beitrag dem Thema Selbstachtung durch Tanz. Sie untersucht die positiven Auswirkungen von kreativem Kindertanz auf die Persönlichkeitsentwicklung und die Förderung von Selbstwahrnehmung und Selbstwertschätzung.
Schlüsselwörter
Kommerzielle Tanzstile, Tanzpädagogik, Neurowissenschaften, Kreativer Kindertanz, Bewegungserziehung, Selbstwahrnehmung, Selbstwertschätzung, Motorische Entwicklung, Lernen mit allen Sinnen, Emotionale Intelligenz, Musik und Rhythmus, Neuronale Entwicklung, Bildungsprozesse im Kindergarten.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter kommerziellen Tanzstilen?
Dazu zählen Stile wie Hip-Hop, Jazzdance, Videoclip Dance und Streetdance, die oft in Musikvideos und dem Freizeitbereich präsent sind.
Wie hängen Tanz und Neurowissenschaften zusammen?
Tanz fördert die Neuroplastizität und aktiviert verschiedene Gedächtnisformen sowie Spiegelneuronen im Gehirn.
Warum eignet sich kreativer Kindertanz für die Persönlichkeitsentwicklung?
Er bietet einen normfreien Raum, um den eigenen Körper kennenzulernen und stärkt die Selbstwahrnehmung sowie die emotionale Intelligenz.
Welche motorische Entwicklung durchlaufen Kinder bis 6 Jahre?
Die Arbeit beschreibt die Phasen von angeborenen Reflexen des Neugeborenen bis hin zu zielstrebigen Bewegungsabläufen im Kleinkindalter.
Welche Folgen hat Bewegungsmangel bei Kindern?
Bewegungsmangel kann zu Reizüberflutung, motorischen Defiziten und einer eingeschränkten Erfahrung der Umwelt führen.
- Bewegungserziehung im Kindergarten
- Tanz dich Schlau! Tanz im interdisziplinären Kontext mit Neurowissenschaft und anderen Bildungsbereichen
- Citar trabajo
- Verein arriOla (Autor), 2014, Kommerzielle Tanzstile unterrichten – Tanz & Pädagogik erforschen (Band 1), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282750