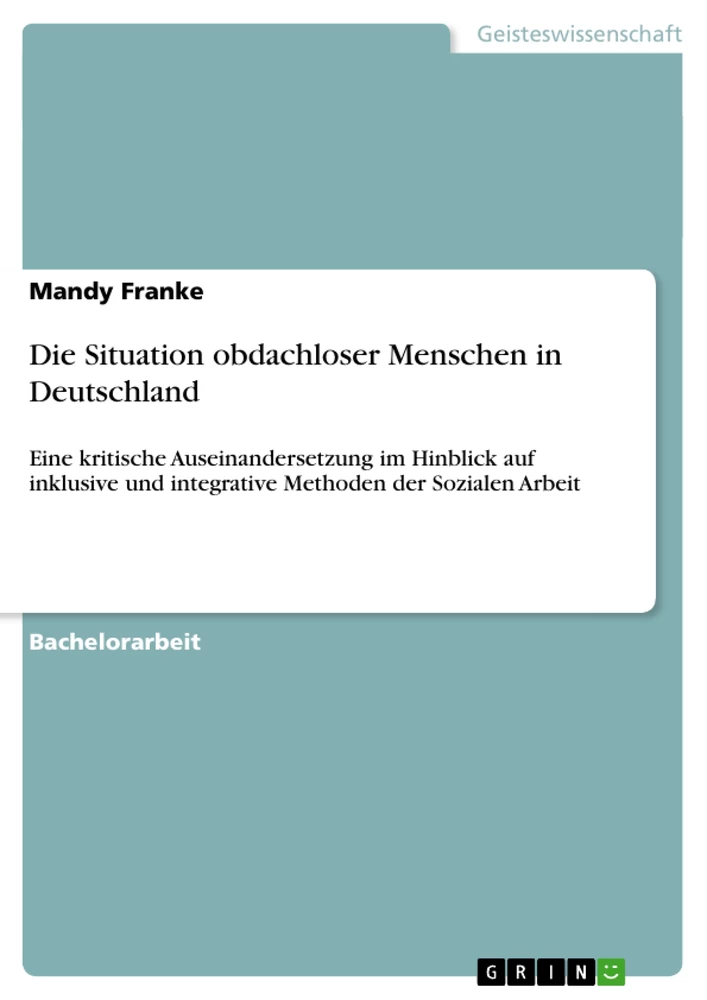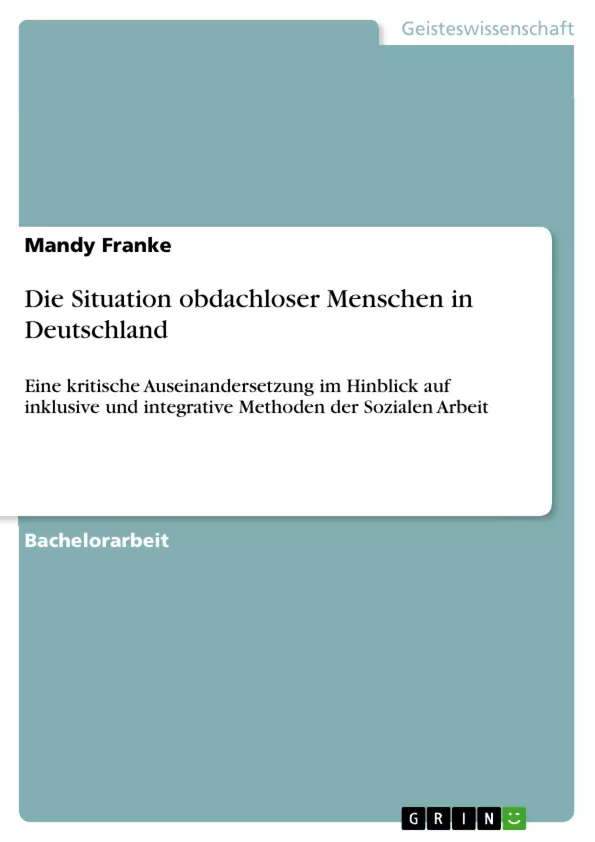Am Umgang mit Randgruppen lässt sich sehr deutlich ablesen, wie es um das soziale Selbstverständnis des Staates und der Solidarität und Rücksicht innerhalb unserer Gesellschaft
bestellt ist. Obdachlose stellen dabei zweifelsohne eine soziale Randgruppe dar, da sie im Alltagsdiskurs als von der Norm abweichend bezeichnet werden. Sie weisen folglich gegenüber der Mehrheitsgesellschaft Merkmale auf, aufgrund derer sie nicht als in das vorherrschende soziale und kulturelle Gefüge eingegliedert gelten. Das deviante Verhalten zeichnet sich dabei durch das Leben ohne Obdach mit den damit zusammenhängenden prekären Lebenslagen aus.
Dabei stellt die Obdachlosigkeit als soziales Problem und deren Bekämpfung ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit dar, denn Ziel ist die Förderung des sozialen Wandels und die Befähigung der
Menschen, in freier Entscheidung ihr Leben besser zu gestalten. Gestützt wird diese Arbeit durch Prinzipien der Menschenrechte und sozialer Gerechtigkeit. Die Soziale Arbeit ist dabei gleichzeitig bestrebt, den sozialen Zusammenhalt unmittelbar zu fördern und darüber hinaus gesellschaftliche
Veränderungsbedarfe anzumahnen. Sie beteiligt sich aktiv an deren Umsetzung und ermöglicht und unterstützt die Teilhabe aller Bürger in einer Gesellschaft (Internetpräsenz: DBSH/ IFWS, 2000, S. 1). Hier wird deutlich, dass die Soziale Arbeit sich neben der Befähigung und Unterstützung des einzelnen Individuums auch an gesellschaftspolitischen Prozessen beteiligt. Erkennbar ist dies dadurch, dass die Situation Obdachloser und die praktische Arbeit der Akteure Sozialer Arbeit immer im Zusammenhang mit Exklusion und gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen steht.
In diesem Kontext soll in dieser Bachelorarbeit versucht werden, die Bearbeitung und Bekämpfung von Obdachlosigkeit in Einklang mit Forderungen nach Integration und Inklusion zu bringen. Laut der Bundesagentur für Arbeit beendet Inklusion das Wechselspiel von Exklusion (ausgrenzen) und Integration (wieder eingliedern) (Internetpräsenz: Bundesagentur für Arbeit, 2011). Bei der Bearbeitung der vorliegenden Thematik soll diese Aussage auf ihre Richtigkeit überprüft werden, wobei sich dabei kritisch mit integrativen und inklusiven Handlungsstrategien und deren Bewertung im Hinblick auf eine professionelle Soziale Arbeit im Bereich der Obdachlosenhilfe auseinandergesetzt werden soll. Dabei kann die Frage „Was hält die Gesellschaft zusammen?“ einen Orientierungsrahmen geben. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Begriffsklärung Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit und Wohnungsnotfall
- Aktuelle Situation
- Inhalte und Ziele der Wohnungslosenhilfe
- Überblick über den aktuellen Wissenstand zum Thema Obdachlosigkeit
- Wege in die Obdachlosigkeit von Kindern und Jugendlichen
- Neugier und Faszination jugendkultureller Szenen
- Rauswurf oder Flucht aus dem Elternhaus bzw. Herkunftsfamilie
- Flucht oder Entlassung aus Jugendhilfeeinrichtungen
- Wege in die Obdachlosigkeit im Erwachsenenalter
- Trennung oder Scheidung vom Partner
- Wiedereingliederung nach Gefängnisaufenthalt
- Armut und Arbeitslosigkeit
- Armutszuwanderung, Einwanderung ohne offizielle Dokumente und Arbeitserlaubnis
- Sonstige Gründe: Häusliche Gewalt, Alkohol- und Drogenmissbrauch, psychische Erkrankungen
- Die Lebenssituation Obdachloser
- Prekäre Lebenssituation: finanzielle Notlage, körperliche und psychische Probleme, Alkohol- und Drogenkonsum
- Bürokratische Barrieren
- Gewalterfahrungen
- (Beschaffungs-)kriminalität
- Überlebens- und Bewältigungsstrategien
- Wege in die Obdachlosigkeit von Kindern und Jugendlichen
- Integration und Inklusion – eine Diskussion
- Ist Soziale Integration gleich Inklusion? Ein Versuch der Begriffsbestimmung
- Inklusion aus verschiedenen Blickwinkeln – ein Überblick
- Ausgrenzung Obdachloser: Ängste, Vorurteile und Stigmatisierungen der Gesellschaft
- Bedeutung sozialer Inklusion und gesellschaftlicher Teilhabe
- Arbeitsauftrag der Sozialen Arbeit zur Resozialisierung Obdachloser
- Inklusive und integrative Methoden der Sozialen Arbeit
- Handlungsstrategien zur Teilhabe
- Empowerment als integratives Handlungskonzept?
- Niederschwellige Angebote als Inklusionsarbeit
- Lebensweltorientierung
- Selbsthilfegruppen und Vernetzungskompetenz
- Klientenzentrierte Soziale Arbeit
- Studien- und Integrationsprojekte
- Beispiel: die Studie Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
- Weitere Projekte und Initiativen zum Thema Obdachlosigkeit
- Thematisierung und Enttabuisierung in den Medien
- Forderung einer nationalen Strategie zur Überwindung von Wohnungsnot und Armut in Deutschland
- Handlungsstrategien zur Teilhabe
- Chancen und Grenzen von inklusiven und integrativen Methoden der Sozialen Arbeit
- Integration vs. Selbstbestimmtheit
- Vielfalt statt Einfalt
- Arbeitsauftrag Soziale Arbeit: Wege zur Verbesserung Lebenssituation Wohnungsloser
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Bearbeitung und Bekämpfung von Obdachlosigkeit im Kontext von Integration und Inklusion. Sie untersucht, ob Inklusion das Wechselspiel von Exklusion und Integration beendet und analysiert kritisch integrative und inklusive Handlungsstrategien im Bereich der Obdachlosenhilfe.
- Begriffliche Abgrenzung und Analyse von Integration und Inklusion
- Herausforderungen und Ursachen von Obdachlosigkeit
- Entwicklung und Analyse von integrativen und inklusiven Methoden der Sozialen Arbeit
- Bewertung der Chancen und Grenzen von Inklusionsansätzen in der Obdachlosenhilfe
- Diskussion des Arbeitsauftrags der Sozialen Arbeit im Hinblick auf die Resozialisierung Obdachloser
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Obdachlosigkeit und dessen Bedeutung im Kontext sozialer Randgruppen und gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse dar. Sie führt den Fokus auf die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Förderung des sozialen Wandels und der Befähigung von Menschen zu einer besseren Lebensgestaltung. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Bearbeitung und Bekämpfung von Obdachlosigkeit in Einklang mit Forderungen nach Integration und Inklusion zu bringen.
Das Kapitel "Theoretische Grundlagen" befasst sich mit der Begriffsklärung von Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit und Wohnungsnotfall. Es gibt einen Überblick über die aktuelle Situation der Obdachlosigkeit und beleuchtet die Inhalte und Ziele der Wohnungslosenhilfe.
Das Kapitel "Überblick über den aktuellen Wissenstand zum Thema Obdachlosigkeit" analysiert verschiedene Wege in die Obdachlosigkeit, sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene. Es beleuchtet die prekären Lebensbedingungen Obdachloser und geht auf verschiedene Bewältigungsstrategien ein.
Das Kapitel "Integration und Inklusion – eine Diskussion" befasst sich mit der Frage, ob Soziale Integration gleich Inklusion ist. Es präsentiert verschiedene Perspektiven auf Inklusion und analysiert die Ausgrenzung Obdachloser in der Gesellschaft. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung sozialer Inklusion und gesellschaftlicher Teilhabe und beleuchtet den Arbeitsauftrag der Sozialen Arbeit zur Resozialisierung Obdachloser.
Das Kapitel "Inklusive und integrative Methoden der Sozialen Arbeit" stellt verschiedene Handlungsstrategien zur Teilhabe vor, darunter Empowerment, niederschwellige Angebote, Lebensweltorientierung, Selbsthilfegruppen und klientenzentrierte Soziale Arbeit. Es gibt einen Überblick über Studien- und Integrationsprojekte zum Thema Obdachlosigkeit und beleuchtet die Bedeutung von Thematisierung und Enttabuisierung in den Medien.
Das Kapitel "Chancen und Grenzen von inklusiven und integrativen Methoden der Sozialen Arbeit" diskutiert die Beziehung zwischen Integration und Selbstbestimmtheit und betrachtet die Bedeutung von Vielfalt in der Sozialen Arbeit. Es beleuchtet den Arbeitsauftrag der Sozialen Arbeit im Hinblick auf die Verbesserung der Lebenssituation von Wohnungslosen.
Schlüsselwörter
Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, Integration, Inklusion, Soziale Arbeit, Resozialisierung, Empowerment, niederschwellige Angebote, Lebensweltorientierung, Selbsthilfegruppen, Klientenzentrierte Soziale Arbeit, gesellschaftliche Teilhabe, Stigmatisierung, Armut, Arbeitslosigkeit, soziale Randgruppen.
- Citar trabajo
- Mandy Franke (Autor), 2014, Die Situation obdachloser Menschen in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282826