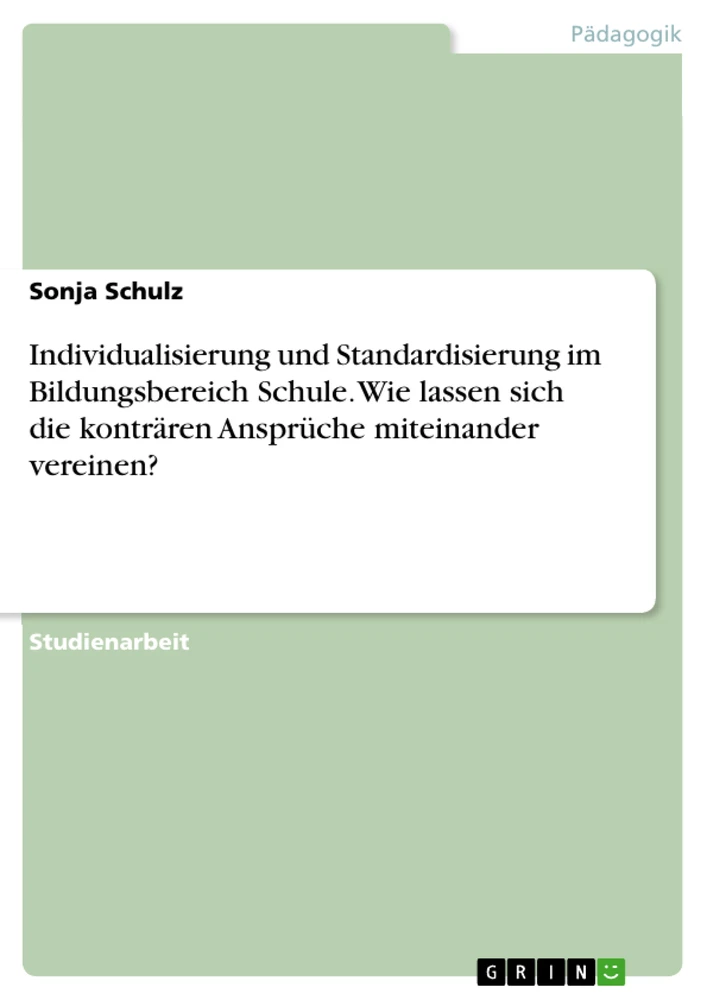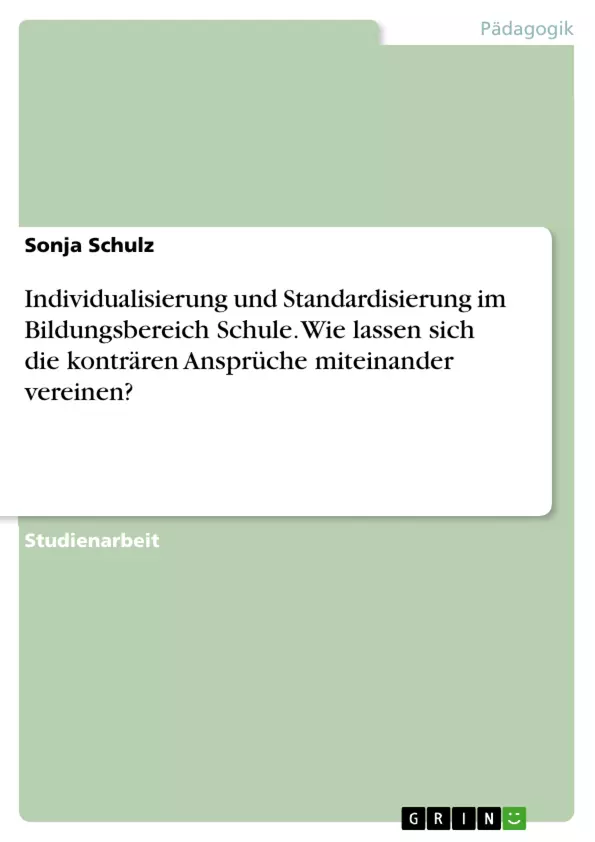‚Standardisierung‘ und ‚Individualisierung‘ sind seit Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse im Jahre 2002 zu zentralen Schlagwörtern innerhalb des öffentlichen Bildungsdiskurses in Deutschland avanciert. Während Standardisierung im Bildungsbereich sich aus den Bedürfnissen und dem Erfordernis nach internationaler wie nationaler Vergleichbarkeit und Qualitätssicherung im Zuge kontrollieren-der, an marktwirtschaftlichen Vorbildern orientierter Educational Governance ergeben hat, welche im Rekordtempo Ergebnisse, Vorgaben und Kontrollinstrumente wie nationale Bildungsstandards, Vergleichsarbeiten, Zentralabschlüsse, Schulinspektionen und Bildungsberichterstattung hervorgebracht hat, findet sich zur vielfach propagierten Forderung nach Individualisierung sowohl in Bezug auf theoretische Begründungen und Konzepte als auch hinsichtlich der praktischen Umsetzung nach wie vor erstaunlich wenig Literatur. Zwar sollte die bestmögliche Förderung eines jeden Schülers eine pädagogische Selbstverständlichkeit sein, dennoch steht die Organisation unserer Schulen (ein ein-zelner Lehrer betreut bis zu über 30 Schüler eines Jahrgangs in einem Raum) einer allzu individuellen Betreuung klar entgegen, und diese Problematik oder Herausforderung nimmt nicht nur durch die „veränderte Kindheit“, sondern spätestens seit der Unterzeichnung der UN-Behindertenkonvention 2006 mit der Entstehung inklusiver Schulen sowie den vielerorts erfolgten Zusammenlegungen ehemaliger Haupt- und Realschulen ganz neue Dimensionen an. Entsprechend erleben viele Lehrer die an sie heran getragenen Ansprüche von Homogenisierungszwängen auf der einen Seite und dem „Recht“ der Schüler und Eltern auf individuelle Förderung und Bildung im Sinne eines 1-zu-1-Verhältnisses andererseits als Spannung oder gar Zumutung.
Im Rahmen dieser Arbeit soll diese Spannung genauer beleuchtet und der Frage nachgegangen werden, wie sich individuelle Lern- und Bildungsprozesse auf dem Hintergrund einer standardisierten Output-Orientierung in allgemeinbildenden Schulen gestalten lassen. Handelt es sich hierbei überhaupt um einen Widerspruch und eine Unzumutbarkeit, oder stellen beide Phänomene, wie Bildungs- und Kultusministerien dies in überarbeiteten Lehrplänen und aktuellen Praxisbroschüren häufig darstellen, lediglich zwei Seiten einer Medaille dar (Kapitel 4.1)? Welche Bedingungen und Konzepte sind notwendig bzw. förderlich (Kapitel 4.2)?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Standardisierung der Bildung
- 2.1 Zur Bedeutung und Geschichte des Bildungsbegriffs in Deutschland
- 2.2 Der Bildungsbegriff nach PISA
- 2.3 Widersprüchlichkeiten und Grenzen der Standardisierung von „Bildung“
- 3 Gesellschaftliche Individualisierungsprozesse
- 3.1 Individualisierung in der Soziologie
- 3.2 Individualisierung, Differenzierung und Standardisierung
- 3.3 Individualisierung im Bildungsbereich
- 4 Standardisierung und Individualisierung im Bildungssystem
- 4.1 Paradoxien und Zusammenhänge
- 4.2 Richtlinien und Konzepte zur Umsetzung
- 4.2.1 Empfehlungen des Kultusministeriums Hessen
- 4.2.2 Der „Response to Intervention“-Ansatz
- 4.2.3 Die Bildungsgangdidaktik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Spannungsbereich zwischen Standardisierung und Individualisierung im deutschen Bildungssystem. Sie analysiert, wie die konträren Ansprüche nach nationaler Vergleichbarkeit und Qualitätssicherung einerseits und der individuellen Förderung jedes Schülers andererseits miteinander vereinbar sind. Die Arbeit beleuchtet die historischen und theoretischen Grundlagen dieser Herausforderungen und untersucht verschiedene Konzepte und Richtlinien zur Umsetzung.
- Der Wandel des Bildungsbegriffs in Deutschland und seine Widersprüche im Kontext von PISA.
- Der Einfluss gesellschaftlicher Individualisierungsprozesse auf das Bildungssystem.
- Die Paradoxien und Zusammenhänge zwischen Standardisierung und Individualisierung in der Schulpraxis.
- Analyse von Konzepten zur Vereinbarkeit von Standardisierung und individueller Förderung.
- Bewertung der Herausforderungen für Lehrer im Umgang mit diesen gegensätzlichen Anforderungen.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Vereinbarkeit von Standardisierung und Individualisierung im Bildungsbereich vor dem Hintergrund der PISA-Ergebnisse und der UN-Behindertenkonvention. Sie beschreibt den Konflikt zwischen den Anforderungen an Homogenisierung und der Notwendigkeit individueller Förderung und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit der Bedeutung des Bildungsbegriffs, gesellschaftlichen Individualisierungsprozessen und schließlich konkreten Konzepten zur Umsetzung befasst.
2 Standardisierung der Bildung: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte und Bedeutung des Bildungsbegriffs in Deutschland, beginnend mit Humboldt's humanistischem Ideal bis hin zu den modernen, durch PISA beeinflussten bildungspolitischen Diskursen. Es analysiert die Widersprüche zwischen dem klassischen Bildungsbegriff und der aktuellen Output-Orientierung, die durch Bildungsstandards, Vergleichsarbeiten und Monitoring entsteht. Der Konflikt zwischen empirischer Bildungsforschung und Bildungstheorie wird hier ebenfalls aufgezeigt.
3 Gesellschaftliche Individualisierungsprozesse: Dieses Kapitel erörtert gesellschaftliche Individualisierungsprozesse, beginnend mit einer soziologischen Definition und historischen Darstellung. Es wird der Zusammenhang zwischen Individualisierung, Differenzierung und Standardisierung anhand von Ulrich Becks Theorien erklärt. Schließlich wird der Begriff der „individuellen Förderung“ im schulischen Kontext definiert und die Konsequenzen für den Umgang mit Heterogenität und Individualisierung im Bildungsbereich diskutiert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Standardisierung und Individualisierung im deutschen Bildungssystem
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Spannungsbereich zwischen Standardisierung und Individualisierung im deutschen Bildungssystem. Sie analysiert, wie die gegensätzlichen Ansprüche nach nationaler Vergleichbarkeit und Qualitätssicherung einerseits und der individuellen Förderung jedes Schülers andererseits miteinander vereinbar sind.
Welche Aspekte werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historischen und theoretischen Grundlagen dieser Herausforderungen und untersucht verschiedene Konzepte und Richtlinien zur Umsetzung. Konkret werden der Wandel des Bildungsbegriffs in Deutschland, der Einfluss gesellschaftlicher Individualisierungsprozesse auf das Bildungssystem, die Paradoxien und Zusammenhänge zwischen Standardisierung und Individualisierung in der Schulpraxis sowie die Analyse von Konzepten zur Vereinbarkeit von Standardisierung und individueller Förderung behandelt. Die Herausforderungen für Lehrer im Umgang mit diesen gegensätzlichen Anforderungen werden ebenfalls bewertet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und ein Fazit (implizit). Kapitel 1 behandelt die Einleitung und Forschungsfrage. Kapitel 2 beleuchtet die Standardisierung der Bildung, einschließlich der Geschichte des Bildungsbegriffs in Deutschland und den Widersprüchen im Kontext von PISA. Kapitel 3 erörtert gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und deren Einfluss auf das Bildungssystem. Kapitel 4 (implizit im Inhaltsverzeichnis) analysiert Konzepte zur Vereinbarkeit von Standardisierung und individueller Förderung (z.B. Empfehlungen des Kultusministeriums Hessen, Response to Intervention, Bildungsgangdidaktik).
Welche Konzepte zur Umsetzung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Konzepte und Richtlinien zur Umsetzung der Vereinbarkeit von Standardisierung und individueller Förderung. Beispiele hierfür sind die Empfehlungen des Kultusministeriums Hessen, der „Response to Intervention“-Ansatz und die Bildungsgangdidaktik.
Welche Bedeutung hat der PISA-Studie in dieser Arbeit?
Die PISA-Studie dient als wichtiger Bezugspunkt, um die Herausforderungen der Standardisierung im Bildungssystem aufzuzeigen und den Wandel des Bildungsbegriffs in Deutschland im Kontext der Vergleichbarkeit zu analysieren. Die Ergebnisse der PISA-Studien konfrontieren das deutsche Bildungssystem mit der Notwendigkeit von Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit, was im Spannungsfeld zur individuellen Förderung steht.
Welche Rolle spielt der Begriff der „Individualisierung“?
Der Begriff der „Individualisierung“ wird soziologisch definiert und historisch dargestellt. Es wird der Zusammenhang zwischen Individualisierung, Differenzierung und Standardisierung anhand von Ulrich Becks Theorien erklärt. Im schulischen Kontext wird der Begriff der „individuellen Förderung“ definiert und die Konsequenzen für den Umgang mit Heterogenität und Individualisierung im Bildungsbereich diskutiert.
Was sind die zentralen Herausforderungen für Lehrer?
Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen für Lehrer im Umgang mit den gegensätzlichen Anforderungen von Standardisierung und individueller Förderung. Lehrer müssen den Spagat zwischen den Anforderungen an Homogenisierung und der Notwendigkeit individueller Förderung meistern.
Wie wird der Konflikt zwischen Standardisierung und Individualisierung dargestellt?
Der Konflikt wird als zentrales Spannungsfeld dargestellt, das die Arbeit durchzieht. Die Arbeit analysiert die Paradoxien und Zusammenhänge zwischen beiden Polen und untersucht, wie diese scheinbar gegensätzlichen Ansprüche miteinander vereinbart werden können. Die Arbeit zeigt auf, dass es einen Konflikt zwischen dem klassischen Bildungsbegriff und der aktuellen Output-Orientierung gibt, der durch Bildungsstandards, Vergleichsarbeiten und Monitoring entsteht.
- Citar trabajo
- Sonja Schulz (Autor), 2014, Individualisierung und Standardisierung im Bildungsbereich Schule. Wie lassen sich die konträren Ansprüche miteinander vereinen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283079