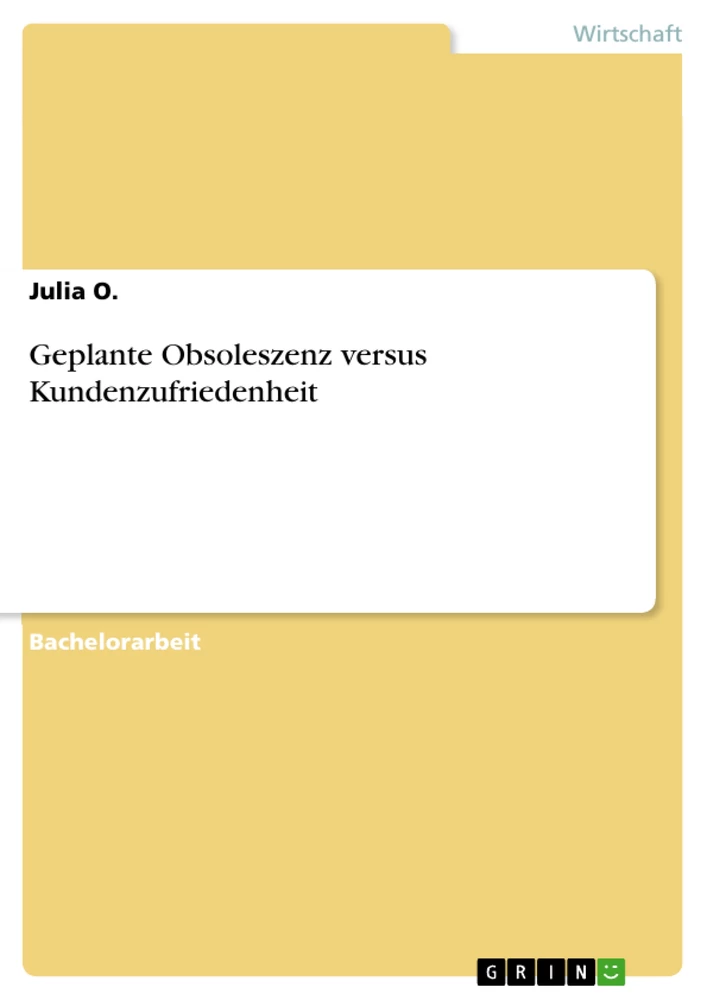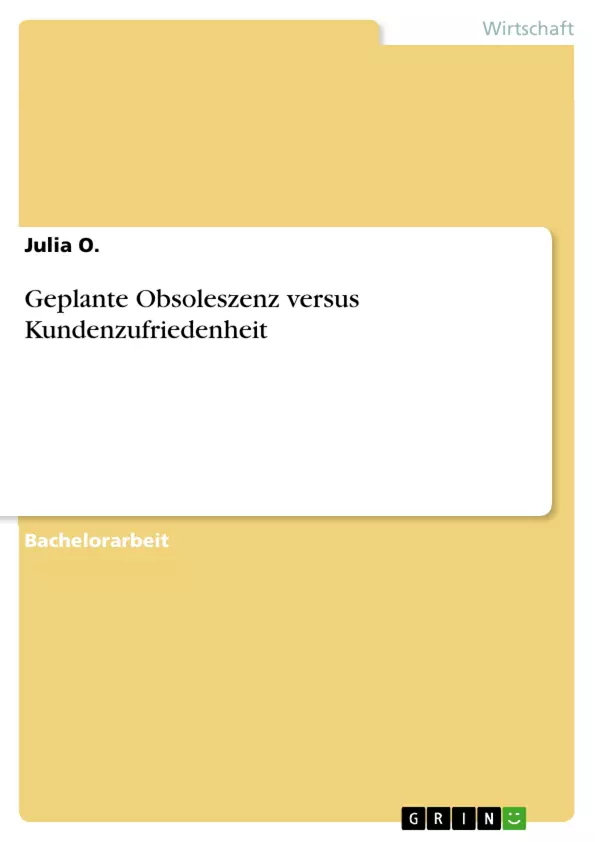Die Arbeit setzt sich mit dem Thema der geplanten Obsoleszenz auseinander und beleuchtet es dabei sowohl aus theoretischer wie aus empirischer Perspektive. Dazu ergründet sie die von Konsumenten erwartete Lebensdauer bestimmter Produkte sowie die Strategie, die hinter der künstlich reduzierten Lebensdauer steht.
Viele deutsche Konsumenten kennen das Problem. Kurz nach Ablauf der Garantiezeit gehen insbesondere elektronische Geräte kaputt. Was für die meisten Konsumenten als ärgerlicher Zufall oder Fehlkauf erscheint, ist in vielen Fällen Bestandteil einer raffinierten Produktstrategie stark profitorientierter Unternehmen.
Um gezielt Nachkäufe zu generieren, setzen Hersteller bewusst darauf, die Lebensdauer ihrer Produkte durch eingebaute Schwachstellen oder die Verwendung minderwertiger Materialien künstlich zu begrenzen und somit ein Verfallsdatum vor zu programmieren.
Für die Hersteller bedeutet dies eine Steigerung des Gesamtabsatzes, welche mit positiven Kostendegressionseffekten verbunden ist und somit zu einer Erhöhung des Gesamtumsatzes beiträgt. Das funktioniert allerdings nur, solange der Kunde mitspielt. Denn er gleicht seine Erwartungen an das Produkt (Soll) mit der Leistung (Ist) des Produkts ab. Dieser Vergleich entscheidet, ob er mit dem Artikel zufrieden ist und ob ein Wiederkauf beim gleichen Hersteller erfolgt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Aufbau
- 2. Shopping Goods
- 2.1 Begriffsdefinition und Abgrenzung
- 2.2 Kaufentscheidungsprozess bei Shopping Goods
- 2.3 Einkaufsverhalten deutscher Konsumenten bei ausgewählten Produktgruppen
- 2.3.1 (Flachbild-)Fernseher
- 2.3.2 Smartphones
- 2.3.3 Waschmaschinen und Kühlschränke
- 3. Geplante Obsoleszenz - vorzeitiger Verschleiß als Umsatzbeschleuniger?
- 3.1 Begriffsdefinition
- 3.2 Differenzierung von Obsoleszenz-Arten nach „Grad des Vorsatzes“
- 3.2.1 Bewusst geplanter vorzeitiger Verschleiß
- 3.2.2 Gewollter vorzeitiger Verschleiß
- 3.3 Treiber und Faktoren für Obsoleszenz-Strategien
- 4. Kundenzufriedenheit
- 4.1 Begriffsdefinition
- 4.2 Theoretische und konzeptionelle Grundlagen
- 4.2.1 Confirmation/Disconfirmation-Paradigma
- 4.2.2 Kano-Modell
- 4.2.3 Assimilations-Kontrast-Theorie
- 4.3 Anforderungen für Hersteller
- 5. Empirische Untersuchung - Kundenerwartungen an die Lebensdauer ausgewählter Shopping Goods
- 5.1 Definition der Zielsetzung
- 5.2 Methodik
- 5.2.1 Forschungsdesign
- 5.2.2 Stichprobenziehung
- 5.2.3 Datenerhebung
- 5.3 Datenauswertung
- 5.4 Diskussion der Ergebnisse
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Konflikt zwischen geplanter Obsoleszenz und Kundenzufriedenheit im Kontext von Shopping Goods. Ziel ist es, die Strategien der Hersteller hinsichtlich der Produkt-Lebensdauer zu analysieren und deren Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit zu bewerten. Die empirische Untersuchung fokussiert auf die Erwartungen deutscher Konsumenten an die Lebensdauer ausgewählter Produktgruppen.
- Geplante Obsoleszenz als Marketingstrategie
- Einkaufsverhalten deutscher Konsumenten bezüglich langlebiger Güter
- Einfluss der Produkt-Lebensdauer auf die Kundenzufriedenheit
- Theoretische Modelle zur Kundenzufriedenheit (Confirmation/Disconfirmation-Paradigma, Kano-Modell)
- Empirische Untersuchung der Kundenerwartungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt die Problemstellung des Konflikts zwischen geplanter Obsoleszenz und Kundenzufriedenheit und benennt die Zielsetzung der Arbeit. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und legt den methodischen Rahmen fest. Die Einleitung dient als Grundlage für die folgenden Kapitel, in denen die theoretischen und empirischen Aspekte der Thematik detailliert untersucht werden.
2. Shopping Goods: Dieses Kapitel definiert und grenzt Shopping Goods ab und analysiert den Kaufentscheidungsprozess dieser Produktkategorie. Es untersucht das Einkaufsverhalten deutscher Konsumenten anhand ausgewählter Produktgruppen wie Flachbildfernseher, Smartphones und Haushaltsgeräte. Die Analyse des Kaufverhaltens liefert wichtige Grundlagen für das Verständnis der Konsumentenperspektive im Kontext von geplanter Obsoleszenz und deren Auswirkungen auf die Zufriedenheit.
3. Geplante Obsoleszenz - vorzeitiger Verschleiß als Umsatzbeschleuniger?: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff der geplanten Obsoleszenz und differenziert zwischen verschiedenen Arten, je nach Grad des Vorsatzes. Es analysiert die treibenden Kräfte und Faktoren hinter Obsoleszenzstrategien der Hersteller. Die Kapitel verdeutlicht die komplexen Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen Zielen und den Folgen für die Konsumenten.
4. Kundenzufriedenheit: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Kundenzufriedenheit und erläutert relevante theoretische und konzeptionelle Grundlagen, wie das Confirmation/Disconfirmation-Paradigma und das Kano-Modell. Es analysiert Anforderungen der Hersteller an die Kundenzufriedenheit und verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Produktqualität, Lebensdauer und Kundenzufriedenheit.
5. Empirische Untersuchung - Kundenerwartungen an die Lebensdauer ausgewählter Shopping Goods: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung, die Methodik (Forschungsdesign, Stichprobenziehung, Datenerhebung) und die Auswertung der Daten. Es diskutiert die Ergebnisse der Untersuchung und deren Bedeutung für die Fragestellung der Arbeit. Die empirischen Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die tatsächlichen Kundenerwartungen.
Schlüsselwörter
Geplante Obsoleszenz, Kundenzufriedenheit, Shopping Goods, Konsumentenverhalten, Lebensdauer, Produktqualität, Empirische Untersuchung, Confirmation/Disconfirmation-Paradigma, Kano-Modell, Marketingstrategie.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Geplante Obsoleszenz und Kundenzufriedenheit bei Shopping Goods
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Konflikt zwischen geplanter Obsoleszenz und Kundenzufriedenheit im Kontext von Shopping Goods. Sie analysiert die Strategien der Hersteller bezüglich der Produktlebensdauer und deren Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit. Ein Schwerpunkt liegt auf den Erwartungen deutscher Konsumenten an die Lebensdauer ausgewählter Produktgruppen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Geplante Obsoleszenz als Marketingstrategie, Einkaufsverhalten deutscher Konsumenten bezüglich langlebiger Güter, Einfluss der Produktlebensdauer auf die Kundenzufriedenheit, theoretische Modelle zur Kundenzufriedenheit (Confirmation/Disconfirmation-Paradigma, Kano-Modell) und eine empirische Untersuchung der Kundenerwartungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Zielsetzung, Aufbau), Shopping Goods (Definition, Kaufentscheidungsprozess, Einkaufsverhalten), Geplante Obsoleszenz (Definition, Arten, treibende Faktoren), Kundenzufriedenheit (Definition, theoretische Grundlagen, Anforderungen an Hersteller), Empirische Untersuchung (Zielsetzung, Methodik, Datenauswertung, Ergebnisdiskussion) und Zusammenfassung mit Ausblick.
Was wird unter „Shopping Goods“ verstanden?
Die Arbeit definiert und grenzt den Begriff „Shopping Goods“ ab und analysiert den Kaufentscheidungsprozess für diese Produktkategorie. Es werden konkrete Beispiele wie Flachbildfernseher, Smartphones und Haushaltsgeräte untersucht, um das Einkaufsverhalten deutscher Konsumenten zu beleuchten.
Wie wird geplante Obsoleszenz definiert und differenziert?
Die Arbeit definiert geplante Obsoleszenz und differenziert zwischen verschiedenen Arten, abhängig vom Grad des Vorsatzes (bewusst geplanter vs. gewollt vorzeitiger Verschleiß). Sie analysiert die treibenden Kräfte und Faktoren hinter den Obsoleszenzstrategien der Hersteller.
Welche theoretischen Modelle zur Kundenzufriedenheit werden verwendet?
Die Arbeit erläutert relevante theoretische Modelle zur Kundenzufriedenheit, darunter das Confirmation/Disconfirmation-Paradigma und das Kano-Modell. Diese Modelle dienen zur Analyse des Zusammenhangs zwischen Produktqualität, Lebensdauer und Kundenzufriedenheit.
Wie sieht die empirische Untersuchung aus?
Die empirische Untersuchung konzentriert sich auf die Kundenerwartungen an die Lebensdauer ausgewählter Shopping Goods. Sie beschreibt das Forschungsdesign, die Stichprobenziehung, die Datenerhebung und die Auswertung der Daten. Die Ergebnisse liefern Einblicke in die tatsächlichen Kundenerwartungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geplante Obsoleszenz, Kundenzufriedenheit, Shopping Goods, Konsumentenverhalten, Lebensdauer, Produktqualität, Empirische Untersuchung, Confirmation/Disconfirmation-Paradigma, Kano-Modell, Marketingstrategie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Konflikt zwischen geplanter Obsoleszenz und Kundenzufriedenheit zu untersuchen, die Strategien der Hersteller zu analysieren und deren Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit zu bewerten. Die empirische Untersuchung fokussiert auf die Erwartungen deutscher Konsumenten an die Lebensdauer ausgewählter Produktgruppen.
Wo finde ich die detaillierten Ergebnisse der empirischen Untersuchung?
Die detaillierten Ergebnisse der empirischen Untersuchung, inklusive Methodik und Datenauswertung, befinden sich im Kapitel 5 der Bachelorarbeit.
- Citation du texte
- Julia O. (Auteur), 2013, Geplante Obsoleszenz versus Kundenzufriedenheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283224