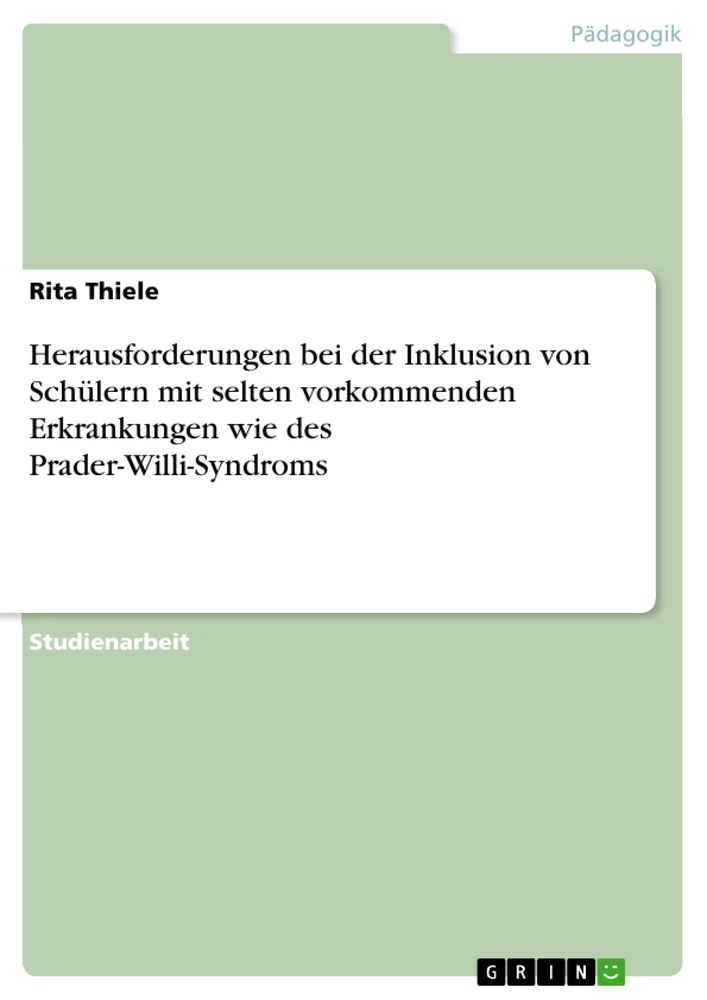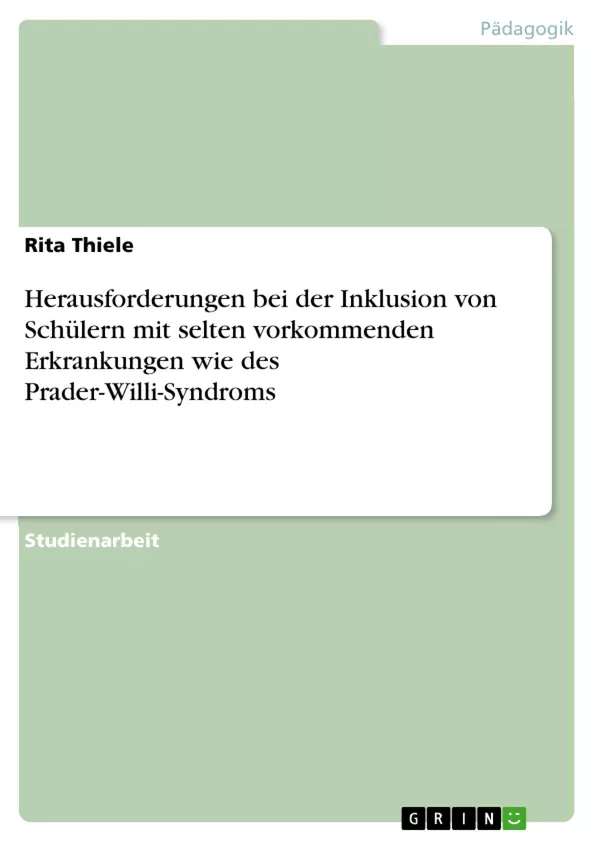Die Inklusion ist ein Begriff, der sich seit der Salamanca-Konferenz von 1994 in der Pädagogik immer weiter verbreitet hat. Er steht für die Öffnung des allgemeinen Schulsystems für alle Schüler mit und ohne Behinderung. Dies bedeutet in der Folge eine erweiterte Heterogenität der Schülerschaft, als sie ohnehin schon Realität in den Schulen ist. Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention gibt es das Recht auf Inklusion, so dass alle Schüler ohne Ausnahme gemeinsam unterrichtet werden sollen. Der Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland lässt es allerdings zu, dass es auch in dieser Frage, wie und wann welche Schritte gemacht werden, sehr vage bleibt und daher die Inklusion Gefahr läuft, zerredet zu werden, noch bevor sie ein Erfolgsmodell werden könnte. Die Barrieren in den Köpfen sind oft größer als die in der Infrastruktur.
Der Fokus dieser Hausarbeit liegt auf der inklusiven Unterrichtung von Kindern mit einer seltenen Erkrankung . Im Speziellen geht es um die Inklusion vom Prader-Willi-Syndrom Betroffenen in der Sekundarstufe 1 an einer Regelschule. Inklusion ist eine verschärfte Form der Heterogenität, da die Leistungsfähigkeit und die Begabungen der einzelnen Schüler in einer Klasse, in der nicht-behinderte und behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet werden, oft weit auseinander liegen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- BEGRIFFSDEFINITIONEN
- Heterogenität
- Integration versus Inklusion
- Pädagogik der Inklusion
- Sonderpädagogischer Förderbedarf und Nachteilsausgleich
- Leistungsbewertung
- Behinderung
- Auswirkungen der Inklusion
- Chancen und Grenzen
- Das Prader-Willi-Syndrom
- Unterstützung und Therapie
- Auswirkungen im alltäglichen Umgang
- Umgang aus Sicht der Betroffenen
- INKLUSION VON PRADER-WILLI-SYNDROM-BETROFFENEN
- Pädagogische Ansätze
- Stellung der Eltern
- Der Einfluss der Umwelt
- Vorteile der Inklusion für PWS-Betroffene
- FAZIT UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die inklusive Unterrichtung von Kindern mit dem Prader-Willi-Syndrom in der Sekundarstufe 1 an einer Regelschule. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen der Inklusion von Schülern mit seltenen, multiplen Behinderungen zu beleuchten, wobei der Fokus auf dem Prader-Willi-Syndrom liegt.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Heterogenität und Inklusion im Kontext des deutschen Schulsystems
- Analyse der Auswirkungen von Behinderung auf die Inklusion und deren Chancen und Grenzen
- Besondere Herausforderungen und Chancen der Inklusion von Schülern mit dem Prader-Willi-Syndrom
- Pädagogische Ansätze und Strategien für die inklusive Unterrichtung von PWS-Betroffenen
- Bewertung des aktuellen Standes der Inklusion in Deutschland und Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Inklusion im deutschen Schulsystem ein und definiert den Schwerpunkt der Arbeit auf die inklusive Unterrichtung von Schülern mit dem Prader-Willi-Syndrom.
- Begrifflichkeiten: In diesem Kapitel werden die Begriffe Heterogenität und Inklusion definiert und abgegrenzt. Des Weiteren werden die Auswirkungen von Behinderung auf die Inklusion, sowie Chancen und Grenzen der Inklusion von Schülern mit Behinderung beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf dem Prader-Willi-Syndrom.
- Inklusion von Prader-Willi-Syndrom-Betroffenen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den pädagogischen Ansätzen für die inklusive Unterrichtung von Schülern mit dem Prader-Willi-Syndrom. Darüber hinaus werden die Rolle der Eltern und der Einfluss der Umwelt auf die Inklusion beleuchtet.
Schlüsselwörter
Inklusion, Heterogenität, Behinderung, Prader-Willi-Syndrom, Pädagogik der Vielfalt, Integration, Sonderpädagogischer Förderbedarf, Chancen und Grenzen der Inklusion, seltene Erkrankungen, inklusive Unterrichtung, Pädagogische Ansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Prader-Willi-Syndrom (PWS)?
PWS ist eine seltene genetische Erkrankung, die unter anderem mit kognitiven Beeinträchtigungen und einem fehlenden Sättigungsgefühl einhergeht.
Wie gelingt Inklusion bei Schülern mit PWS?
Inklusion erfordert individuelle pädagogische Ansätze, Nachteilsausgleiche und eine enge Begleitung durch sonderpädagogischen Förderbedarf in der Regelschule.
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Integration gliedert Kinder in ein bestehendes System ein; Inklusion verändert das System so, dass es der Heterogenität aller Schüler gerecht wird.
Welche Barrieren gibt es bei der Umsetzung von Inklusion?
Neben der Infrastruktur sind oft "Barrieren in den Köpfen" und die mangelnde Vorbereitung des Schulsystems auf seltene Erkrankungen große Herausforderungen.
Welche Rolle spielen die Eltern bei der Inklusion?
Eltern sind zentrale Partner, da sie Experten für die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kinder mit seltenen Erkrankungen sind.
- Citation du texte
- Rita Thiele (Auteur), 2013, Herausforderungen bei der Inklusion von Schülern mit selten vorkommenden Erkrankungen wie des Prader-Willi-Syndroms, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283295